König der Hipster
oder
Die Behauptung der Differenz
Ein Essay von Oliver Zajac

I. Vans. Atlantic. Noir
Also bezahlten wir, nahmen die Motorradhelme auf und erhoben uns aus den Stühlen auf der Veranda eines kleinen – ja was eigentlich – südwestfranzösischen Bistros oder Weinlokals oderwasauchimmer, machten uns auf den Weg runter in die südwestfranzösische Kleinstadt, vorbei an dem Tisch der drei jungen tätowierten Spanier, deren zugegebenermassen ziemlich lässigen Harleys an einer südwestfranzösischen Strasse neben einem südwestfranzösischem Oderwasauchimmer parkten, und die sich munter durch die Tapaskarte bestellten, weil man in dem Oderwasauchimmer Tapas bestellen musste, um an einem südwestfranzösischem Nachmittag auch Alkohol serviert zu bekommen, dessen öbergärige Form sich einer der Spanier gerade in seinen mit sinnlosen Tattoosprüchen drapierten rasierten Schädel goss, gingen vorbei an dem „Deus ex Machina“-Laden auf der anderen Strassenseite, in dem ich mir nur ein paar Stunden zuvor für eine Hundertstelsekunde lang überlegt hatte, ein T-Shirt mit dem gezeichneten Bild einer nackten Frau auf einem Motorrad und dem sinnlosen Spruch „Put Something Exciting Between Your Legs!“ darauf zu kaufen, sahen mal wieder den Bosshoss-Fahrer mit Kreuznacher Nummer die Strasse hoch kommen, gefolgt von den immer gleichen Fremdschäm-Harleys und einer jungen Frau in einer hautengen schwarzen Lederkombi, die wohl von irgendjemand verpflichtet worden war, zu Promotionszwecken immer und immer wieder auf einem – ja was eigentlich – zigarrenförmigen Designermoped die gleichen Strassen durch eben diese südwestfranzösische Kleinstadt zu fahren, überlegte kurz, ob ich ihr das T-Shirt mit „Put Something..!“ kaufen sollte, einen Gedanken, den ich aber gleich wieder verwarf, beobachtete die mit ziemlich viel Geld authentisch nachlässig gekleideten Pariser Mecs in der Brasserie unten am kleinen Platz und betrat schliesslich zusammen mit Claude den kleinen Schuhladen, wo wir dankbar den kühlen Hauch einer Klimaanlage an einem ziemlich heissen südwestfranzösischen Nachmittag vernahmen, und ich unverzüglich mit hitzedurchweichtem Hirn vorbei an einer mittelalten südwestfranzösischen Schuhverkäuferin mit Pagenschnitt, von der ich hoffte, sie möge noch möglichst lange auf ihrem Stuhl sitzen bleiben, ohne anzufangen, mich eilfertig zu nerven, die Sneakerregale ansteuerte, obwohl ich eigentlich gar keine Sneaker kaufen wollte, sondern nur möglichst regenfeste Schuhe, da es morgen regnen sollte, ich meine festen Stiefel aber zuhause vergessen hatte und Motorradfahren mit Chucks im Regen nicht wirklich oder nur sehr kurz Spass macht, als sich der mittelalte Pagenschnitt sichtlich gelangweilt dann doch aus ihrem Stuhl erhob und uns fragte, ob wir zwei denn auch beim Wheels & Waves seien, nur um aufgrund unseres selbsterklärenden Aufzugs sich dann selbst und stumm die Antwort zu geben und müde seufzend zu sagen:
„Vans. Adlonntique. Noir.“
Und ich weiss gar nicht mehr, wer von uns beiden vor ein paar Jahren auf die Idee kam, unserer jährlichen Juniausfahrt kreuz und quer durch Europa ausgerechnet Biarritz als Ziel zu geben. Wahrscheinlich war das sogar ich, der neugierig geworden durch diverse Berichte über das „Woodstock der Motorradfahrer und Surfer“ beschlossen hatte, dem Wheels & Waves mal einen Besuch abzustatten, und hierzu über Monate versuchte, Claude irgendwie fast 3000 Autobahnkilometer schmackhaft zu machen, die der eigentlich hasst wie die Pest. Irgendwann aber überzeugte ihn eine kluge Etappenwahl, als auch die Aussicht auf einige Pyrenäenpässe, und wir schlugen im Juni 2015 zur vierten Ausgabe des Festivals in Biarritz auf. Das Wheels & Waves war oder ist im Wesentlichen eine Ansammlung von Zelten oder Hütten, die am Rande des Bade- und Kurortes mit immer noch, wenn auch langsam verblassendem mondänem Glanz, malerisch auf einem Ausstellungsgelände, der sogenannten „Cité de l’Océan“, direkt an der Atlantikküste gelegen ist. Der Strand ist tatsächlich gleich um die Ecke und bei gutem Wetter und entsprechendem Wellengang lassen sich auch immer ein paar Surfer dort finden. Genau die richtige Location also für ein hippes Event, um nach dem Willen der Veranstalter, einer Gruppe von ziemlich hippen Freunden aus Toulouse, die sich selbst Southsiders MC nennen – wobei das MC diesmal nicht nur Motorcycle Club abkürzen, sondern vielmehr auch „Musique“, „Mode“ und „Culture“ mitinbegreifen soll – den Geist der Freiheit zu feiern, den ja irgendwie beide Disziplinen, das Motorradfahren als auch das Surfen, atmen, und diesen Spirit mit möglichst vielen Gleichgesinnten zu teilen. So man jedenfalls dem offiziellen Marketing-BlaBla glauben will, denn eigentlich ging und geht es bei dem Wheels & Waves natürlich niemals um irgendeinen Spirit und schon gar nicht darum, diesen zu teilen. Es ging vielmehr darum, einem Haufen südfranzösischer Hipster und deren internationaler Entourage eine nette mehrtägige Party zu finanzieren, wenn sie sich dazu hergaben, den Produkten der partyfinanzierenden Industrie, und hier vor allem der BMW R nineT, die Weihen der Hipster zu verpassen. Als BMW ihr Retromodell seinerzeit an den Start rollte, um wie andere Hersteller auch an der Vintage-New-Custom-Retro-Welle zu profitieren, die von einigen motorradfahrenden Hipstern und deren Fan-Gemeinde in den Medien befeuert wurde, tat man dies in München oder Spandau zuerst eher zögerlich, vielleicht auch, weil man mit derartigen „Heritage-Motorrädern“ und deren möglicher Kundschaft über keinerlei Erfahrung verfügte. Also beauftragte man einen hipster-tauglichen Designer damit, mit überschaubarem Kosteneinsatz ein Retro-Motorrad auf die Räder zu stellen. Das Ergebnis war die erste BMW R NineT, ein grösstenteils mit Teilen aus dem bereits vorhandenen BMW-Baukasten zusammengestöpseltes Moped mit ein bisschen notdürftiger Retro-Kosmetik, das man der möglichen Kundschaft als mindestens so cool oder hip verkaufen wollte, wie es die Mopeten der motorradfahrenden Hipster zugegebenermassen waren. Das Problem war nur, kein Hipster, der nur ein bisschen Selbstachtung besitzt, würde so ein Dings auch nur mit der Kneifzange anfassen. Ein Problem aber, das sich mit der entsprechenden Menge an Moneten aus der Welt schaffen liess. Also wurden ein paar nette Werbefilmchen mit bekannten Motorrad-Parade-Hipstern abgedreht, BMW trat als Hauptsponsor bei einigen Hipster-Events auf, in den neu aufgelegten Motorrad-Hipster-Magazinen wurden grosszügig Anzeigen gebucht, der Southsiders MC mit Konsorten hatte beim Wheels & Waves eine schöne Zeit und die Sache war geritzt: Die R NineT wurde für BMW ein grosser Erfolg, so gross, dass man mittlerweile in München oder Spandau gottseidank dazu übergegangen ist, das Styling der R NineT mit mehr Kosteneinsatz weiterzuentwickeln, sodass die Fuhre, wenn auch immer noch für keinen echten Hipster akzeptabel, inzwischen und immerhin schnittiger unterwegs ist. Die Rolle der Hipster bei der erfolgreichen Markteinführung der BMW R NineT ist lediglich ein Beispiel dafür, welchen mittlerweile grossen Einfluss oder auch grosse Macht eine Personengruppe besitzen kann, die es offiziell gar nicht gibt. Denn fragt man Menschen, die ganz offensichtlich alle Attribute eines Hipsters mitbringen, ob sie denn auch Hipster seien, so erhält man für gewöhnlich eine erstaunte Verneinung: „ICH und ein Hipster? NEIN! Igitt! Natürlich nicht!“ Auch gibt es keinerlei Institutionen, Vereinigungen oder Parteien, welche die Interessen dieser nur sehr schwer fassbaren Personengruppe vertreten. Dennoch verfügt das soziale Phänomen „Hipster“ gerade in der heutigen Zeit der global gespannten sozialen Netzwerke und der rasanten Kommunikation via Internet über eine soziale Macht, die denjenigen, die sich darauf verstehen, sich der Hipster zu bedienen, nicht nur den Absatz ihrer Produkte oder Weltanschauungen erleichtert, sondern auch die Durchsetzung ihrer politischen Ziele ermöglicht, was mitunter selbst den Weg in verschiedene Bundesministerien ebnen kann. Allerdings ist das Spiel mit des Hipsters Macht aufgrund seines flatterhaften Wesens immer auch mit gewissen Risiken behaftet, da diese Zeit-Geister sich auch plötzlich und unerwartet gegen ihre Zauberlehrlinge kehren können. Das richtige Timing ist deshalb im Umgang mit dem Hipster ganz entscheidend, denn was in seinem Kosmos gestern der „heisseste Scheiss“ war, kann heute bereits langweilig sein und wird vielleicht morgen schon beim Discounter verramscht. Timing ist alles. Und wenn es nur bedeutet, dass ein südwestfranzösischer Schuhladen ganz dringend im Vorfeld eines Hipster-Events in der Nachbarschaft genug Sneaker einer bestimmten Marke, eines bestimmten Modells in einer bestimmten Farbe auf Vorrat hätte ordern sollen, die dann ganz und gar nicht zufällig, sondern gegen Bezahlung, versteht sich, von den Event-Hipstern und deren Staff zur Schau getragen worden sind.
Vor ein paar Jahren habe ich mal in einer Motorradpostille ein Interview gelesen, indem der Schreiberling einen hippen Motorradklamottenverkäufer fragte, ob er denn nicht den Eindruck habe, dass die alten Motorräder derzeit „hipsterisiert“ würden. Und natürlich war die Frage allein schon Schwachsinn, denn ein Motorrad kann nicht hipsterisiert werden, ein altes Motorrad ist ein altes Motorrad und bleibt ein altes Motorrad und mehr nicht. Es kann höchstens accessoirisert, zu einem Accessoire gemacht werden von Leuten, die wiederum von anderen Leuten als Hipster tituliert werden, eben weil sie sich mit einer ganzen Menge an Accessoires umgeben, die unter anderem den Zweck haben, einen Unterschied zu machen zu eben den Accessoires oder Gegenständen mit denen sich Leute umgeben, die von den Leuten, die von diesen Leuten als Hipster tituliert werden, als langweiliger Mainstream empfunden werden. Aber das ist eigentlich auch schon wieder Schwachsinn, denn spätestens in den 1960er Jahren, ausgehend von den USA, wurde das Motorrad zwangsläufig auch zu einem Accessoire, da es seiner eigentlichen Hauptfunktion, der Mobilisierung der Massen enthoben wurde, weil sich in den westlichen Gesellschaften mit steigendem Wohlstand immer breitere Bevölkerungsschichten ein Auto leisten konnten. Das Motorrad wurde so etwas Zusätzliches – und wenn auch für viele die schönste Sache der Welt – zu etwas Nebensächlichem, welches sich hauptsächlich in der Freizeit abspielte. Man fuhr Motorrad nicht, weil man sich als Fortbewegungsmittel „nur“ ein Motorrad und kein Auto leisten konnte, sondern man fuhr Motorrad aus Spass, Vergnügen, aber auch um sich auszudrücken, eine bestimmte rebellische Lebenseinstellung zu zeigen, die sich von den Werten der herrschenden Mainstreamgesellschaft abgrenzte. Anfang der 1970er definiert Eric Turner (Nicht zu verwechseln mit einem gewissen Edward Turner), Präsident der BSA Inc., das war mal der Welt grösster Motorradhersteller, die neue Rolle des Motorrads hellsichtig wie folgt:
„In den wohlhabenderen Ländern ist das Motorrad heute in erster Linie ein spassiges, sportliches und groovy Freizeitprodukt, aber auch ein Symbol der Virilität und Männlichkeit. Seit sich die Vereinigten Staaten zusammen mit Canada des höchsten Lebensstandards erfreuen, ist Nordamerika bei weitem unser grösster Absatzmarkt. Aber das verfügbare Einkommen in anderen Teilen der Welt steigt ebenfalls rapide an. Unsere Marktforschung geht deshalb davon aus, dass unser Wachstum in diesen Ländern noch schneller sein könnte als unser Wachstum in Nordamerika.“
Ein prognostiziertes Wachstum, das dann auch tatsächlich eintreten sollte, an dem sich aber allerdings in der Hauptsache die japanische Motorradindustrie erfreuen durfte, da sich die englische Motorradindustrie, und mit am schnellsten Turners eigener Laden, auch durch haarsträubende Managementfehler entschieden und nachhaltig in den Abgrund wirtschaftete. Als sich das Motorrad vom notwendigen Fortbewegungsmittel zum angesagten Lifestyle-Produkt entwickelte, setzte auch die Evolution des Motorrades eigentlich erst richtig ein, denn davon befreit ein blosses Vehikel für die Fahrt von A nach B zu sein, wurde es immer mehr Spiegel einer sich verändernden und diversifizierenden Gesellschaft, die auch das Motorrad benutzte, um verschiedene Bedürfnisse, Lebensauffassungen und Lifestyles auszudrücken. Und eben deshalb schnappte mit der Entwicklung des Motorrades zu Choppern, Scramblern, Komfortourern, Sporttourern, Superbikes, Naked Bikes, Factory Costumizing, Enduros, Supermotos usw. auch die übliche Kommunikationsfalle einer diversifizierten Konsumgesellschaft zu, der niemand entkommt, da sie einen jeden Fahrer zwang, sich damit auseinanderzusetzen, was er mit der Wahl seines Motorrades als Freizeitaccessoire ausdrücken wollte, denn man „musste“ ja nicht mehr Motorrad fahren, man wollte vielmehr Motorradfahren und jedem Wollen liegt nunmal eine Intention, eine Motivation und damit ein von Dritten nicht nur an der Gestalt des Motorrades ablesbarer Ausdruck zugrunde. Der Ausdruck durch das Accessoire „Motorrad“ war somit eigentlich von Anfang, seit seiner Entfesselung gegeben, auch wenn es nur dazu dienen sollte, sich von einem als langweilig empfundenen Mainstream abzusetzen, so wie es den Hipstern heute unterstellt wird, zu tun. Es ist vor diesem Hintergrund einerlei, ob Hipster Motorräder accessoirisieren, denn im Grunde accessoirisiert jeder Motorradfahrer sein Motorrad, auch jene, die sich gelegentlich zu den Lordsiegelbewahrern der reinen Motorradkultur aufschwingen, was auch immer das sein soll, und die verächtlich auf jene herabschauen, die nicht die Motorräder fahren oder nicht so fahren, wie es ihrem beschränkten Selbstbild entspricht. Es ist deshalb eigentlich oder grösstenteils Konsens in der Motorradfahrerschaft, dass man dem Motorrad eines anderen Fahrers mit Respekt begegnet. Das mag der eine oder andere bedauerlich finden, auch aus durchaus verständlichen Gründen, da zum Beispiel die Yamaha Virago in Deutschland immer noch eine der meistgefahrenen Motorradtypen ist, was sicherlich auch daran liegt, dass aus obergenannten Gründen es noch niemand fertig gebracht hat, ihren Besitzern zu sagen, wie scheisse die Dinger eigentlich sind. Aber so ist es nunmal. Darüber hinaus, weil abgeleitet aus Konsens 1, sollte es eigentlich auch Konsens innerhalb der Motorradfahrerschaft sein, dass niemand einen anderen Motorradfahrer oder dessen Leidenschaft benutzt, um sein eigenes Ding durchzuziehen. Und eben deshalb darf und kann es auch nicht sein, dass sich jemand, der Konsens 2 verletzt, hinter Konsens 1 versteckt. Und um das jetzt zu erklären, ist es doch notwendig noch einmal einen etwas genaueren Blick auf das angesprochene Hipstergedöns zu werfen.
Das soziale Konstrukt, welches sich hinter der Bezeichnung „Hipster“ verbirgt, ist nicht singulär denkbar. Das ist ja nur logisch, denn sonst wäre es ja auch kein soziales Konstrukt, also ein Etwas, das sich erst innerhalb von sozialen Beziehungen definiert. Und der Hipster definiert sich nunmal innerhalb der Beziehungen seiner Personengruppe, der Hipsterpersonengruppe, zu zwei anderen Personengruppen, die es so eigentlich gar nicht gibt, wiewohl die Grenzen zwischen allen drei Personengruppen nicht trennscharf, sondern fliessend sind, die aber hier auch zum besseren Verständnis sozusagen idealtypisch, um nicht zu sagen holzschnittartig behandelt werden sollen. Der idealtypische Vertreter der ersten der zwei anderen Personengruppen ist der sogenannte „Enthusiast“, das ist ein Mensch, der nicht selten mit grosser Leidenschaft irgendetwas macht, herstellt oder ergründet, was eigentlich über Jahre und Jahrzehnte hinweg niemanden nicht nur nicht interessiert hat, sondern auch noch weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze der allermeisten seiner Zeitgenossen lag. Wenn der „Enthusiast“ in dieser seiner Zeit des entgegengebrachten allgemeinen Desinteresses, was ihn übrigens in der Regel herzlich wenig juckt, überhaupt wahrgenommen wird, dann nur als einer, der vielleicht irgendwie liebenswert oder schrullig ist, aber doch aufgrund seiner absonderlichen Obsession einen Dachschaden haben oder sonstwie plemplem sein muss. Dennoch braucht der Hipster den Enthusiasten, den man in seinen anderen Ausformungen auch „Nerd“ oder „Connaisseur“ nennen kann, dringend, und das aus den immer gleichen Gründen, er braucht ihn zum einen aufgrund seiner Ideen oder Kreativität, über die der durchschnittliche Hipster in der Regel eher nicht oder nicht im ausreichenden Masse verfügt, was eigentlich auch gar nicht schlimm ist, denn der gemeine Hipster hat ganz andere Aufgaben und Qualitäten, zu denen wir später noch kommen werden, und er braucht ihn zum anderen aufgrund der von ihm verkörperten Authentizität, denn dem Hipster ist ausserordentlich wichtig, dass etwas „authentisch“ oder irgendwie „echt“ ist, deshalb auch das ganze Vintage-Gedöns. Und um jetzt mal ein bisschen Fleisch an den dürren Knochen zu bringen, ist es an der Zeit einen idealtypischen Vertreter des Idealtypus „Enthusiast“ näher vorzustellen.
Ein idealtypischer Vertreter des Idealtypus „Enthusiast“ ist der kalifornische Tätowierer Don Ed Hardy, der zu einer Zeit als Tätowieren lediglich für Randgruppen am unteren Ende der gesellschaftlichen Skala wie Knackis, Matrosen oder Rocker interessant war, nicht nur davon träumte, sondern auch über Jahrzehnte beharrlich daran arbeitete, das Handwerk des Tätowierens als Kunstform zu etablieren, wozu er auch ausgedehnte Studien in Japan unternahm.

Don Ed Hardy bei der Arbeit. Und zwar im Jahre 1980, als man, was so die Hygiene beim Tätowieren angeht, noch etwas entspannter war...
Aufgrund seiner Beharrlichkeit und natürlich auch, weil er in Californien wohnte, denn Wohnorte wie Castrop-Rauxel oder Wladiwostok sind für derartige Karrieren nicht unbedingt förderlich, was jetzt weniger an Castrop-Rauxel oder Wladiwostok liegt, sondern mehr an der Vernageltet einiger Zeitgenossen, erfreute er sich langsam auch ausserhalb der Tattoo-Szene einiger Bekanntheit, die für eine andere Type interessant wurde, der beileibe kein Enthusiast war und auch kein durchschnittlicher Hipster, sondern eher so eine Art Oberhipster oder vielleicht ein Hipster-Hipster oder vielleicht auch nur das, wie ihn Don Ed Hardy höchstpersönlich charakterisierte, nämlich der „Nullpunkt von allem, was derzeit mit der Zivilisation schiefläuft“, was den guten Don aber nicht daran hinderte, mit eben diesem Christian Audigier eine Geschäftsverbindung einzugehen, die ihn zu einem sehr vermögenden Mann machen sollte. Denn Christian Audigier, gebürtiger Franzose, wenn auch nicht Südwest-Franzose, sondern eher so ne Art Südsüd-Franzose, wohnte inzwischen auch in Californien und nicht mehr in Avignion, weil nämlich Wohnorte wie Avignion für derartige Karrieren – genau – verdingte sich bei verschiedenen Mode-Labels, wurde bei einem Chef-Designer, hielt seine Nase in den Wind und befand vollkommen richtig, dass es mal wieder an der Zeit wäre, die modischen Symbole und Stilelemente der Unterschichtsemblematik, also der weissen Unterschicht der USA, auch „White Trash“ genannt, hervorzukramen, die von Zeit zu Zeit immer mal wieder hervorgekramt werden, wenn in der Modewelt eine Glam-Periode zu Ende geht, wie dieses Justin-Bieber-Dings, da sich trendige Männer zunehmend, naja – androgyn – kleideten und sich mit Gel, Schaum und/oder heisser Luft die halblangen Haare ins Gesicht schmierten, bis man den Scheiss nicht mehr sehen konnte, und deshalb mal wieder – joah – der kernige Typ gefragt war. Und Audigier setzte noch einen drauf, er begnügte sich nicht mit den üblichen Signalen und Symbolen, also den schweren Stiefeln, den karierten Hemden, den verratzten Sneaker, den Feinripp-Unterhemden, den prolligen Jeans, den nachlässigen T-Shirts, den Trucker-Caps, denn spätestens als er ein T-Shirt mit dem Druck einer Zeichnung Don Ed Hardys gesehen hatte, muss er wohl begriffen haben, dass nicht ohne Zutun Hardys die Tattoo-Kunst im Begriff war, sich immer mehr in der Alltagskultur zu etablieren. Es also nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis nach den ersten schüchternen Versuchen mit dem sogenannten Tribalmotiven, also dem Arschgeweih und ähnlichen Schnörkeln Ende der 1980er, die bei Bedarf noch durch Kleidung verdeckt werden konnten, Tätowierungen sich auch auf breiter Front und Haut durchsetzen würden. Und dass er das wusste, hat mit dem Exklusivdings zu tun, mit dem Audigier durch seine Zeit bei unterschiedlichen Modelabels gut vertraut war, diesem verheerenden Etwas, diesem Mahlstrom, der wenn er erstmal in eine von vielen möglichen Welten tritt und dann auch noch zündet, diese Welt zuverlässig und für immer verschlucken wird. Anfang der Nuller Jahre jedoch bestand bezüglich grossflächiger Tattoos auf der einen Seite, dem Vorbild angesagter Rock- und Rapstars folgend, ein Interesse gewisser trendaffiner Menschen, das aber andererseits bei vielen noch von einer grundlegenden Scheu überlagert wurde, sich diese Bildchen auch für alle Ewigkeit grossflächig in die Haut ritzen zu lassen. Und eben in diesen Zwiespalt stiess Audigier, indem er durch die Erfindung des „Tattoo-prêt-á-porter“ das Subkultursymbol Tattoo firlefanzisierte, es seiner ewigen Schwere beraubte und es so in den Symbolraum der „White Trash“-Mode, in dem ja sonst immer nur der gleiche Kram in unterschiedlichen Varianten tanzt, schmerzfrei integrieren konnte. Die Ideen und vor allem die wichtige Authentizität lieferte ihm der Enthusiast Hardy, er kümmerte sich ums Marketing, und auch hier kamen ihm seine Erfahrungen in der Modebranche zugute, denn Audigier wusste, dass beim Menschen leider fast nichts so zuverlässig gut funktioniert wie der Herdentrieb, wollte er also die Herde kriegen, musste er an deren Leittiere ran und genau hier – wodennsonst? – kommt jetzt – naklar! – der Hipster ins Spiel.

Christian Audigier. 2008 auf einer Party nach irgendeiner Mode-Messe. Auch ziemlich entspannt…
Denn wenn man das soziale Konstrukt „Hipster“ einmal von seinem ganzen Klimbim entkleidet, dann ist der Hipster im Kern eigentlich nichts anderes als ein sozialer Trüffelhund, und Audigier wollte natürlich die vielen Trüffel, die paar Hipster waren ihm nur Mittel zum Zweck oder das Vehikel, das ihn zu den Trüffeln führen sollte. Die Trüffel sind neben den Hipstern und den Enthusiasten deshalb die dritte und wichtigste Personengruppe, in deren gegenseitigem Beziehungsgeflecht sich das soziale Konstrukt „Hipster“ definiert. Trüffel ist in diesem Zusammenhang natürlich nicht – nein! – despektierlich gemeint, denn die Trüffel sind wir alle, der Typ, der diese Zeilen hier schrieb und ein jeder, der diese Zeilen liest, alle sind wir irgendwann und irgendwo Trüffel, weil wir uns einreden oder durch irgendwas oder irgendwen beeindrucken lassen, wir bräuchten irgendetwas, wir müssten irgendetwas kaufen, was wir eigentlich gar nicht brauchen, und was natürlich trotzdem vollkommen und komplett in Ordnung ist, weil das eben das Spiel ist, das wir (fast) alle spielen, dem (fast) keiner entkommt und über das wir (fast) alle eigentlich auch Bescheid wissen. Kann man die Beziehungen zwischen dem Enthusiasten und dem Hipster noch relativ einfach beschreiben, sind die Beziehungen zwischen den Hipstern und den Trüffeln schon sehr komplexer, um nicht zu schreiben: Tragischer Natur. Und dass das so ist, liegt nunmal in der Hauptsache und in allererster Linie an dem weltenverschluckenden, allvernichtenden, unaussprechlichen Exklusivdings.
II. Das weltenverschluckende, allvernichtende, unaussprechliche Exklusivdings (Waueds)
Als das ganze Motorradgedöns, so wie wir es heute kennen, Ende der 1960er Jahre und zwar hauptsächlich von Californien ausgehend, denn Mandello, Spandau, Meriden und selbst Milwaukee sind nunmal nicht die geeigneten Orte, um derlei Karrieren zu starten, seinen Anfang nahm, gab es ein bestimmtes technisches Detail an den Motorrädern dieser Jahre, das in den Folgejahren auffallend schnell und fast vollständig von dieser Welt verschwinden sollte, und das war der Kickstarter. Und das ist nicht nur auf den ersten Blick verwunderlich, war und ist doch der Kicker ein ziemlich magisches Teil, denn schon der Prozess des Ankickens als solches, der nur wenige Sekunden in Anspruch nahm, verriet bereits in dieser kurzen Zeitspanne, ob der Fahrer sein Material, das Motorrad, im Griff hatte oder nicht, ob er wusste, wie sein Motor „tickt“, ob es ausreichte vor dem Kicken lediglich den Choke zu betätigen oder ob es aufgrund geringer Aussentemperatur notwendig sein würde, den Motor zuvor ein-, zweimal ohne Zündung zu kicken, damit die Kolben schon mal ein wenig Gemisch ansaugen konnten, ob er wusste, wie er den Totpunkt der Kolben findet, die vor dem Kicken vielleicht ein klein wenig über den Totpunkt hinaus gedreht werden mussten, dass er verstand, den ganzen Weg des Kickpedals zu treten, denn je länger der Weg, je mehr Funken an den Kerzen, und desto grösser, die Chance, dass – Bäng! – das Gemisch zündete, und dass er verstanden hatte, den ganzen Weg des Pedals kraftvoll und zügig, aber nicht brachial oder gewalttätig zu treten, sondern wie in einem Fluss, wobei nach dem Prozess des Ankickens der Fuss am Ende des Weges kurz auf dem Kicker verweilen musste, um die Gefahr des Rückschlags zu minimieren, was letztendlich auch darüber Auskunft gab, ob die Zündung sauber eingestellt war. Der Kickstarter verlangte einen kurzen Moment der Andacht, der das Ritual des Startens eines Motorrads durchdeklinierte, das Betätigen der Zündung, die Prüfung des Leerlaufs, das Ziehen des Chokes, das Ausklappen des kleinen Fusshebels, das Suchen des Totpunkts, die Konfiguration des eigenen Körpers – Standbein, Trittbein, Hände am Lenker, Vorbereitung der Körper- und Motorradbalance auf die folgende Trittbewegung – Einatmen und dann los!, bevor im Erfolgsfall die biokinetische Energie des menschlichen Organismus‘ in die mechanische Energie eines Verbrennungsmotors überging. Der Kickstarter markierte so nicht nur die energetische Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, sondern war, da er mit Bedacht getreten werden musste, auch eine Klippe des Verständnisses, ein Moment der Prüfung über die intimen Details des zu startenden Motors. Und vielleicht war er auch gerade deshalb vielen ein Ärgernis und lag in diesem Ärgernis oder Unvermögen der Grund seines Verschwindens, als man nicht mehr Motorrad fahren musste, sondern Motorradfahren wollte, und die Hersteller ihre jetzt zum Lifestyle-Produkt gewordenen Erzeugnisse flugs mit einem Anlasser ausstatteten, um die Wollenden mit einem Komfort zu locken, den sie den Müssenden grösstenteils immer verweigert hatten. Am längsten hielten die englischen Hersteller am Kickstarter fest, „Kickstart only“ war in den späten 1960er und frühen 70er Jahren beinahe ein Alleinstellungsmerkmal der letzten verblieben Vertreter der ehemals glorreichen britischen Motorradindustrie, was insbesondere auch auf das Unverständnis der Motorradpresse stiess. Ernst Leverkus, prägender deutscher Motorradjournalist der 1950er, 60er und 70er Jahre, beschreibt diesbezüglich das Gespräch mit dem Cheftechniker eines englischen Herstellers, wahrscheinlich Triumph, das Mitte der 1960er Jahre stattgefunden haben soll:
„Wir sagten, ob es nicht langsam Zeit wäre, diesen grossen Maschinen Elektrostarter zu geben, um das Anlassen des starken Motors zu erleichtern. Schon im Hinblick auf den Komfortanspruch der amerikanischen Kunden und der japanischen Konkurrenz. „Nein, Sir“, war die Antwort. „Wir bauen Motorräder für Männer, die brauchen keinen teuren Elektrostarter“ (…) „Sir“, war die Antwort, und unser Gesprächspartner runzelte die Stirn, „wenn es keine harten Männer mehr für die Kickstarter gibt, dann gibt es auch unsere Maschinen nicht mehr.““
Nun sei dahingestellt, ob es tatsächlich die Sorge um die „harten Männer“ war, die die Engländer veranlasste, an ihrem Prinzip des „Kickstart only“ festzuhalten, bis es irgendwann zu spät war oder ob sie schon damals, wie es in der Anekdote Leverkus’ anklingt, einfach die damit verbundenen Kosten scheuten, die britische Motorradindustrie ging unter und mit ihr verschwanden nicht nur die Kickstarter an hubraumstarken Mehrzylindermaschinen, sondern auch ein ganz essentielles Stück Motorradkultur, das einen körperlichen Einsatz erforderte, welcher überflüssig wurde und in seinem Überfluss zudem ein Wissen vergass, das sich seitdem in einem kleinen popeligen Startknopf entfremdet.
Und so, wie man ein Motorrad ankickt, das ja letztendlich nichts anderes ist als ein Accessoire, so muss man auch erstmal eine ganze Maschinerie oder einen Marketing-Motor ankicken, um eben diese Accessoires auch zu verkaufen. Audigier hatte, nachdem Don Ed Hardy für 300.000 Dollar und einem prozentualen Anteil am Weltmarktumsatz einen Lizenzvertrag unterschrieben hatte, einen prima Motor am Start, eine Idee hart am Zeitgeist, die wie ein Motorkolben gut geölt im Zylinder sass und nur darauf wartete, mit immer schnellerem Tempo die Zylinderbahn hoch und runter zu flitzen, und damit einen Sog zu entfachen, der immer mehr Gemisch oder Trüffel und damit Geld in die Brennkammer saugen sollte. Das Problem war nur: Wie kommt so ein Motor in Gang? Audigier hatte einen Enthusiasten eingekauft, hatte T-Shirts mit Retro-Tattoo-Motiven bedruckt, hatte einen Laden angemietet und Mitarbeiter eingestellt – über ausreichend Mittel, um eine umfassende Marketingkampagne mit sämtlichem Pi-Pa-Po zu finanzieren, was eine ziemlich teure Angelegenheit sein kann, verfügte er jedoch nicht. Audigier vertraute darauf, dass dasselbe geschehen wird, was ihm schon in seiner Zeit als Chef-Designer von „Von Dutch“ zum Erfolg verholfen hatte, nämlich dass irgendjemand mit ausreichend „richtiger“ Strahlkraft seine Klamotten kaufen und trage möge, was dann dafür sorgen würde, dass sein Marketing erstens fast für umsonst und zweitens viral geht, weil nämlich von Menschen mit ausreichend „richtiger“ Stahlkraft seltsamerweise eine zutiefst toxische Ansteckungskraft ausgeht, gegen die die letzte Ebola-Epidemie ein trauriger Kindergeburtstag war. Und im Prinzip ist diese Idee ja nicht neu, da wahrscheinlich schon zu allen Zeiten prominente Menschen dafür eingekauft wurden, für irgendeinen Kram zu werben, neu war an dieser Idee, Menschen mit ausreichend „richtiger“ Stahlkraft nicht nur nicht dafür zu bezahlen, damit sie für Klamotten werben, die sie privat nie tragen würden, sondern ihr Bedürfnis, sich vom Mainstream abzusetzen und irgendwie „hip“ zu sein, zu benutzen, indem dieses Bedürfnis durch ein Produkt befriedigt würde und die öffentliche Bedürfnisbefriedigung in den Medien dann die erwünschte Werbewirkung für eben dieses Produkt entfalten sollte. Audigier hatte den Köder seit 2004 im Wasser, im Verlauf des Jahres 2005 bemerkte er gestiegenes Interesse, da er beobachteten konnte, wie der Schwimmer immer mal wieder und immer öfter unter die Wasseroberfläche gezupft wurde, bis er im Frühjahr 2006 von einer Sekunde auf die andere von der Oberfläche verschwand und sich so ein besonders dicker Fisch ankündigte, dessen graziler Fuss den Hebel des Kickstarters seiner Marketingmaschine ausklappte, den Leerlauf prüfte, den richtigen Kolbenstand fand, um den Motor gekonnt und routiniert mit nur einem Tritt zum Leben zu erwecken. Audigier beschreibt diesen Moment des grossen Fisches in seinen Memoiren folgendermassen:
„An dem Tag, an dem ich in einem Klatschmagazin ein Foto von Madonna entdeckte, auf dem sie ein Tiger-T-Shirt und eine Mütze mit dem Teufel und dem Dreizack trug, war mir klar, dass wir mit dem Wind segelten.“
Audigier war ganz aus dem Häuschen und räumte sogleich eine Wand in seinem Laden frei, da er offensichtlich Grund hatte, anzunehmen, dass diesem ersten Madonnenbild noch weitere folgen würden, die er alle gewillt war, an eben jene Wand zu pinnen. Und der Memoiren-erinnernde Audigier lässt seinen Ghostwriter den Audigier in den Memoiren vor Glück ganz berauscht an dieser Stelle seiner Erinnerungen ebenso rhetorisch wie scheinheilig fragen:
„Danke. Tausend Dank. Aber wieso trägst Du meine Klamotten?“
Eine nicht ganz unerhebliche Frage, die Madonna ein paar Seiten weiter in den Memoiren auch beantworten darf, wo der Ghostwriter sie auf Geheiss von Audigier sagen lässt, dass sie jeden Tag dutzende Pakete mit Kleidern der ganz grossen Marken erhalte, aber sie bewundere natürlich, ja, liebe nunmal seine Klamotten. Was er in diesem Zusammenhang ein wenig – nun ja – unter den Tisch fallen lässt, ist der nicht ganz unerhebliche Umstand, dass er Madonna zwar nicht bezahlt hat, damit sie seine Klamotten trägt, aber sehr wohl die Paparazzi der Klatschmagazine, die in seinem Auftrag nach angesagten Prominenten fahndeten, die seine Klamotten trugen, um sie am besten bereits beim Verlassen des Ladens in diesen Klamotten zu fotografieren und auch dafür Sorge zu tragen, dass diese Fotos in irgendwelchen Klatschmagazinen oder Fashion-Blogs publiziert würden. Und weil er diese Marketing-Nummer des „Celebrity-Wear“, die nunmal am besten im – genau – celebrityverseuchten Californien funktioniert, nicht zum ersten Mal, sondern auch schon ein paar Jahre zuvor für Von Dutch mit Britney Spears exakt baugleich durchzogen hatte, dürfte diese Masche Madonna, die ja beileibe keine Anfängerin im Celebrity-Business ist, wohlbekannt gewesen sein, weshalb es auch nicht so wahnsinnig weit hergeholt ist, dass sie sich nicht ganz unfreiwillig vor seinen Karren hat spannen lassen – und zwar sicherlich nicht, um noch mehr mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, davon dürfte sie mehr als genug gehabt haben – aber vielleicht dennoch nicht aus uneitlen Motiven, denn die Eitelkeit wurzelt bei solchen Mega-Stars, die sich zudem als Überhipster begreifen, nunmal so absonderlich tief wie sich unsereins – vielleicht mal abgesehen von Christian Audigier – das überhaupt nicht vorstellen kann, sodass die Gründe für ihre plötzliche und sehr intensive Ed-Hardy-Leidenschaft vielleicht genau und gerade in ihrem Verhältnis zu Britney Spears zu suchen sind, die anfangs der Nuller Jahre, da sie Audigiers dämliche Von Dutch-Truckerkappen quasi im Vorbeigehen unfreiwillig zum Kult promotete, als der kommende weibliche Superstar am Popfirmament galt, von dem nicht Wenige im Celebrity-Business erwarteten, dass sie, jung, schön, blond, unverbraucht und trällernd wie sie war, die alternde Königin des Pops endlich vom Thron schubsen würde, weshalb Madonna, die bei der Von Dutch-Trucker-Kappen-Geschichte zu spät in die Puschen kam und deshalb erst nach Spears über die Ziellinie ging, diesmal fest entschlossen war – ja, so banal kann Weltgeschichte manchmal sein – sich die Butter nicht vom Celebrity-Bread nehmen zu lassen und sich und der Welt zu beweisen, dass sie, Madonna, die Stilikone der 1980er Jahre, es in Sachen Stil und Hippness immer noch mit jedem und jeder auf diesem Planeten aufnehmen konnte und vor allem, und das war das Wichtigste, auch immer noch die Strahlkraft besass, um selbst so einen Käse wie Ed Hardy sozusagen im Alleingang zu DER angesagtesten Marke überhaupt zu machen.
Also legte sie sich mächtig ins Zeug und die Paparazziknipsen brannten in den Folgemonaten ein Madonnenbildchen nach dem anderen auf die Sensorchips: Madonna im Ed Hardy-Top, Madonna im Ed Hardy-T-Shirt, Madonna im Ed Hardy-Jogginganzug, Madonna mit Ed Hardy-Mütze, Madonna im Ed Hardy-Sweatshirt. Audigier hatte die erste Wand bald voll und räumte die zweite frei: Madonna mit Ed Hardy-Totenkopf, Madonna mit Ed Hardy-Tiger, Madonna mit Ed Hardy-Totenkopf mit Rosen, Madonna mit Ed Hardy-Piratenkopf ohne Rosen, Madonna mit Ed Hardy-Totenkopf mit Herz. Audigier stellte verblüfft fest, dass der Star offensichtlich im Besitz seiner gesamten Kollektion war und räumte, nachdem die zweite Wand auch schon voll gepinnt war, die dritte frei: Madonna in Ed Hardy-Klamotten in London, in Los Angeles, beim Einsteigen ins Auto, beim Aussteigen aus dem Auto, in Paris, beim Shoppen, mit ihrer leiblichen Tochter in Ed Hardy-Klamotten, mit ihren Adoptivkindern in Ed Hardy-Klamotten, in Malawi, mit ihrem damaligen Ehemann mit Ed Hardy-Kappe. Don Ed Hardy bemerkt in seinen – genau – Memoiren, dass Audigier zwischenzeitlich über 70 Madonnenbildchen an seine drei Wände gepinnt hatte. Ja, und das nennt man wohl nicht ohne Grund das volle Programm, welches seine Wirkung auch nicht verfehlen sollte, da es tatsächlich für einige ihrer Zeitgenossen von toxischer Wichtigkeit war, was Madonna so den ganzen Tag über macht und was für Klamotten sie dabei trägt. Ed Hardy wurde ziemlich heisser Hipsterkram, immer mehr Stars oder Menschen, die sich dafür halten wie beispielsweise Heidi Klum, zogen nach, die Begehrlichkeiten nach Ed Hardy-Klamotten wuchsen mit jedem weiteren Paparazzifoto und wurden noch immens dadurch gesteigert, dass diese Klamotten anfangs nur sehr begrenzt verfügbar waren, da die Zahl der Verkaufsstellen mit der steigenden Begierde nach der Ware noch nicht mithalten konnten – JAMANMUSSSICHDASMALVORSTELLEN! – da gingen die Paparazzibildchen quasi in Echtzeit dank Internet um die Welt und dann gab es den Kram gerade mal in Californien zu kaufen und der Rest der Welt ging leer aus!! KANNDOCHNICHTWAHRSEIN!!! Und genau in diesem Moment, da Audigiers Marketing-Motor schön rund lief, die Ed Hardy-Kolben gut geölt die Zylinderbahnen hoch und runter flitzten und so immer mehr Stars ansaugten, welche dafür sorgten, dass die Kolben noch schneller die Zylinderbahnen hoch und runter flitzten und dadurch immer mehr Sternchen ansaugten, welche dafür sorgten, dass die Kolben noch schneller die Zylinderbahnen hoch und runter flitzten, um auch noch die „gewöhnlichen“ Hipster anzusaugen, die zunächst gar nicht alle bedient werden konnten, kam wohl das weltenverschluckende, allvernichtende, unaussprechliche Exklusivdings oder wie Kenner und Experten – und wenn, dann immer nur mit gedämpfter Stimme – es nennen: das „Wauds“ das erste Mal in dieser leidigen Angelegenheit ins Spiel. Und es stimmt schon, was den kleinen Kindern immer erzählt wird, dass es das Wauds eigentlich gar nicht gäbe und dass es deshalb auch gar nicht wahr sein könne, was man sich über es erzählt, dass es ein turmgrosses haariges Monster sei mit mindestens zwölf türkisgrünen Augen und einem garagengrossen Maul voller furchterregend spitzer Zähne, das in einer Höhle in einem unzugänglichen Gebirge wohnen würde, wo es bewacht von neun Schwarzalben und neun Lichtalben immerzu schläft und schläft und schläft, und nur geweckt werden könne von einem Menschen, der verrückt oder tapfer genug oder beides ist, sein Glück zu versuchen, ob es ihm denn gelänge, dem Wauds unbemerkt ein Haar auszurupfen und zwar ohne es zu wecken, auf dass es, das Haar, ihm Wohlstand und Reichtum bescheren möge, aber wenn er das Wauds durch das Ausrupfen eines seiner Haare wecke, die Rache des weltenverschluckenden, allvernichtenden, unaussprechlichen Exklusivdings vernichtend sein würde, da es überhaupt nur zwei Gemütszustände kenne, die gegensätzlicher gar nicht sein können, und diese seien der traumschwere Schlaf und die weltenverschluckende, allvernichtende, unaussprechliche Wut. Aber wir Erwachsenen wissen es natürlich besser, wir wissen, dass wir den kleinen Kindern wie immer nur Mist erzählen, denn wir wissen, dass es das Wauds sehr wohl gibt, dass es real ist, wenn auch schwer zu fassen, weil es natürlich nicht in einer albernen Höhle wohnt, sondern hinter den Stirnen der Menschen, wo es geboren wird im elektrischen Knistern einer Konfiguration von Nervenzellen, die uns glauben macht, eine Sache oder eine Ware habe einen Wert über sich selbst hinaus, die sich nicht in ihrer sachlichen Wertigkeit bemisst, sondern allein in dem Wissen einiger anderer Eingeweihter, die auch irgendwie zu wissen glauben, diese Sache oder Ware habe einen Wert über die sachliche Wertigkeit hinaus, und diese bestehe eigentlich und genau besehen darin, dass viele andere das eben nicht wissen oder NOCH nicht wissen, es aber irgendwie ahnen, dass die Hipster mal wieder irgendwas am Laufen haben, dass es mal wieder eine Grenze gibt, die aus trendaffinen Menschen oder solchen, die sich dafür halten wie Heidi Klum, Hipster oder Trüffel macht, je nachdem, auf welcher Seite dieser Grenze sie stehen. Und diese Grenze der Exklusivität oder genauer: Der Hipster-Exklusivität ist immer eine Grenze, die durch die Information geschrieben wird und eben nicht durch die Macht des Geldes. Jeder Mensch weiss, dass Rolls Royce, Ferrari, Rolex, Louis Vuitton oder 50-Meter-Yachten ziemlich exklusives, weil sehr teures Zeug sind, und eben gerade weil das so ist, sind sie in Hipster-Augen auch ziemlich prolliges Zeug, da diese Art der Exklusivität nicht verfeinert wird durch ein vermeintliches und irgendwie verschwurbelt undergroundsophisticatetes Wissen darum. Jeder Idiot kann sich so einen Kram kaufen, wenn er nur über genügend Kohle verfügt, weil das Wissen um diese Art der Exklusivität auch jedem Deppen verfügbar ist. Aber nicht jeder weiss (NOCH nicht!) um diese sehr spezielle Hipster-Exklusivität, die den Hipster – so ganz nebenbei – als jawaswohl? – Enthusiasten ausweist, nämlich als einen, der sich nen Kopf gemacht hat, der wusste, dass dieses prêt-á-porter-Zeugs einfach KOMMEN MUSSTE, weil sich der Don ja auch sonen Kopf gemacht hat, der hat studiert und war sogar in Japan, um bei sonem japanischen Tattoogrossmeister zu lernen und hat auch mit dem Horiyoshi n Buch rausgebracht, das‘ jetzt Kunst, weissde, Digger? Und dass das so ist, hat viel mit dem Grundirrtum der Hipster-Trüffel-Tragik zu tun, welche sich bei beiden in deren Selbstverständnis manifestiert. Während der Enthusiast sich nunmal in sein Leidenschaft verrannt hat und alte japanische Tattootechniken studiert oder fast ausgestorbene Weinreben wieder kultiviert oder alte, nicht mehr erhältliche Motorradersatzteile weltweit aufspürt, um sie neu nachfertigen zu lassen oder sonst irgendwas veranstaltet, was wirklich kein Mensch dieser weiten Welt braucht oder vermisst hat oder jemals vermissen würde, begreift sich der Enthusiast nicht als Experte, er begreift sich, wenn er denn überhaupt irgendwas begreift, vielmehr als einen, der das leidenschaftlich macht, was er machen muss, aus welchen Gründen auch immer. Zum Experten wird der Enthusiast erst in den Augen des Hipsters, wenn der Gegenstand der Leidenschaft des Enthusiasten für ihn aus Gründen der Hipster-Exklusivität interessant wird. Und natürlich begreift sich der Hipster auch nicht als Hipster – neeiIINnn – denn das würde ja bedeuten, dass er ein Leben vor seiner Existenz als Hipster gehabt hätte, dass er somit auf einen bereits bestehenden Trend aufgesprungen wäre, dass er womöglich davor – igitt – ein Trüffel gewesen ist, und genau deshalb ist der Hipster niemals Hipster, sondern schon immer ganz vorne mit dabei gewesen, kann der doch nix für, dass Vollbärte und karierte Flanellhemden, so wie er sie trägt, auf einmal Trend geworden sind, und spätestens, wenn er endlich ein Ed Hardy-Shirt auf Ebay USA ergattern konnte oder den Chateau Bio-Blabla nach zwölfstündigem Karaffieren genussvoll zu sich nimmt oder es endlich geschafft hat, den Vergaser an seinem alten Motorrad einigermassen richtig einzustellen, begreift sich der Hipster selbstredend als – nawaswohl? – Experten und zwar als den einzig wahren, versteht sich. Und das Erstaunliche ist, dass ihm die Trüffel das auch noch abnehmen, was jetzt auch wieder mit dem Grundirrtum der Hipster-Trüffel-Tragik zu tun hat, denn der Trüffel begreift sich einerseits ausdrücklich nicht als Trüffel, andererseits steht er aber ebenso wie der Hipster im Zwiespalt des Wollens und Müssens, denn gerade weil er nicht mehr Motorradfahren muss oder gerade, weil ihm niemand mehr vorschreibt, wie er sich anzuziehen oder welche Accessoires er zu kaufen hat, wird das Wollen zu einem Muss, denn die vermeintlich freie Wahl des Motorrades, des T-Shirts oder jedes anderen Accessoires legt die seiner Wahl zugrundeliegende Motivation bloss. Und selbst wenn er so originell sein sollte, nur Ausdrücken zu wollen, dass er sich gar nicht Ausdrücken will, entkommt er dieser Kommunikationsfalle einer modernen Konsumgesellschaft nicht: Er muss sich immer Ausdrücken, weil selbst das sich nicht Ausdrücken-Wollen, erst einmal ausgedrückt sein muss. Und weil diese Angelegenheit, die permanente Beantwortung der Frage, was man jetzt eigentlich Wollen muss, auf Dauer ziemlich anstrengend sein kann, sind nicht wenige Trüffel froh darüber, dass sich andere, nämlich die – genau – Hipster einen Kopf machen und die Frage des was man Wollen muss verbindlich, wenn auch nicht ganz freiwillig, auch für die Trüffel mitbeantworten. Und spätestens wenn der Trüffel in irgendeinem Kaufhaus irgendein T-Shirt mit irgendeinem tattooähnlichen Motiv ergattern konnte oder irgendeine Flasche Rioja ihm in der Kaufhausweinabteilung vom Kaufhausweinfachverkäufer für 39 fuffzich wärmstens an Herz gelegt worden ist oder er nur erwägt, sich im nächsten Frühjahr vielleicht irgendeines dieser modernen Retromotorräder zu kaufen, begreift sich der Trüffel selbstredend als – nawaswohl? – Hipster und zwar als den hippsten überhaupt, versteht sich. Tja, und dieser Grundirrtum der Hipster-Trüffel-Tragik, die Verwechslung oder Verschiebung der Identitäten, gebiert nun einmal, wie könnte es anders sein, auch verwirrend tragische Folgen, von denen deren zwei hier bald näher betrachtet werden müssen, und das ist zum einen die Verflachung des Wissens über das Objekt der Hipster-Exklusivität, die einhergeht mit dem, was man auch als die Verkehrung des Objekts jenes Wissens bezeichnen könnte, und zum anderen die besondere wegen dem weltenverschluckenden, allvernichtenden, unaussprechlichen Exklusivdings – wasdennsonst?
III. Die Verflachung des Wissens über das Objekt der Hipster-Exklusivität, die einhergeht mit dem, was man auch als die Verkehrung des Objekts jenes Wissens bezeichnen könnte
Die Verflachung des Wissens über das Objekt der Hipster-Exklusivität lässt sich nicht vermeiden, denn sie ist immanent angelegt in der Beziehung zwischen Experte, Hipster und den Trüffeln, und entwickelt sich deshalb zwangsläufig. Da kann man echt nix machen. Angenommen, der Experte kauft sich ein altes Motorrad, vielleicht sogar ein englisches, also eins von den Dingern, die aus bestimmten Gründen als schwierig gelten, da ihre Motoren stark vibrieren und somit das ganze Motorrad durchschütteln und man ihnen nachsagt, sie litten unter hartnäckiger Öl-Inkontinenz, dann wird der Experte zunächst einmal eine gründliche Bestandsaufnahme des gekauften Motorrades machen und dabei unter Umständen feststellen, dass dieses Motorrad ein besonderes Motorrad ist, weil es beispielsweise einst in einer eher seltenen Modellvariante ausgeliefert wurde, was man dem verratzten Gefährt, das nun vor ihm steht, und an dem sich im Laufe der letzten 40 bis 60 Jahre mehrere Generationen von Bastlern ausprobiert haben, leider nicht mehr ansieht, da mehrere Teile oder Merkmale, die es bei Auslieferung noch besass in den letzten Jahrzehnten verlorengegangen oder durch Fremdteile anderer Motorräder ersetzt worden sind, was, wie der Experte natürlich weiss, bei so alten Motorrädern eher die Regel als die Ausnahme ist. Und diese Erkenntnis zusammen mit dem niederschmetternden Befund der technischen Bestandsaufnahme erfüllt den Experten zum einen mit grosser Freude, denn besondere Motorräder sind selten, und zum anderen aber auch mit Schrecken, denn er weiss auch, dass er nun am Beginn einer Zeit voller Opfer, Entbehrungen und Leiden steht, da seine Leidenschaft für alte Motorräder ein blosses altes Motorrad noch eine gewisse Zeit lang hätte tolerieren können und ihm, dem Experten, somit auch zugestanden hätte, das blosse alte Motorrad zunächst einmal nur technisch standhaft zu machen, um es dann über die Monate oder Jahre mit Vernunft und Augenmass immer weiter zu verbessern und zu restaurieren. Ein besonderes Motorrad jedoch vermag seiner Leidenschaft diese Duldsamkeit nicht aufzwingen, ein besonderes Motorrad entzündet seine Leidenschaft sofort und lichterloh, vielleicht weil er der Meinung ist, dass dieses alte und besondere Motorrad auf wundersame Weise sich ihn ausgesucht hätte und nicht umgekehrt, und dass er somit auch auf wundersame Weise den Auftrag empfangen habe, diesem alten und besonderen Motorrad seine Würde zurückzugeben, was immer er auch darunter versteht. Vielleicht aber auch, weil er der Meinung ist, dass die Welt dieses Motorrad unbedingt braucht, weil sie eben durch dieses alte Motorrad, so es denn endlich instandgesetzt und wieder etwas besonderes ist, ein viel schönerer Ort wird. Vielleicht aber auch nur, weil er nunmal ein kompletter Idiot ist, der nicht verstehen kann oder will, dass das einzige, was dieses in seinen Augen besondere alte Motorrad von einem blossen alten Motorrad unterscheidet, nichts anderes ist als eine Rahmennummer oder ein besonders hässlicher Auspuff, der zu der Zeit, als das Motorrad neu war und erstmals zum Verkauf stand, schon von vielen als hässlich empfunden wurde, weshalb sich das neue „besondere“ Motorrad damals nur schleppend verkaufen liess, und wenn es doch einmal mit kräftigem Preisnachlass verkauft werden konnte, der Käufer sofort den besonders hässlichen Auspuff abmontierte, um ihn durch einen anderen zu ersetzen, wodurch das vermeintlich besondere Motorrad nicht nur so aussah wie sein Schwestermodell, das blosse neue Motorrad, sondern auch noch bis in die letzte Schraube technisch identisch mit ihm war, weshalb die Herstellerfirma aufgrund des ausbleibenden Erfolgs die Produktion des hässlich besonderen Motorrads bereits nach nur einem Jahr wieder einstellte, wodurch das hässliche Motorrad aufgrund der produzierten geringen Stückzahl in den Augen bestimmter Zeitgenossen, wie denen des Experten, irgendwann zu einem besonderen alten Motorrad wurde.
Letztendlich ist es aber auch egal, warum der Experte das macht, was er machen muss, nach Entdeckung der Besonderheit des Motorrades, welche ihm durch seine Rahmennummer (Matching Numbers!) verraten wurde, befindet sich der Experte fortan, weil keiner vernünftigen Argumentation mehr zugänglich, auf einer Mission, getrieben von seiner Leidenschaft wird er nicht eher ruhen, bis das besondere alte Motorrad in seiner ursprünglichen Vollständigkeit wiederhergestellt ist, hierzu wird er bereitwillig alle möglichen Opfer, Entbehrungen und Leiden auf sich nehmen, er wird nächtelang aufbleiben, um bei irgendwelchen Übersee-Internet-Auktionen im entscheidenden Moment doch nicht den Zuschlag für das ersehnte „originale“ Ersatzteil zu bekommen, auch wenn er mit seinem Gebot finanziell bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus gegangen ist. Er wird wochenlang über Ersatzteilkatalogen und zeitgenössischen Fotos seines Schatzes brüten, bis er jede, wirklich jede zwölfstellige Ersatzteilnummer und jeden Farbcode auf Geheiss sofort und ohne auch nur eine Sekunde Nachdenken wie im Delirium herunterzubeten vermag. Er wird monatelang mindestens jeden zweiten Tag bei dem Motorenbauer anrufen, um nachzufragen, wie lange dieser noch für die Überarbeitung der Zylinderköpfe braucht, um spätestens nach 12 Monaten nur noch mit irrem Blick hysterisch in die Telefonmuschel zu kichern, wenn er zum xten Mal vernimmt, dass der Motorenbauer seiner Wahl, ein Zauberer in seinem Metier, leider, leider noch nicht dazu gekommen ist – vielleicht aber nächste Woche, mal sehen… Er wird klaglos hinnehmen, dass seine Freunde sich von ihm abwenden, da sie ihn für offensichtlich geisteskrank halten, dass sein Hausarzt ihn in die Psychiatrie einweisen will, dass seine Ehefrau nicht nur mit der Scheidung droht und seine Kinder vor Gericht seine Entmündigung beantragen, nur um eines sehr fernen Tages schweissnass und mit entgleisten Gesichtszügen leise wimmernd vor einem abgrundtief hässlichen und endlich fertiggestellten Motorrad ermattet auf die Knie zu sinken, dessen letztes Fehlteil, der hässliche Auspuff, er persönlich auf einem Schrottplatz nahe Quebec, Kanada, aus einem Haufen Gerümpel ziehen musste, da mangels Nachfrage keine Firma der ansonsten florierenden Zubehörindustrie sich jemals die Mühe gemacht hat, ihn nachzufertigen.
Angenommen, ein Hipster kauft sich ein altes Motorrad, vielleicht sogar ein englisches, also eins von den Dingern, die aus bestimmten Gründen als schwierig gelten, da ihre Motoren stark vibrieren und somit das ganze Motorrad durchschütteln oder man ihnen ausserdem nachsagt, sie litten unter hartnäckiger Öl-Inkontinenz, dann hat der Hipster genau zwei Optionen, wie er mit diesem alten Motorrad weiter verfahren muss und zwar, Option Nummer eins: Er lässt alles so wie es ist, und restauriert das Motorrad nicht, da er nämlich unbedingt vermeiden muss, dass das verratzte Motorrad, das vor ihm steht, und dessen Geschichte ihn zumeist nicht die Bohne interessiert, irgendwann so aussieht wie eines der überrestaurierten Dinger der Opis bei den Veteranentreffen, weil Opis und Veteranentreffen und damit auch überrestaurierte Motorräder in seinen Kreisen nämlich als ziemlich uncool gelten, und es sich bei diesen Opis ausserdem zumeist um echte Experten handelt, in deren Gesellschaft der verkappte Experte Hipster aber in Nullkommanix auffliegen würde, weshalb es allemal besser ist, die Kreise der Opis zu meiden. Ausserdem verströmt so ein richtig verratztes Motorrad auch so eine ziemlich lässige Note, was der Hipster natürlich weiss und für sich zu nutzen versteht, denn so ein gebraucht aussehendes Motorrad weist den Hipster als sogenannten Daily Rider aus, also als einen, der mit und auf dem alten Motorrad lebt, es tagtäglich und bei fast jedem Wetter bewegt- versteht sich! – und es natürlich nicht nur bei Sonnenschein und mindestens 25 Grad Celsius Aussentemperatur publikumswirksam zur nächsten angesagten Gelateria Artigianale oder Burger Manufaktur oder Bar and Lounge pilotiert wie irgendwelche erbärmliche Hipsterspacken. Und eben um diese Lässigkeit noch zu unterstreichen, hat sich der Hipster ja auch ein altes englisches Motorrad gekauft, also eines von diesen Dingern, die aus bestimmten Gründen als schwierig gelten, da ihre Motoren – achgottchen! – so stark vibrieren und somit – herrjeh! – das ganze Motorrad durchschütteln und man ihnen ausserdem nachsagt – kanndochnichwahrsein! – sie litten unter hartnäckiger Öl-Inkontinenz, weil nämlich so schwierige Motorräder nur von echten Experten geschraubt und bewegt werden können. Und damit das auch wirklich jeder begreift, sorgt der Hipster dafür, dass sein vermeintlich schwieriges Motorrad hin und wieder mal einen Tropfen Öl fallen lässt, auch wenn es das gar nicht müsste, weil es sich somit als echt schwieriges Material ausweist, das er, der einzig wahre Experte, aber vollkommen im Griff hat, weshalb er auch seinen Hipsterfreunden, mit denen er sich im Kiezcafe versammelt hat, und die sich bei entsprechender Nachfrage wohl nicht erinnern könnten, ihn jemals bei anderen klimatischen Bedingungen als bei Sonnenschein und mindestens 25 Grad Celsius Aussentemperatur auf anderen Strecken als zwischen seinem Zuhause und irgendwelchen Szenetreffs auf seinem verrratzten Motorrad gesehen zu haben, fachmännisch und oberlässig steckt, während sie ehrfürchtig von ihren hausgemachten Cold Brews und biologisch korrekten Möhrchenkuchen aufschauen, dass so lange unten aus seinem Motorrad Öl raus tropfe, oben im Motor immer noch welches drinne sein müsse.
Die zweite und letzte Option, die sich dem Hipster eröffnet, wenn er sich ein altes Motorrad kauft, ähnelt zumindest vordergründig, wie könnte das auch anders sein, der Vorgehensweise des Experten, wenn dieser sich ein altes Motorrad kauft, und das wiederum aus dreierlei Gründen: Weil nämlich der Hipster erstens und selbstredend der einzig wahre Experte ist, weil der Hipster zweitens im allgemeinen ein starkes Faible für craftsmanship, also Handwerkskunst hat, deshalb auch das ganze Authentizitätsgeschwurbel, und weil der Hipster drittens all das, was er veranstaltet, immer nur veranstaltet, um sich von den – igitt – Trüffeln zu unterscheiden, also eigentlich um seine total nonkonformistische Einzigartigkeit unter Beweis zu stellen. Und aus diesen Gründen beschliesst der Hipster, der sich ein altes Motorrad gekauft hat und im Folgenden als Verfahrensweise die zweite Option wählt, sich aus eben diesem alten Motorrad eigenhändig ein total nonkonformistisches Motorrad zu bauen, so wie es sonst keiner ausser ihm auf der ganzen weiten Welt besitzt. Aber anders als beim Experten, der ein privates, fast schon intimes Verhältnis zu dem Objekt seiner Begierde pflegt, lässt der Hipster, der beschlossen hat, sich ein total nonkonformistisches Motorrad zu bauen, die ganze weite Welt von Anfang an an seinem Vorhaben teilhaben, indem er sie minütlich über Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter oder gar sein eigenes Blog über den Fortgang seines Projektes informiert. Und so dürfen dann all seine Follower, Facebook-Buddies und sonstige Interessierten in Echtzeit eine Flut von Textnachrichten und Fotos zu Kenntnis nehmen, in denen der Hipster über die Authentizität der alten Motorräder schwadroniert, die im Gegensatz zu den Plastikmoppeds heutiger Zeit verdammtnochmal vergaserbefeuert sind, deren Motoren nicht nur deshalb noch eine Seele hätten, der man spätestens dann teilhaftig werde, wenn der Motor nach fuffzich Kilometern Warmlaufphase so rischtisch locker am Gas hängen würde, ein Erlebnis, das man mit allen Sinnen geniessen müsse, und es darum manchmal nötig wäre, ungewöhnliche Wege zu gehen, um dieses Erlebnis noch authentischer zu machen, weshalb er, der Hipster, gerade darüber nachdenke, an seinen ollen Boxer-Zweiventiler zwei Keihin-Vergaser dranzuhängen undsoweiterundsofort. Und derlei Weisheiten garniert der Hipster natürlich mit Fotos, die alle immer so voll aus dem Leben gegriffen sind, die alle immer so zufällig aufgenommen aussehen, wenn sie den Hipster zeigen, wie er sinnierend, als sei er völlig allein in seiner Garage, vor einem alten kaputten Motorrad steht, wie er den Keihin-Vergaser selbstvergessen auf seine Funktion prüft, wie er sich an der Werkbank total konzentriert mit öltropfenden Händen durch die Haare streicht, während er am offenen Motor hantiert oder – und natürlich darf diese Ikone der Hipster-Ich-bau-mir-jetzt-ein-total-nonkonformistisches-Motorrad-Fotographie nicht fehlen – wenn er mit der Flex den Heckrahmen seines alten Motorrads kürzt. Und wer sich jetzt schon immer gefragt hat, warum eigentlich die Hipster partout die Hecks ihrer alten Motorräder kürzen müssen, ein Phänomen, welches mittlerweile schon solch pandemische Auswüchse angenommen hat, dass die florierende Zubehörindustrie bereits dazu übergegangen ist, gekürzte Heckrahmen von der Stange zum Dranschrauben zu produzieren: Ob das vielleicht seinem Motorrad eine sportiv elegante Note verleihen soll oder ob der Hipster damit listig verhindern will, seine Freundin oder Ehefrau auf seinem Motorrad mitnehmen zu müssen, oder ob er damit vielleicht zum Ausdruck bringen möchte, dass er, wenn er überhaupt einmal mit seinem alten Motorrad verreist, mit total wenig Gepäck auszukommen gedenkt, dem sei gesagt, dass das massenhafte Malträtieren von Motorradrahmen durch den Hipster immer nur zwei Gründe hat, die eigentlich der ein und derselbe sind, zum einen nämlich der entschiedene Hinweis auf seine fortgeschrittenen Craftsmanship-Fähigkeiten, denn der Rahmen muss nicht nur gekürzt, sondern danach auch wieder irgendwie zusammengeschweisst werden, und Schweissen ist nunmal oberlässig, als auch die Romantisierung des Craftsmanship-Gedankens, dessen Ausdruck das immer gleiche Foto ist, das den Hipster höchstselbst beim virilen Akt des Kürzens zeigt, da die Funken hübsch pittoresk fliegen und somit den entschlossenen Gesichtsausdruck des mannhaft flexenden Hipsters, der im Begriff steht, sich das Material craftsmanshipmässig zu unterwerfen, unter seiner Schutzbrille so schön heroisch ausleuchten. Und eigentlich hätte der Hipster, während er beharrlich sein Projekt verfolgt und seine Follower, Facebook-Buddies und sonstige Interessenten mit Neuigkeiten füttert, welche natürlich fast ausschliesslich aus Hipstern bestehen, die zeitgleich ein total nonkonformistisches Motorrad zusammenbauen und deshalb auch in Echtzeit alle Welt via Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter oder gar ihre eigenen Blogs über den Fortgang ihres Projektes auf dem Laufenden halten, mannigfaltige Gelegenheit für noch weitere prall aus dem Leben eines motorradzusammenbauenden Hipsters gegriffene Fotos, aber seltsamerweise finden diese Gelegenheiten niemals ihren Weg auf die Sensorchips der Smartphones und somit auch nicht in die sozialen Netzwerke wie zum Beispiel Bilder von den zwei Feuerwehreinsätzen, die notwendig wurden, weil der Hipster bei seiner mannhaften Flexerei leider das Benzin entzündete, das er aus dem Tank des alten Motorrades in einen Eimer geleert hatte, um das rostbefallene Tankinnere mit Hokuspokus-Rostumwandler behandeln zu können, oder als er den alten Kabelbaum, den er sorgsam aus dem Scheinwerfer und dem Rahmen des alten Motorrades heraus gefriemelt hatte, wobei er alle Stecker und Kontakte mit gelben „Post its“ versah, auf die er wahlweise „rechter Blinker“, „linker Blinker“, „Fussbremslichtschalter“, „Hupe“, „Batterie“, „Weissnichtmehr“ undsoweiter krakelte, nach Wiederverlegung das erste Mal auf seine Funktion prüfte. Aber eins muss man ihm lassen, dem Hipster, er bringt sein Projekt trotz aller Widrigkeiten zu Ende, auch wenn es dazu notwendig sein sollte, entnervt in dunkler Nacht ein halb verkohltes altes Motorrad in den Miettransporter zu schieben, um es zu einer professionellen und verschwiegenen Motorradwerkstatt weit vor den Toren von Hipster-City zu bringen, die sein Projekt nach seinen Angaben und zu horrenden Preisen fertigstellen wird. Dass er sein Projekt zu Ende bringt, hat aber anders wie beim Experten weniger mit der in ihm lodernden Leidenschaft zu tun als vielmehr mit dem sozialen Druck, unter den sich der Hipster mit seinen permanenten Verlautbarungen und Foto-Postings in den sozialen Netzwerken selbst gesetzt hat. Er muss dieses Motorrad fertig bauen, will er nicht zeitlebens der Mopps in seinem Kiez sein, denn da helfen dann auch keine karierten Flanellhemden und keine Vollbärte mehr. Und so dämmert dann irgendwann der Tag, an dem der Hipster in seine Pferdeleder-Motorradjacke schlüpft, den Jethelm aufsetzt, die Skibrille darunter feinjustiert, das raw-denim-bekleidete rechte Bein über den Sattel seines schicken Zweiventiler-Boxers schwingt, mit dem linken Fuss im Red Wing vor dem Starten den Leerlauf sucht, um auf seiner Maschine mit kurzer Echt-Antikleder-Sitzbank, freiem Rahmendreieck, pastellfarbenem Tank und „Built not Bought“-Aufkleber auf dem hinteren Schutzblech die 500 Meter bis zum nächsten Hipster-Motorradtreff seines Viertels zu rumpeln, wo er seine Maschine neben den anderen Maschinen parkt, mit den Kumpels n bisschen Benzin quatscht und das eine oder andere Schrauber-Anekdötchen teilt, um dann später, wenn es an die Heimfahrt geht, feststellen zu müssen, dass er sein total nonkonformistisches Motorrad unter den ganzen anderen total nonkonformistischen Motorrädern seiner Facebook-Buddies und Hipster-Followern lediglich anhand der total individuellen Buchstaben- und Ziffernfolge des Nummernschildes wiedererkennt.
Angenommen, ein Trüffel kauft sich ein altes Motorrad, vielleicht sogar ein englisches… Aber nein, ein Trüffel kauft sich kein altes Motorrad und schon gar kein englisches. Denn wenn der Trüffel dies täte, wäre er ein Hipster. Aber dennoch hat der Trüffel irgendwie mitbekommen, dass die Hipster mal wieder was am Laufen haben, sei es durch die zunehmende Anzahl von bärtigen, Jethelm drapierten Motorradfahrern, die in Pferdeleder gewandet mit Skibrille auf alten und lauten Motorrädern durch sein Viertel kacheln oder auch durch die zunehmende Anzahl der Berichte und Fotoreportagen der Motorradpostillen, welche die Stars der sogenannten New Custom Szene feiern, die alte Motorräder mehr oder weniger einfallsreich umbauen, und so auch einen „New Way of Motorcycling“ proklamieren, der irgendwie puristisch, authentisch als auch cool und lässig sein soll. Und natürlich will der Trüffel auch irgendwie cool, lässig, puristisch und authentisch sein, und ausserdem weiss er aus Erfahrung, dass so ein Hipster-Dings, erst einmal am Laufen, eine ziemliche Dynamik entfalten kann und somit seine Chancen, demnächst am Bikertreff mit seiner zehn Jahre alten GS oder African Twin auf der gefühlten Lässigkeits-Skala ganz unten zu rangieren, nicht schlecht stehen, weshalb er, was seine weitere Motorradfahrerkarriere angeht, akuten Handlungsbedarf diagnostiziert. Aber leider versteht der Trüffel nicht, dass sich die Welt der motorradfahrenden Hipster bestimmter ausgetüftelter Codes bedient, die festlegen, was geht und was nicht, was cool und lässig ist und was nicht, welche Motorradjacke, welche Jeans, welche Schuhe, welche Brille undsoweiter und wie getragen werden müssen, um dazuzugehören. Der Trüffel versteht nur, dass alte Motorräder irgendwie „in“ sind und dass Motorradfahrer auf alten Maschinen irgendwie lässig aussehen müssen. Alte Maschinen aber sind ihm suspekt, weil vermeintlich reparaturanfällig, Schrauben kann oder will er nicht, das Craftsmanship-Geschwurbel ist ihm herzlich egal, wenn er überhaupt darum weiss, das heisst, er will gerne Teil der von ihm empfundenen Hipster-Lässigkeits-Welt sein, kann aber aus bestimmten Gründen, sei es aus Bequemlichkeit oder mangelnder Zeit, nicht dieselbe Leidenschaft wie der Experte oder die gleiche Leidensfähigkeit nach selbst aufgebauten sozialen Druck wie der Hipster aufbringen. Das heisst, der Trüffel hat ein mehr oder weniger dringendes Bedürfnis, das in ihm durch die Hipster geweckt worden ist, das er aber nicht auf dieselbe Weise wie die Hipster befriedigen kann oder will, weshalb er unter Umständen sehr dankbar sein wird, wenn man ihm ein entsprechendes Angebot macht. Und genau in diesem Moment kommt natürlich die Industrie ins Spiel, die das Treiben der Hipster in den letzten Jahren zum einen zunehmend begeistert, aber zum anderen auch sorgenvoll beobachtet hat. Begeistert, da auch aufgrund der Hipster die Zulassungszahlen der Motorräder nach Jahren der Stagnation endlich wieder steigen, sorgenvoll, weil die Industrie an dem Hype um gebrauchte und alte Motorräder natürlich wenig bis nix verdient. Die Hersteller wollen also nicht nur ein paar Ersatzteile für die alten Motorräder verkaufen, sondern haben das ebenfalls dringende Bedürfnis, neue Motorräder an den Mann oder auch an die Frau zu bringen. Und aus leidiger Erfahrung wissen sie, dass sie die Hipster mit ihren Angeboten aus bestimmten Gründen nicht werden erreichen können, was aber mehr als nur zu verschmerzen ist, wenn es ihnen gelingt, die Trüffel auf Linie zu bringen und diese von ihren Produkten zu überzeugen, die es ihnen ermöglichen sollen, in die Hipster-Lässigkeit einzutauchen, ohne sich mit den alten Maschinen vermeintlich herumzuplagen. Und genau deshalb ersinnen die Hersteller Retro-Motorräder, also Motorräder, die zwar über moderne Technik und vermeintliche Zuverlässigkeit verfügen, jedoch in ihrer Gestaltung oder Formgebung historische Vorbilder zitieren. Retro an sich ist kein neues Phänomen in der Motorradwelt, immer mal wieder haben die Hersteller in den letzten Jahren ein paar Retromodelle angeboten, so wie Harley-Davidson in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich nichts anderes gebaut hat als Retro-Motorräder. Neu ist an diesem Phänomen in der Motorradwelt, dass der Retro-Trend derzeit so stark ist, dass fast jeder Hersteller gezwungen ist, mindestens ein Retromodell anzubieten, wenn er von den steigenden Zulassungszahlen profitieren will. Und so rollten in den letzten Jahren immer mehr sogenannte Retro-Bikes aus den Werkshallen: Moto Guzzi V9, Ducati Scrambler, Triumph Bonneville, Yamaha SR 400, BMW R nineT, um nur einige zu nennen. Anfangs ein bisschen stiefmütterlich motorisiert und von den Herstellern wohl selbst nicht ganz ernstgenommen, werden diese Motorräder jetzt zunehmend vollwertiger ausgestattet. Aus den Spassmobilen mit klassischer Optik von vor ein paar Jahren sind inzwischen echte Motorräder geworden, welche die Motorradfahrerschaft aber auch spalten. Denn so ein Retro-Motorrad ist nunmal ein seltsam Ding, ein Zwitter zwischen dem Gestern und Morgen. Konfrontiert man den Experten mit einem dieser Retro-Motorräder, wird er versuchen, dieses ihm unbekannte Wesen kontemplativ zu verstehen, er wird es lange betrachten, um irgendetwas an diesem Motorrad zu finden, an dem er seinen Blick festmachen kann, und das ihm den Rest des Gefährts gleichsam aufzuschlüsseln vermag. Nur wird er in der Regel nichts finden, da er vor einem Objekt steht, das für ihn zu indifferent ist, das ihm etwas vorzugaukeln versucht und damit mit einer Sprache spricht, die er nicht versteht, zu viel vertraute Worte, die dennoch so fremd klingen in seinen Ohren. Trotzdem wird der Experte höflich bleiben und zu dem Fahrer des Retro-Motorrades beispielsweise Dinge sagen wie: „Das ist aber ein tolles Motorrad. Und so eine schöne gelbe Gabel hat es. Ist eine Upside Down, ne?“ Und da wird sich der Retro-Motorradfahrer wahrscheinlich geschmeichelt fühlen, dass er von einem Experten zu seinem Motorrad befragt wird, was ihn in der Ansicht bestätigt, dass er sich ne echt lässige Maschine zugelegt hat, um den Experten sodann mit monologisierendem Benzingequatsche zu überschütten, was der aber durchaus beabsichtigt hat, weil nämlich der Redeschwall des Trüffels ihm die Zeit geben soll, darüber nachzudenken, wie er aus der Nummer wieder raus kommt. Konfrontiert man den Hipster mit einem Retro-Motorrad, so wird er gar nichts sagen, da er, wenn überhaupt, nur eine Nanosekunde benötigt, um zu wissen, wie er sich zu dem Retro-Motorrad zu verhalten hat, denn obwohl dieses Motorrad die vernünftige Lösung seiner Motorradprobleme sein könnte, da es zuverlässig funktioniert, was seine 45 Jahre alte Möhre leider nicht tut, da beispielsweise der Rostumwandler in seinem Tank den Rost leider nur in Rost umgewandelt hat, der jetzt die Vergaser verstopft, oder die Elektrik total verfrickelt ist, weiss er, was seine Hipsterkollegen todsicher zu ihm sagen werden, würde er mit diesem Retro-Dings beim Treff auftauchen: „Das’ jetzt nicht dein Ernst, Digger!“ oder „Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, Alta!“ genuschelt aus Vollbärten unter Trucker-Caps wären noch die harmlosesten zu erwartenden Kritiken, weshalb sich der Hipster wortlos in sein weiteres trauriges Motorradschicksal fügt, nicht ohne sich mit der Einsicht zu trösten, dass so eine coole lässige Hippness nun mal auch seinen Preis haben muss, denn sonst könnte ja jeder so cool und lässig sein wie er.
Und so offenbart sich eben die Verflachung des Wissens über das Objekt der Hipster-Exklusivität gerade in der Art der Beziehung der drei Protagonisten zu ihrem Objekt. Für den Experten bleibt das Objekt seiner Beziehung immer das Motorrad selbst, dem er sein Wohl und Wehe unterwirft und zu dem er aus irgendwelchen psychopathologischen Gründen eine fast schon intime Beziehung pflegt. Ganz anders der Hipster, für ihn ist das Objekt der Beziehung eigentlich nicht das Motorrad, sondern er selbst oder seine eigene Grossartigkeit, die durch das Motorrad als Accessoire bloss ausgedrückt werden soll. Und schliesslich der Trüffel, der in der irrigen Annahme, er sei ein Hipster, zwar meint, er drücke auch seine eigene Grossartigkeit durch das Accessoire Motorrad aus, bei dem sich jedoch die Objektbeziehung total verkehrt hat, da weder seine eigene Grossartigkeit noch das Motorrad zum Objekt geworden sind, sondern er selbst, aufgestöbert durch den „Trüffelhund“ Hipster, zum Objekt der Marketingstrategen der Industrie geworden ist. So mag es nicht verwundern, dass im Fortgang oder der Veränderung der Objektbeziehung vom Enthusiasten über den Hipster bis hin zu Trüffel auch immer eine weitere Verflachungsstufe des Wissens markiert wird, da sich die Protagonisten immer weiter von dem Motorrad entfernen, der Experte noch ganz nah am Objekt seiner Begierde, der Hipster immer nur nah bei sich, vielleicht auch, weil er nur zufällig zu seiner „Passion“ Motorrad gekommen ist, weil eben Motorräder und nicht Katamarane oder (wie aktuell) DiversityGenderÖkoClimate-Transformations-Gedöns gerade Trend waren, als er auf den Hipsterzug aufgesprungen ist, und schliesslich der Trüffel, der zwar ein Motorrad mit „klassischer“ Optik aber mit moderner Technik und Elektronik gekauft hat, die sich ihm unter ein bisschen Retro-Make-up unzugänglich und abweisend wie eine Black Box präsentieren, weshalb er zusätzlich zu dem Kaufpreis des Motorrads noch gezwungen sein wird, das Salär für die Dienstleistungen der Vertragswerkstatt in den Gesamtpreis miteinzukalkulieren, was natürlich kein Zufall ist. Und parallel zu der Verflachung des Wissens, vollzieht sich zwangsläufig somit auch eine Umkehrung der Verfügungsgewalt oder der Macht über das Motorrad, hat der Enthusiast das alte Motorrad noch ganz in seiner Gewalt und zwar so sehr, dass zuweilen fast der Eindruck entstehen könnte, das Machtverhältnis zwischen ihnen beiden sei umgekehrt, was aber täuscht, denn letztendlich bleibt er auch bei allen Rückschlägen immer Herr des Verfahrens, der nur die üblichen Abhängigkeiten zu Zulieferern und Ersatzteillieferanten kennt, sieht es beim Hipster schon anders aus, da er sich beim Umgang mit seinem Motorrad, ob Verratztvehikel oder Custom-Bike, allein davon leiten lässt, was Dritte über sein Projekt denken oder denken könnten oder denken werden, weshalb er sich permanent und in Echtzeit bei seiner „Community“ rückversichert, auch um das Denken der Anderen über sich selbst irgendwie unter Kontrolle zu halten, eine durch permanente Rückkopplung sich immer mehr verzerrende Kommunikation, die schliesslich und zwangsläufig ein inzestuöses Ergebnis gebären wird: Ein Allerweltsmotorrad, dessen Entstehungsgeschichte nie wirklich vollständig in seiner Macht war und in dessen eigentlichen Kern er immer nur so weit vorgedrungen ist, wie es seiner eitlen Selbstdarstellung diente, ein schon partieller Verlust der Macht über sich und sein Motorrad, der sich dann beim Trüffel als fast total erweisen wird, da eben die Entgrenzung des Trüffels totaler ist als die des Hipsters, welcher seinen Motorradfimmel immerhin noch in das mehr oder weniger enge Setting eines bestimmten Milieus einbettet, dem Hipsterkosmos, dem irgendwelche, wenn auch verschwurbelten Werte wie beispielsweise Craftsmanship oder Authentizität untergeschoben sind, die den Hipster in gewisser Weise erden, die ihn gewissen selbstgewählten Regeln unterwerfen, die ihn begrenzen und die eben in dieser Grenze auch einen Unterschied zum Trüffel behaupten. Der Trüffel hingegen möchte nur ein einziges Element aus dem Hipsterkosmos, der ganze andere Kram, wenn er denn überhaupt um ihn weiss, ist ihm egal, er möchte die luftige Lässigkeit auf einem vermeintlich urtümlichen Motorrad und muss dabei fast zwangsläufig übersehen, dass auf dieser Welt nun einmal (fast) nix für umsonst zu haben ist und man immer einen Preis zu zahlen hat.
IV. Retro
Und wahrscheinlich hat es das schon zu allen Zeiten gegeben, das menschliche Bedürfnis, Formen, Stile oder auch Moden vorangegangener Epochen in der Gegenwart zu zitieren, wahrscheinlich haben nicht nur die alten Römer die Formen und Stile der alten Griechen kopiert und zitiert, sondern erinnerte man sich schon in der Steinzeit an die unglaublich lässige Art, wie die Vorväter ihre Keule schulterten oder an ihren schicken kurzen Lederschurz, der zudem noch aus so echt flauschigem Kaninchenleder gefertigt worden war, weshalb die Steinzeit-Hipster sich seinerzeit sogleich daran machten, Keulen und Lendenschurze craftsmanshipmässig mit alten Manufactum-Faustkeilen nachzufertigen. „Retro“, also die „rückwärts“-gewandte Orientierung an Kulturformen, -elementen und -traditionen vergangener Epochen, um diese mehr oder weniger stark ausgeprägt bzw. abgewandelt oder neu interpretiert in allen möglichen Kulturbereichen der Neuzeit, seien diese Mode, Architektur, Kunst, Produktdesign, Rituale, Sprache, Lebensmittel, Werte und und und, zu transportieren oder zu zitieren, scheint ein Phänomen zu sein, das alle Daseinsbereiche des Menschen immer schon mit-erfasst hat. Wobei dieses „Retro“, der Rückgriff auf das Alte und Dagewesene, kaum bestimmte Regeln erkennen lässt, die diesen Rückgriff definieren, „Retro“ überspringt mit Leichtigkeit mehrere Jahrhunderte, um mit der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert das kulturelle Erbe der römischen und griechischen Antike wiederzubeleben, erweist sich aber auch als erstaunlich kurzgriffig, wenn in der neuzeitlichen Pop- und Rockmusik mit Beginn der Nuller Jahre mit fast schon eintöniger Regelmässigkeit alle paar Jahre nicht nur die Musikstile der vorangegangenen Jahre verwurstet werden, sondern auch schon deren Retro-Vor-Vor-Verwurstungen, also im sogenannten Alternative-Rock-Genre nicht nur die 60er und 70er zitiert werden, sondern auch die Zitate von dieser Musik, die bereits in den 80er und 90er in der sogenannten Independent-Music getätigt worden sind. Retro ist aber nicht nur eine kulturgeschichtliche Epoche oder ein Musikstil, Retro ist auch ein Paisleymuster, ein Paar Cowboystiefel, ein Petticoat, eine Fernsehserie, ein Speiseeis, eine Limonadenflaschenform, eine Sonnenbrille oder ein Jeans-Schnittmuster, um nur ein paar der sicher millionenfachen Ausformungen des Phänomens „Retro“ zu nennen, die zumindest oberflächlich nichts miteinander gemein haben, denn was schon sollten die Renaissance mit dem Speiseeis „Brauner Bär“ und die Ramones mit der Zeichentrickserie „Wickie“ gemein haben können? Und um das Durcheinander noch komplett zu machen, wird die Welt der Retro-Produkte gelegentlich noch unterschieden in echte, unechte, generische und neu designte Retro-Objekte, was zwar einigermassen hilfreich sein kann, um irgendwie den Grad ihrer Authentizität zu bestimmen, das menschliche Bedürfnis nach dem „Rückwärts“ erklären derlei Unterscheidungen aber nicht unbedingt. Und so bleibt dann zunächst einmal der Verweis auf den vielleicht gängigsten Erklärungsansatz, der davon ausgeht, dass Menschen ein Bedürfnis danach hätten, im Erwachsenenalter die prägenden Produkte oder die Formenwelt ihrer Kindheit wieder zu entdecken, wobei es diesbezüglich nicht ganz klar zu sein scheint, ob dieses Bedürfnis auch tatsächlich besteht oder dem Konsumenten nur durch die Industrie untergeschoben wird, wenn er im Supermarkt seiner Wahl auf eine neuzeitliche Limonade in der ihm aus der Kindheit bekannten Flaschenform trifft. Diese vermag sicherlich einen nostalgischen Moment auszulösen, so wie beim Betrachten alter Fotos, aber gibt es deshalb auch ein originäres Bedürfnis nach Limonade in alten Flaschen oder neuem Wein in alten Schläuchen? Sicherlich nicht. Aber vielleicht gibt es ein Bedürfnis nach alten Fotos oder genauer: Nach dem auf ihnen eingefrorenen Momenten der Erinnerung, zumal wenn das Erinnerte längst vergangen, es in der neuzeitlichen Alltagswelt nicht mehr vorhanden ist, so wie eine Limonadenflasche, die bereits seit Jahren nicht mehr produziert wird, die also auch „gewesen“ ist. Eine Limonadenflaschenform jedoch, die immer da geblieben ist, die niemals gewesen ist, muss auch nicht explizit erinnert werden, man muss sie lediglich erkennen können, eine Art alltagspraktisches Erinnern, das uns nicht nur das Einkaufen erleichtert, sondern auch generell die Orientierung im Jetzt, da wir wissen oder besser gesagt: Uns erinnern, wie die Flasche unserer favorisierten Limonade aussieht oder was das rote Licht an der Ampel bedeutet oder wie man einen Aufzug bedient, ein unbewusstes, „automatisches“ Erinnern, mit dem in der Regel keine nostalgischen Momente verbunden sind. Wird man nun unverhofft mit einer Limonadenflaschenform konfrontiert, die vor vielen Jahren auf den Markt gekommen ist, die dann wieder für einige Zeit verschwand und jetzt plötzlich wieder im Supermarktregal steht, so fühlt sich dieses „Wieder-Erinnert-Werden“ an diese Limonadenflaschenform anders an als das „automatische Erinnern“ der Limonade oder des Speiseeis‘ oder der Zeichentrickserie in der Kindheit. Und das mag damit zu tuen haben, dass man sich eigentlich gar nicht an die Limonadenflaschenform der Kindheit erinnert, sondern mittelbar durch die Limonadenflaschenform an eine prägende Zeit in der eigenen Biographie, in welcher man die ersten Limonadenflaschen bewusst wahrnahm und den Umgang mit ihnen lernte, den ersten „Brauner Bär“ selbständig einkaufte und verspeiste und die ersten Zeichentrickserien schaute, eine Zeit, in der sich das Bewusstsein ausbildete und die man deshalb vielleicht die persönliche „Gründungszeit“ nennen kann, da sich in ihr und anhand der Erfahrungen mit den persönlichen „Archetypen“ der damaligen Zeit, also den Limonadenflaschen, dem Speiseeis und den Zeichentrickserien etc. der Kindheit, das ausbildete und entwickelte, was weiter oben das alltagspraktische Erinnern oder das Orientierungsvermögen im Jetzt genannt wurde, ohne an dieser Stelle zu tief in die Entwicklungspsychologie einsteigen zu wollen. Wenn also das menschliche Bedürfnis nach Retro ein Bedürfnis nach einer Rückschau in die persönliche „Gründungszeit“ ist, dann ist es immer auch eine Rückschau in den Baukasten der Dinge mittels derer sich ein Gutteil unseres Bewusstseins ausbildete, und schauen wir zurück, erhalten wir durch das Erinnern oder das Zitieren der persönlichen „Archetypen unserer individuellen Gründungszeit“ im Jetzt immer auch Zitate unserer eigenen Entwicklungsgeschichte, welche uns unserer Selbst – oder wenn man so will: Unserer Identität versichern sollen. Und jetzt könnte man natürlich schreiben, dass es sich mit den Retromotorrädern ebenso verhalte, dass nämlich alle diejenigen, die sich ein Retromotorrad kaufen, irgendeine prägende Kindheitserfahrung mit den originalen Motorrädern in der Kindheit gehabt haben müssten, so sie sich beispielsweise erinnern, wie jemand damals eine Norton Commando ankickte oder begeistert dem Sound einer ollen Moto Guzzi Le Mans lauschte, die 1976 an irgendeiner Eisdiele vorbei rumpelte. Und vielleicht verhält es sich auch genauso, aber dennoch greift der Erklärungsansatz, wonach der Retroeffekt allein durch prägende Ereignisse in der persönlichen „Gründungszeit“ bedingt sei, womöglich zu kurz, da er beispielsweise das kulturgeschichtlich grösste Retrophänomen, die Renaissance, nicht wirklich erklären kann, es sei denn, man betrachtet die Renaissance als Station auch einer Entwicklungsgeschichte und zwar die der europäischen Kultur, die ihre Wurzeln wiederentdeckt und sich bewusst in die Tradition der römischen und griechischen Antike stellt, wodurch die kulturellen Leistungen der Antike beziehungsweise deren Archetypen zum Vorbild für die Kunst, Architektur Philosophie und Literatur des 15. und 16. Jahrhunderts wurden. Die Antike könnte dann verstanden werden als die „Gründungszeit“ der europäischen Kultur, deren Formenkanon, Philosophie und Literatur nicht nur für die Renaissance, sondern für die gesamte europäische Geistes- und Kulturgeschichte prägend war, was wohl heute niemand ernsthaft bestreiten wollte. In der Retroschau auf die Antike, deren Zitate nicht nur in der Renaissance verwurstet worden sind, sondern auch in späteren Epochen immer und immer wieder verwurstet wurden und werden, offenbart sich somit eine europäische Kulturentwicklung, die in regelmässigen Abständen immer und immer wieder die Archetypen ihrer Gründungszeit zitiert, ganz so, als wolle sie sich im weiteren Fortgang ihrer Entwicklung immer und immer wieder der Kontinuität ihrer Identität rückversichern, ebenso wie es dem neuzeitlichen Alternative-Rock auf Dauer eigentlich unmöglich ist, die Ramones, die Stooges oder die MC5 als auch deren Zitate in einer späteren Zeit in der Neuzeit nicht zu zitieren, will er die Kontinuität seiner Identität nicht verlieren. Echte Retro-Phänomene, die tatsächlich in der Lage sind, einen tiefen nostalgischen Moment hervorzurufen, können demnach, in Abgrenzung zu irgendeinem modischen Firlefanz, der irgendwie und zusammenhanglos ein bisschen Gestern behauptet, immer nur verstanden werden als identitätsstiftende Zitate innerhalb einer Entwicklungsgeschichte, deren tieferer Sinn es sein sollte, die Kontinuität dieser Identität auch zu behaupten. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem Schreiben eines Textes, der immer länger und länger gerät, auch weil der Author vielleicht ein notorischer Abschweifer ist, sodass er sich gezwungen sieht, den Text, den er bisher geschrieben hat, und vor allem den Anfang, während er weiter an dem Text schreibt immer und immer wieder zu lesen, um sich zu so versichern, dass er, der Text, nicht Gefahr läuft, den Zusammenhang zu verlieren.
Und jetzt sollte man natürlich erwarten, dass die Motorradgeschichte auch die Archetypen ihrer prägenden Zeit, ihres Anfangs zitiert und deshalb die heutigen Retromotorräder eigentlich alle Zitate der Archetypen dieser Zeit, also der 1910er oder 1920er Jahre tragen müssten. Aber so einfach ist das nicht, ein Anfang ist nicht immer auch der Anfang, denn betrachtet man Retromotorräder heutiger Produktion, eine Triumph Bonneville, eine Yamaha SR400, eine Moto Guzzi V7, eine Ducati Scrambler, um nur einige zu nennen, so findet man, dass sie alle die Attribute oder Zitate der historischen Motorräder aus den 1960er und 70er Jahren tragen. Und so verhält es sich bei fast allen Retromotorrädern aller Marken, sie zitieren historische Vorbilder und Formen aus den 1960er und 70er Jahren, abgesehen von den Marken vielleicht, die in zu dieser Zeit nicht mehr existent waren, da sie wie Brough Superior und Indian in den 1940er bzw. 50er Jahren pleite gingen, und jetzt nach der Neugründung eben Retromotorräder produzieren, die Stilelemente dieser Zeit zitieren. (Eine der wenigen Ausnahmen ist die BMW R18, die eine BMW aus den 1930er Jahren zitieren soll, aber eigentlich das fast schon schamlose Plagiat einer 1970er Harley ist, wenngleich auch im „BMW-Make-up“) Dass die heutigen Retromotoräder vorwiegend Bezug auf ihre historischen Vorbilder der 1960 und 70er Jahre nehmen und eben nicht auf die tatsächlichen Anfangsjahre zu Beginn des 20. Jahrhunderts mag vor allem zwei Gründen zu schulden sein, erstens verläuft die Motorradgeschichte in einem technischen Sinne zwar linear, in sozialer Hinsicht ist die Geschichte jedoch durch einen Bruch gekennzeichnet, da ausgehend von Californien das Motorrad als Verkehrsmittel des kleinen Mannes durch das Freizeitprodukt und Ausdrucksmittel Motorrad vornehmlich der Jugend ersetzt worden ist. Die Zeit des Motorradfahren-Müssens geht zu Ende und es beginnt die zweite Geschichte des Motorrads, die Zeit des Motorradfahren-Wollens. Und zweitens markiert diese Zeit des sozialen Umbruchs in der Motorradfahrerschaft auch das Ende der Pionierzeit der Motorradgeschichte, was seltsamerweise gar nicht einmal zufällig geschieht, weil zunehmender Wohlstand, technischer Fortschritt als auch die Vorteile der Massenfertigung das Konkurrenzprodukt Auto zwar erschwinglich, das Motorrad aber gleichzeitig zuverlässiger, bedienerfreundlicher sowie standhafter werden liess. Die damaligen Motorräder waren so gut wie ausentwickelt, enthielten eigentlich bereits alle technischen Merkmale, wie wir sie heute noch an den modernen Motorrädern finden und stiessen auch bezüglich des Volumens der Motoren in heute noch gebräuchliche Dimensionen vor. Darüber hinaus definierten einige Hersteller genau in dieser Zeit nach und nach ihre Eigen- und Besonderheiten: Der „L-Twin“ von Ducati, der quer in den Rahmen eingebaute V2 von Moto Guzzi, der vielleicht beste Boxermotor aller Zeiten, das Zweiventiler Strich-7 Triebwerk von BMW, ein Motorkonzept, welches 1980 eigentlich einen leisen Tod sterben sollte, aber nach Protesten von Kunden und Händlern wiederbelebt werden musste und so dafür sorgte, dass der Boxer mittlerweile ganz tief im Markenkern von BMW verankert ist, und natürlich die Vierzylindermotoren, die neben MV Augusta vor allem zu einem Kennzeichen der japanischen Hersteller wurden etc.. Bedingt durch den anfänglich starken Konkurrenzdruck in der Umbruchphase, der durch den Markteintritt der japanischen Motorradindustrie noch immens verschärft wurde, waren die Hersteller gezwungen, sich mit den unterschiedlichsten Konzepten zu positionieren und schufen so ein vielfältiges Angebot, das komplettiert durch die Konzepte der britischen und amerikanischen Traditionalisten, auch heute noch in den Grundmerkmalen fast genau so angeboten wird. Nebenbei wurden mit den technischen Pionierleistungen und den markenspezifischen Positionierungen auch die verschiedenen „Motorradgattungen“ entwickelt und die heutigen Superbikes, Enduros, Reisetourer, Cruiser fanden unter anderem in den zu Big Bikes, Scramblern ausdifferenzierten und bei Bedarf auch mit Verkleidung zu versehenen damaligen Strassenmaschinen ihre historischen Vorbilder. Die 1960er und 70er Jahre markieren mit dieser einzigartigen Fülle an Entwicklungen und Weichenstellungen somit die prägende Zeit der Motorradgeschichte, die Zeit, in der im verklärenden Rückblick alles gut war, nicht die eigentliche Gründungszeit, gewiss, aber dennoch das Heroische Zeitalter der Motorräder, da Maschinen wie die Ducati 750 SS, die Honda CB 750 Four, die BMW R 90 S, die Moto Guzzi Le Mans, die Kawasaki Z1, die Norton Commando, die Yamaha XT 500 und die Laverda 750 SF, um nur einige wenige zu nennen, aus den Werkshallen gerollt wurden, die allesamt zu Ikonen des Motorradbaus wurden, „Archetypen“, die noch ganz bei sich waren, unverfälscht und roh, und deren „Urformen“ immer noch, wenn auch verborgen unter viel Plastik, Elektronik und Vorschriften bei ihren modernen Nachfolgern hindurch schimmern, denen man im Laufe der kommenden Jahrzehnte aber eigentlich nichts Wesentliches mehr hinzufügen konnte, ganz im Gegenteil, denen man immer mehr Wesentliches nehmen sollte, auch wenn sie schneller, leistungsstärker, bequemer und so vermeintlich perfekter wurden.
V. Die Behauptung der Differenz
Wenn es also stimmt, dass die Retro-Motorräder, die heute, in der Neuzeit, produziert werden, die Zitate der 1960er und 70er Jahre an sich tragen, eben weil sie einen Bezug oder eine Tradition aufnehmen sollen zu den historischen Vorbildern dieser Zeit, die im kollektiven Gedächtnis der Motorradfahrerschaft als „Archetypen“ des modernen Motorrads verankert sind, die für ein puristisches und unverfälschtes Fahrerlebnis standen, welches sich ein Teil der Motorradfahrerschaft, zunehmend gelangweilt und entfremdet durch die glatten und perfekten Motorräder der Neuzeit, zurückwünscht, so ist das zunächst einmal ein Widerspruch, da die Retro-Motorräder natürlich neuzeitliche Motorräder bleiben und somit sämtlichen Vorschriften unterworfen sind, denen neuzeitliche Motorräder nun einmal unterworfen sind, selbst wenn sie Zitate aus einer Zeit tragen, indem es diese Vorschriften noch nicht gab oder anderes ausgedrückt, wenn die Retro-Motorräder das gleiche puristische und unverfälschte Fahrerlebnis wirklich anbieten könnten wie ihre historischen Vorbilder, so wären sie heute verboten. Und dieser Widerspruch bleibt bestehen und lässt sich auch nicht aufzulösen. Nein, auch nicht durch eine illegale Auspuffanlage. Denn anders wie in der Limonadenindustrie mit ihren Retro-Flaschenformen können die Motorradhersteller die alten Motorräder nicht einfach nachbauen, das mag zum einen fertigungstechnische Gründe haben, zum anderen aber ganz sicher den gesetzlichen Vorschriften zu schulden sein. Die Hersteller behelfen sich damit, dass sie den neuzeitlichen Motorrädern quasi Behauptungen einbauen, die Motorräder müssen durch ihre Formen, sowohl ganzheitlich als auch in den Details, behaupten, es handele sich bei ihnen um die gleichen puristischen und rohen Fahrmaschinen aus dem Heroischen Zeitalter, obwohl sie tatsächlich durch und durch neuzeitliche Maschinen sind. Und diese Behauptungen können natürlich variiert werden, wobei die Motorradhersteller neben der klassischen Grundform und der möglichst vollkommenen Abwesenheit von Plastik auf ein paar grundsätzliche Details eigentlich nicht verzichten können, wollen sie ein Retro-Motorrad bauen, das Bezug auf das „Heroische Zeitalter“ des Motorrades nimmt, nämlich: Ein luft/ölgekühlter Motor, der möglichst frei in den Rahmen eingebaut ist, und der nach Möglichkeit klassisch anmutet, wie beispielsweise der Motor der Triumph Bonneville, der bis auf die Attrappen der Vergaser äusserlich eine Kopie seines klassischen Vorfahren ist. Dann noch Stereofederbeine hinten, eine klassische Teleskop-Gabel vorne und natürlich eine Zweiarmschwinge. Das ist die „Vierheiligkeit“ eines Retromotorrades, ganz einfach deshalb, weil alle Motorräder des Heroischen Zeitalters in dieser technischen „Grundkonstellation“ gebaut worden sind, wobei alle anderen möglichen Details wie ein grosser, runder Scheinwerfer oder Drahtspeichenräder etc. eigentlich eher optional sind, sie können ein Retro-Motorrad zieren, müssen das aber nicht. Und schaut man sich nun den Reigen der Motorräder an, die da unter „Retro“, „Heritage“ oder „Classic“ firmieren, dann erfüllen nicht alle diese Motorräder alle Bedingungen der Vierheiligkeit, manche verwenden eine moderne „Upside Down-Gabel“ oder hinten nur ein Federbein oder eine versteckte Federung, um einen Starrahmen vorzutäuschen zu können usw., dennoch verwenden eigentlich alle als Retro-, Heritage- oder Classic-Motorrad vermarktete Maschinen neben anderem Make-up-Chichi zumindest ein oder mehrere Elemente der „Vierheiligkeit“ oder täuschen diese zumindest optisch vor, in dem Sinne, dass diese Elemente extra und ausschliesslich zum Zwecke der Behauptung eines Retro-Bezuges designet und gefertigt wurden. Und dann gibt es ein einziges Motorrad, welches heftig als „Heritage“ beworben worden ist, bei Markteinführung 2014 aber eigentlich keine einzige Bedingung der „Vierheiligkeit“ erfüllte, noch über anderweitiges ernsthaftes Retro-Make-up verfügte, und das war die frühe BMW R NineT.
Die BMW verfügte zwar über einen luftgekühlten Motor, jedoch ohne jede klassische Anmutung, da er ebenso wie das Getriebe nahezu unverändert von einem anderen modernen Motorrad der Marke übernommen wurde. Wiederum ebenso aus dem bestehenden Baukastensystem der Firma stammte die moderne Einarmschwinge mitsamt zentralem Federbein sowie die schicke „Upside Down“-Gabel, die der BMW S 1000 RR, einem modernen Superbike, entlehnt wurde. Damit war die BMW R NineT 2014 nicht nur technisch, sondern auch nach den massgeblichen stilistischen Details der Vierheiligkeit ein durch und durch modernes Motorrad, da helfen dann auch Drahtspeichenräder oder ein Kraftstofftank, der so aussieht, als könne er sich nicht entscheiden, ob er der moderne Tank einer BMW R 1200 R oder doch lieber ein klassischer Toastertank sein wolle, und der so aussehen musste, wie er aussah, nicht weil er irgendwie „Heritage“ sein sollte, sondern da er eben in die Peripherie der anderen modernen Bauteile passend eingesetzt werden musste, nicht wirklich weiter, da das Motorrad fast komplett aus dem modernen Baukastensystem zusammengestöpselt worden ist, dessen äusserlich sichtbaren Teile nie wie beispielsweise bei der Triumph Bonneville unter Retro-Gesichtspunkten entwickelt worden sind. Und das muss gar nicht schlecht sein, im Gegenteil handelte es sich auch bei der frühen R NineT sicher um ein ganz famoses Motorrad, eben weil es nicht nur aus modern anmutenden, sondern auch bewährten, zeitgemässen Komponenten zusammengebaut worden ist, nur ein „echtes“ Retro-Motorrad war sie ganz sicher nicht, da nichts an diesem Motorrad eine Tradition oder einen Bezug zu dem Heroischen Zeitalter behauptete. Das Einzige, was behauptete und behauptet, das sei alles irgendwie „Heritage“, war die blosse Behauptung selbst, die Behauptung einer Differenz, die aber gar keine ist, da sich nichts an diesem Motorrad finden lässt, das diese Behauptung einer Differenz auch nur im Ansatz verifizieren könnte. Dieses Motorrad nahm somit eine fast aberwitzige Position zwischen den ganzen Retro-Motorrädern ein, da alle seine Retro-Konkurrenzprodukte in den wesentlichen Merkmalen aus neuen Teilen aufgebaut sind und waren, die in ihrer Form ein Gestern behaupten sollen, während die frühe BMW R NineT aus bewährten, nicht extra neu entwickelten Teilen aufgebaut worden ist, die ihrer Form nach immer nur ein Heute behaupten konnten, von dem BMW aber 2014 standfest behauptete, es sei „Heritage“, also ein (neu designtes) Gestern.
In München begründete man diese exzessive Inanspruchnahme des schon bestehenden Baukastens für die Entwicklung eines neuen „alten“ Motorrads damit, dass man von Anfang an die Kosten im Auge behalten wollte, um das Motorrad auch zu einem erschwinglichen Preis anbieten zu können. Das liest sich jetzt echt nett, wahrscheinlicher als diese nur vorgeschobene Begründung ist aber wohl, dass BMW tatsächlich die Entwicklungskosten überschaubar halten musste, aber nicht „nur“, weil man dieses Motorrad preisgünstig anbieten wollte, was es mit dem damaligen Basispreis von 14.700 Euro auch nicht wirklich war, sondern weil man den möglichen Schaden minimieren wollte, im Falle, dass die R NineT floppte. Denn bereits 1997 hatte BMW mit der R 1200 C einen ersten schüchternen Schritt in die Retrowelt getan, jedoch verkaufte sich der chromblinkende Boxer-Cruiser so schleppend, dass man die Produktion 2004 wieder einstellte. Auch hatte man in München wohl die Erfahrungen der Konkurrenz aus Bologna genau studiert, die ab 2005 ein echtes Retro-Motorrad, die Ducati SportClassic, in verschiedenen Ausführungen anboten, dessen Produktion aber wegen ausbleibenden Erfolgs bereits 2010 wieder einstellen mussten. Zudem war die R NineT für BMW nicht einfach nur ein weiteres Modell im Portfolio, sondern auch ein Aufbruch nach unbekannten Gefilden, traditionell eher in dem Milieu des BMW-System-Klammotten tragenden, Klapphelm-bewehrten GS-Herrenreiters verhaftet, wollte BMW zukünftig auch in der bisher fremden Welt der Bellstaff-Jacken und Jethelme reüssieren. Man hatte sich in München vor Markteintritt eines seltsamen Motorrades, das eigentlich irgendwie „Heritage“ sein sollte, aus Kostengründen aber nur „Today“ war, also einiger Risiken zu vergegenwärtigen. Sicher, man konnte sich der ekstatischen Jubelstürme der Motorradjournaille wie immer gewiss sein. Aber um mit so einer fast schon dreisten Nummer durchzukommen, brauchte es schon noch ein Weiteres: Es brauchte so jemanden wie die Weber im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“, die den Kaiser als auch allen anderen glauben machten, dass sie ihm, dem Kaiser, ganz besonders „hippe“ Kleider weben würden, die von niemanden gesehen und richtig gewürdigt werden könnten, „der zu einfältig sei oder für sein Amt nicht tauge.“ Mit anderen Worten: BMW brauchte die Weihen der Hipster, welche die Trüffel „sehend“ machen sollten, dass dieses moderne und eigentlich stinknormale Naked Bike R NineT irgendwie doch Retro oder Heritage oder sonstwie oberlässig sei. Und damit das auch klappte, ersann man in München zur Markteinführung der R NineT eine Marketingkampagne namens „Soulfuel“, dessen eigentlicher Kern darin bestand, einige der Leithammel der „New Custrom Motorcycle Szene“, also jene hippen und oberlässigen Motorrad-„Kastemeiser“, die in den Jahren zuvor durch ihre Umbauten alter Motorräder für Furore in der Motorrad-Welt gesorgt hatten, einzukaufen und als Zugpferde vor den R NineT-Marketingkarren zu spannen. Und die, vielleicht auch gebauchpinselt durch den Umstand, dass ein Konzern wie BMW sie überhaupt zur Kenntnis nahm, liessen sich bereitwillig auf dieses Spiel ein, drehten ein „Soulfuel“-Imagefilmchen und dessen „Making of“ für und mit BMW, lobten das „Sexy Beast“ R NineT über den grünen Klee, verbreiteten ansonsten den üblichen Motorrad-Freiheits-Kokolores, bekamen von BMW jeweils ein Exemplar des „Sexy Beasts“ ausgehändigt, um es höchstselbst zu „kastemeisen“, und liessen sich sodann einige hippe Motorrad-Festivals von BMW finanzieren, wo sie zusammen mit ihrem neuen Buddy, dem BMW Motorrad Chef-Designer Ola Stenegard, nebst ihrer eigenen Wichtigkeit natürlich auch die BMW R NineT publikumswirksam hochleben liessen. BMW und Stenegard betrieben diese Kampagne so perfekt und so weit, dass man nicht nur fast den Eindruck gewinnen konnte, der Konzern stünde gewissermassen an der Spitze der hippen „New Custom Bewegung“, sondern seine Schöpfung, das moderne und total stinknormale Naked Bike R NineT, sei eigentlich auch deren absolute Krönung und ultimativer Schlusspunkt. Was ja dann auch so war, denn ab 2015 ging es mit der New Kastemeising Bewegung langsam aber beharrlich bergab, die Umsätze, die wohl auch nicht unbedingt für alle Werkstätten so üppig gewesen waren, erodierten vollends, wenige Jahre später machten die ersten Werkstätten zu, nur wenige überlebten wirtschaftlich und noch sehr viel weniger kommen tatsächlich mit Customizing oder mit dem Verkauf von Customteilen, Accessoires, Mode und Merchandising so einigermassen über die Runden. Böse Zungen könnten nun behaupten, dieser Niedergang hätte seine Ursache in dem Judaskuss mit der Industrie, durch den einige der exponiertesten Vertreter der Szene eigentlich alles verraten hätten, wofür sie einst vorgaben zu stehen, wodurch dann die Industrie hätte übernehmen können, welche der New Custom Szene in der Folge dann die möglichen Kunden abspenstig machte, indem nicht nur die R NineT ein grosser Erfolg wurde, sondern auch die anderen Hersteller ein Retromodell nach dem anderen auf dem Markt und damit an die Trüffel brachten. Dieser möglicher Erklärungsversuch verkennt aber, dass die Trüffel, wie bereits weiter oben ausgeführt, nur in den wenigsten Fällen tatsächlich ein altes umgebautes Motorrad gekauft hätten, denn weder verfügen sie über die verzehrende und alles verzeihende Leidenschaft des Enthusiasten, noch haben sie einen blassen Schimmer von den Gegebenheiten des Hipster-Kosmos, was sie auch gar nicht müssen. Die Trüffel wollen eben nur ein bisschen Brumm-Brumm und dabei am Biker-Treff eine gute Figur machen, ohne sich dabei ölige Finger zu holen. Und wie man am Biker-Treff eine gute Figur macht, genau das meinten sie von den Hipster gelernt zu haben. Betrachtet man nun die Markeinführungen der beschrieben Retro-Motorräder, der BMW R 1200 C, der Ducati SportClassic, die beide mehr oder weniger floppten, und der BMW R NineT, die ein grosser Erfolg wurde, so lassen sich folgende Ursachen für die unterschiedlichen Erfolge vermuten: Die BMW R 1200 C, mit welcher die Münchner sich 1997 sein gehöriges Stück vom damals stark wachsenden Cruiser-Markt abschneiden wollten, war eine Design-Katastrophe, was aber nicht besonders schlimm sein muss, denn auch Design-Katastrophen lassen sich mitunter gut verkaufen, wenn die zugehörige Legende stimmig ist. Aber genau daran haperte es seinerzeit, da die R 1200 C ein Retro-Motorrad war, für das es in der ureigenen BMW-Motorrad-Geschichte keinerlei historische Referenz gab, weil BMW niemals Motorräder gebaut hatte, die aussahen wie eine Boxer-Harley Davidson. Die R 1200 C hing somit retro-historisch gesehen in der Luft, sie referierte irgendwie auf Harley-Davidson und war zudem für einen Cruiser „übertechnisiert“, was nicht so recht zueinander passen wollte. Die Kunden hatten also die Wahl für nicht wenig Geld eine als Harley-Davidson verkleidete BMW GS zu kaufen, die in ihrem seltsamen Retro-Anspruch aber keinerlei Bezug zur Firmenhistorie aufwies, oder lieber doch das amerikanische Original. Viele entschieden sich für Letzteres.

BMW R 1200 C. Design-Katastrophe ohne echten „Retro-Bezug“ in der BMW-Firmengeschichte. Da half dann auch ein prominenter Werbeauftritt in dem James Bond Film „Der Morgen stirbt nie“ nicht wirklich weiter
Anders in Bologna, dort erschufen die Designer liebevoll gestaltete Hommagen an die 750er Ducati-Ikonen der 1970er Jahre. Die verschiedenen Versionen der Ducati SportClassic waren ehrlich und eigenständig designte Retro-Motorräder, zudem mehr als ausreichend stark motorisiert und gingen 2005 mit viel Lob der Fachpresse an den Verkaufsstart, um bereits 2010 wieder vom Markt genommen zu werden, da die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen blieben. Heute verkauft Ducati mit grossem Erfolg die Scrambler, ebenfalls ein ehrlich und eigenständig designtes Retro-Motorrad, welches 2015 im Fahrwasser der BMW R NineT in den Markt eingeführt worden war, während die „alten“ SportClassic-Modelle mittlerweile durchaus gesucht sind und mitunter saftige Gebrauchtpreise erzielen.

Ducati SportClassic 1000S. Liebevoll gestalte Hommage an die Ducati-Ikonen der 1970er Jahre. Produziert von 2007 bis 2009. Damals hinter den Erwartungen, heute durchaus gesucht
Innerhalb von wenigen Jahren hatte sich also Grundlegendes geändert, was den Schluss nahelegt, dass Ducati mit der SportClassic zwischen 2005 und 2010 der Zeit „voraus“ war, oder anders formuliert, dass Ducati die Produktion der SportClassic eigentlich zu früh eingestellt hatte, da irgendwann nach 2010 die Zeit für dieses Motorrad „reif“ gewesen wäre. Was aber macht oder machte die Zeit „reif“? Ungefähr so ab 2010 blubberte das bis dato untergründige Hipster-Dings „New Custom“ oder der Café-Racer-Wahn langsam an die Oberfläche und kam dann immer mehr ins Rollen, bis es von der Industrie nicht mehr nicht nur ignoriert werden konnte, sondern vielmehr begierig aufgegriffen worden ist, um die daraus resultierenden Marktchancen zu nutzen. Es waren die Hipster, welche die Zeit „reif“ machten, um, wenn auch unfreiwillig, die Herde der Trüffel in die Gatter der Industrie zu treiben, wo sie – wie immer – überaus freundlich empfangen worden ist.
Der Erfolg der R NineT ist so geradezu exemplarisch für die Macht der Hipster, da BMW sich noch nicht einmal die Mühe machen musste, die Behauptung, dieses stinknormale Naked Bike sei „Retro“ oder „Heritage“, an der Erscheinung dieses Motorrades „ablesbar“ zu machen. Nichts an der Aufmachung der initialen R NineT von 2014 war irgendwie und tatsächlich „different“ zu anderen modernen Naked Bikes, in dem Sinne, dass dieses seltsame Dings „Retro“ oder „Heritage“ sei. Es war allein die Behauptung selbst, die das behauptete, und die nur funktionieren konnte, da die Hipster diese „leere“ Behauptung BMWs mit ihrer eigenen „Differenz“ füllten und der R NineT damit „Authentizität“ verliehen. Eine gekaufte Authentizität – sicher – aber eine Authentizität, die für die Trüffel funktionierte und die ihnen glauben machte, mit der R NineT mindestens ebenso so „hip“, weil „anders“ (different), Motorrad fahren zu können wie die Hipster auf ihren alten Maschinen, ohne deren Beschwernisse in Kauf nehmen zu müssen. Hatte man sich seinerzeit in München und später in Bologna noch die Mühe gemacht, eigenständige Modelle mit deutlichem Retrobezug auf die Beine zu stellen, die letztlich erfolglos blieben, verzichtete BMW bei der R NineT auf diese „überflüssigen“ Kosten und setzte man in München fast ausschliesslich auf die Weihen der Hipster, die das Kind schon schaukeln würden. Eine genialer Marketingcoup, der aber nur funktionieren konnte, da die Hipster die Zeit inzwischen „reif“ gemacht hatten, und der so erfolgreich war, dass es vielleicht auch dem einen oder anderen Verantwortlichen bei BMW mulmig wurde, weshalb man in den letzten Jahren einige neue R NineT-Varianten auf den Markt warf, die deutlich mehr Retro-Bezug aufweisen.

BMW R NineT. Der BMW neue Kleider
Das Gewese um die Hipster offenbart damit zweierlei, zum einen deren Macht, derer sie sich eigentlich nicht richtig bewusst sind, die aber dennoch gewaltig sein kann und dies nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in sozialer und politischer Hinsicht, und zum anderen die Virtuosität, die Dritte inzwischen entwickelt haben, um die Macht der Hipster für ihre ureigenen Interessen zu nutzen, was deren Macht dann noch einmal für kurze Zeit potenziert, bevor sie vollumfänglich kollabieren wird, da das Abernten der Trüffel durch Dritte immer auch und zwangsläufig den Tod der „Hipster-Exklusivität“ nach sich ziehen muss. Das ist beinahe ein Naturgesetz, das geht gar nicht anders.

Ola Stenegard, 2003 – 2018 BMW Motorrad Chefdesigner, inzwischen zu Indian Motorcycles weiter gewandert. Hipsterkompatibel und ein Meister im „Hipster-Abkochen“. Hier beim „heroischen“ Erzeugen eines pittoresken Funkenregens mittels Flex und einem nicht identifizierbaren Metallteil. Offenbar war gerade kein Motorrad-Heckrahmen zum Malträtieren greifbar
Gerade angesichts dieser Macht der Hipster ist es dann umso wunderlicher, dass man über das Wesen der Hipster eigentlich relativ wenig weiss, vielleicht, weil es die Hipster ja eigentlich gar nicht gibt, weil ja niemand offiziell Hipster geschumpfen (geschimpft) werden will, vielleicht auch, weil der Hipster so unfassbar wandlungsfähig ist, dass er einem in bestimmten Epochen als elitärer Hedonist begegnen kann, um nur wenige Jahre später als moralinsaurer Asket aufzuschlagen – mal selbstironisch, mal verspielt und manchmal leider auch fanatisch – wandelt er zunächst auf schmalen und versponnenen Pfaden, die gleichsam über Nacht zu achtspurigen Autobahnen anwachsen können, auf denen sich dann riesige Herden von Trüffeln in die nächsten Gatter dritter Nutzniesser wälzen, während der Hipster in aller Stille und fernab der Autobahnen bereits schon wieder den nächsten schmalen Pfaden folgt. Die Hipster sind. Und werden immer sein, auch wenn man sie nicht immer gleich erkennt. Sie sind das, was man eine unbewusste gesellschaftliche Avantgarde nennen könnte, die sich im Mainstream-Ekel als Antipode von den Trüffeln abgrenzen muss und deshalb in dem Moment abzusterben beginnt, da ihre „Hipster-Exklusivität“ anfängt, in den Mainstream durchzuschlagen, wodurch ihr eigentlicher Wesenskern, die behauptete Differenz, zwangsläufig ausgelöscht wird.
Eine Macht, die selbst immer ohnmächtig bleibt, aber genau deshalb umso gefährlicher werden kann.
VI. Exklusiv
Und damit ja keine Missverständnisse aufkommen: „Hipster ist seit dem frühen 21. Jahrhundert ein Name für ein Milieu, dessen Angehörige ihrem Szenebewußtsein – in Abgrenzung zur Massenkultur – extravagant, nicht selten ironisch, Ausdruck verleihen. Meist sind es Jugendliche bis junge Erwachsene der urbanen Mittelschicht. Die Bezeichnung ist der gleichnamigen avantgardistischen Subkultur des mittleren 20. Jahrhunderts entlehnt.

Playmobil Hipster von 2022
Hipster ist ein im frühen 21. Jahrhundert in den Medien verbreiteter, zumeist etwas spöttisch gebrauchter Name für ein Milieu, deren Angehörige ihrem Szenebewußtsein – bei Gleichgültigkeit dem Mainstream gegenüber – extravagant Ausdruck verleihen. Meist handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene der urbanen Mittelschicht.“, stand auf Wikipedia zu lesen. Und was auf Wikipedia steht… Na..?
Stimmt!
Immer!
Womit der Autor dieser Zeilen fürs Erste fein raus ist, da der 1000-Seelen-„Flecken“ (Flecken – süddeutsch für kleines Dorf) in dem er wohnt, selbst mit viel Wohlwollen kaum als urban durchgeht, als auch die Zeiten, da er sich – ebenso mit viel Wohlwollen – als junger Erwachsener hätte bezeichnen können, nun einmal lange vorbei sind, womit es mehr als nur zweifelsfrei bewiesen ist, dass der Autor gar nicht das oder der sein kann, selbst wenn er es oder er sein wollte, was oder welcher auf den vorangegangenen Seiten so vollkommen undifferenziert beschrieben oder bezeichnet wurde, als ob es das oder ihn gäbe, obwohl wirklich keiner das oder er sein will, es ihn oder es also eigentlich gar nicht geben kann, obwohl es doch eine Wikipedia-Seite über das oder ihn gibt, weshalb dieses Phantom hier noch eingehender untersucht werden muss. Das deutsche Wikipedia unterscheidet das Phänomen Hipster nach Zeitaltern, es gibt und gab ihn oder sie demnach im 21. als auch 20. Jahrhundert. Allerdings geben beide Wikipedia-Artikel, sowohl der über den aktuellen so wie der über den historischen Hipster nicht so wirklich viel her, weshalb der Autor dieser Zeilen wahnsinnig dankbar darüber ist, dass andere Autoren bereits einiges Erhellendes über den Hipster, seiner Genese und sein Wirken, zusammengetragen haben. Einer dieser Autoren ist Matthias Heine, der in seinem Buch „Seit wann hat GEIL nichts mehr mit Sex zu tun?“ die Herkunftsgeschichte verschiedener Wörter oder Bezeichnungen untersucht und sich unter anderem auch des „Hipsters“ angenommen hat. Nach dem, was Heine so alles über den Hipster oder seiner Bezeichnung zusammengetragen hat, lassen sich seine etymologischen Wurzeln bis in den Senegal zurück verfolgen. Dort lebt das Volk der Wolof, die sich auch auf Wolof verständigen, einer Sprache aus dem nördlichen Zweig der westatlantischen Sprachfamilie, wie Wikipedia weiss, und die unter anderem das schöne kleine Wort „xippie“, das auf Wolof wie „chippie“ mit stumpfen „ch“, ähnlich wie in la-che-en, ausgesprochen wird und das so viel bedeuten soll wie „wachsam, mit offenen Augen“. Und da die Sklavenhändler seinerzeit immer wieder diese Gegend Afrikas heimsuchten, um Menschen auf die Baumwollfarmen Amerikas zu verschleppen, die ihnen zum ganz überwiegenden Teil von Mit-Afrikanern verkauft wurden, nimmt man an, dass mit den afrikanischen Sklaven auch das kleine Wort „xippie“ den Weg über den Atlantik nach Amerika fand, wo es zunächst in den Jargon der Schwarzen und dann allmählich in den allgemeinen Slang überging, um Anfang des 20. Jahrhunderts als „hep“ oder „hip“ auch im US-Englisch der Zeitungen und der Literatur aufzutauchen, und zwar mit der heute noch gebräuchlichen Verwendung „hip“ als Adjektiv für sehr modische Menschen, die sich mit kulturellen, modischen, musikalischen und sprachlichen Trends ausserordentlich gut auskennen. Es ist unter diesen Geburtsumständen nicht sehr verwunderlich, dass „hip“ spätestens in den 1930er Jahren Eingang in den Jargon der Jazz-Szene fand. Eine frühe Form der Substantivierung von „hip“ findet sich nach Heine 1937 in der Septemberausgabe des Jazz Magazins „Downbeat“, in der drei abgebildete Jazzmusiker als „hep cats“ bezeichnet wurden, was in der Swing Ära schon länger als „hepcat“ zu einem festen Begriff für Musiker geworden war, die als besonders hip angesehen wurden. Kurze Zeit später, 1939, veröffentlichte die Swinglegende Cab Calloway dann ein Wörterbuch des Jive-Talks, des Insider-Slangs der damaligen Jazz-Szene, und nannte es in Anlehnung an den Webster Dictionary, dem amerikanischen Duden, „Hepster’s Dictionary: Language of Jive“.

Cab Calloway
Ob dieses Wortspiel eine Erfindung Calloways war oder der Begriff „Hepster“ schon länger in der Jazz-Szene zirkulierte, ist nicht bekannt. 1941 jedoch tauchte Hipster in der heute noch gebräuchlichen Schreibweise „hipster“ das erste Mal auf, gerade noch rechtzeitig, als sich in der Jazz-Szene eine Kulturrevolution ankündigte, der diesen Begriffs weit über die damalige Zeit hinaus bis in die Neuzeit prägen sollte. Der vorherrschende Jazz der 1930er Jahre, der Swing, eine populäre Unterhaltung- und Tanzmusik, hatte seinen Zenit aus verschiedenen Gründen überschritten, junge Jazzmusiker suchten nach anderen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten und entwickelten in Hinterzimmer-Jam-Sessions eine neue Stilrichtung des Jazz, welche zur Keimzelle des Modern Jazz wurde, da seine Protagonisten die Big Band, das grosse Swing-Orchester, und die damit einhergehenden starren Konventionen und Formelhaftigkeiten des Swings ablehnten. Der neue Stil besann sich wieder auf die kleinere Formation der Combo, die in der Standard-Besetzung aus Trompete, Saxophon, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug bestand. Star dieser neuen Musik war nicht mehr der Bandleader, sondern die Solisten innerhalb der Combo, die nun, da nicht mehr in die Disziplin eines grossen Orchesters eingebunden, ihr Können anhand ihres virtuosen Improvisationsvermögens ausweisen konnten. Ein Merkmal dieser neuen Musik war die Verachtung – die Verachtung eines Jazz, der nur noch dem populären Vergnügen eines zunehmend „weisseren“ Publikums zu dienen hatte und der auch durch immer mehr weisse Musiker und Bandleader erzeugt wurde. Der Bebop war somit auch die Reaktion auf die Vereinnahmung einer schwarzen Kulturleistung durch weisse Kulturschaffende in einer weiss dominierten Gesellschaft, die den schwarzen Pionieren dieser Musik die gesellschaftliche und politische Anerkennung ihrer Musik, ihrer künstlerischen Leistung aber auch ihrer Person verweigerte. Der Bebop sollte deshalb auch einen musikalischen Raum schaffen, der nicht mehr so leicht durch die sprichwörtlichen „Blue Eyed Soulthieves“ erobert werden konnte, er verzichtete auf die herkömmlichen Formelhaftigkeit, da er nicht mehr in Noten gegossen war, die nur ein braveres Mindestmass an Improvisation zuliessen, sondern vertraute allein auf das Improvisationsvermögen seiner Protagonisten. Resultat war eine Musik, die eigentlich nicht mehr „kulinarisch“ im Sinne eines „Easy Listening“ zu geniessen war, da sie das Hauptaugenmerk des Zuhörers nicht nur auf das technische KnowHow des Musikers lenkte, sondern auch auf sein intellektuelles Vermögen, ein rudimentäres Thema möglichst kreativ zu variieren, wobei sich der Musiker während seiner Variation auch bestimmter „Zitate“ bediente, die Tonfolgen oder Phrasen bekannter Improvisationen anderer Künstler, aber auch der Alltagsklangwelt entnommen sein konnten wie beispielsweise Erkennungsmelodien von irgendwelchen Radiosendungen oder Werbe-Jingles, weshalb der Bebop heute eigentlich unmöglich musikhermeneutisch aufzuschlüsseln ist, da der Bedeutungsbezug, die Alltagsklangwelten der 1940 und -50er Jahre untergegangen sind. Bebop-Improvisationen sind somit komplexe Ton-Collagen virtuoser Individualisten, die zumeist in einem rasenden Tempo gespielt wurden, und deren Bedeutungskontext sich tatsächlich nur Eingewehten offenbarte, zumal jedes „Stück“ bedingt durch die Improvisationen so einzigartig wie flüchtig war, eben weil es aufgrund der flüchtigen Wesensart dieser Musik völlig sinnlos gewesen wäre, die Improvisationen notenschriftlich zu fixieren, um sie jederzeit nachspielen zu können. Der Bebop existierte ausschliesslich im Augenblick, die einzige Möglichkeit ihn der Nachwelt zu erhalten und auch zu verbreiten war damals die Schallplatte, welche Ende der 1940er Jahre hinsichtlich Material und Spieldauer auch zu ihrer endgültigen Form fand. Aufgrund der besseren Tonqualität sowie der längeren Laufzeit waren die neuen Vinyl-Schallplatten in der Lage, die Leistungen und das Können der Solisten qualitativ hochwertig wiederzugeben, was dazu führte, dass sich diese Musik auch in bestimmten Milieus der liberalen weissen amerikanischen Mittelschicht verbreitete und sich nicht nur dort ein spezielles Expertentun etablierte. Der Bebop markiert somit auch mit seiner Verachtung des Mainstreams und der damit einhergehenden Abkehr von der leicht zu konsumierenden Unterhaltung- und Tanzmusik die Geburt des Jazz als eigene Kunstform, deren Vertreter wie unter anderen Dizzy Gillespie, Thelonious Monk und Charlie Parker auch aufgrund der erbitterten Kritik der Altvorderen und grossen Teilen des gewachsenen Jazzpublikums verschworene Mitglieder eines „arty“ Milieus wurden, das sich nicht nur durch die Musik vom Mainstream absetzte, sondern dazu auch noch den Stil und den Habitus des historischen schwarzen Hipsters generierte, um sich noch deutlicher – aber auch arroganter und elitärer – von der Masse der „Unwissenden“ abzugrenzen. Anatole Broyard, ein Literaturkritiker der New York Times, beschreibt die neue Subkultur 1948 in einem Aufsatz nach Heine wie folgt:
„Der schwarze Hipster erhob Anspruch auf eine überlegene, spezielle Wahrheit, die niemand sonst besitzen konnte, auch wenn er Zugang zu denselben Daten oder demselben Wissen hatte. Diesen Anspruch bekundete der Hipster auch durch sein Äußeres, indem er ganz bewusst Dinge tat, die von Nicht-Hipstern als lächerlich empfunden wurden.“

Der Prototyp des Hipsters? Dizzy Gillespie. Foto datiert zwischen 1948 und 1949
Mit anderen Worten könnte man auch sagen, das kleine Wörtchen „xippie“ aus der Sprache der Wolof war als „hip“ und „hipster“ tatsächlich in der Avantgarde angekommen, einer amerikanischen Großstadt-Boheme, und hier vor allem New York City, die in der konformistischen Gesellschaft der Truman- und der darauf folgenden Eisenhower-Ära eine kleine Insel der Unangepasstheit bildete, die auch Ausstrahlung auf einige weisse Ausgeflippte entfaltete, von denen wiederum nur einige wenige den Kern der sogenannten „Beat Generation“ bilden sollten, eine literarische „Underground-Bewegung“, deren Vertreter nach einem neuen Stil suchten: atemlos sollte ihre „neue“ Literatur sein, rhythmisch, spontan, schnell, modern, so flüchtig und genial wie eine Improvisation des modernen Jazz, die in dem Augenblick, da sie entsteht schon wieder vergangen ist. Aber es ist nicht nur Ausdruck vermeintlich flüchtiger Genialität, die dieses Milieu, die Avantgarde der schwarzen Jazzer, für die weissen Ich-mach-irgendwas-mit-Kunst-Aussteiger so interessant machte, sondern gerade auch deren „doppelte“ Ablehnung des Status Quo, die sich zum einen gegen die Altvorderen ihrer Kunst richtete und zum anderen gegen die weisse Mainstreamgesellschaft überhaupt. Wobei diese erste Form der Ablehnung in beiden Milieus, dem der Jazzer und dem der „Beats“, die gleiche Ursache zu haben scheint, nämlich das übliche und absolut erforderliche Aufbegehren eines neuen Stils, einer neuen oder erneuerten Kunst gegen die Tradition und das Althergebrachte, welches gleichsam bekämpft werden muss, will sich das Neue oder die künstlerische Leistung einer neuen Generation als eigenständig emanzipieren. Aber die zweite Form der Ablehnung, die Ablehnung der Mainstreamgesellschaft in ihrer Gänze muss sich nach ihrem Grund und ihrer Geartetheit in den unterschiedlichen Milieus mehr als deutlich unterscheiden, da die schwarzen Beboper eine ehemalige Sklavenhaltergesellschaft verständlicherweise ablehnen mussten, die ihnen immer noch die Gleichberechtigung und Anerkennung sowohl ihrer Person als auch ihrer künstlerischen Leistungen verweigerte, während den Beats, den weissen middleclass- und upperclass-kids als Mitgliedern der dominierenden Ethnie im Nachkriegs-Amerika, da der „American Dream“ zumindest für die Weissen noch funktionieren konnte, wenn auch freilich unter Preisgabe der eigenen Nonkonformität, eigentlich alle Türen offen standen. Nicht nur einen Hinweis für die Gründe der Ablehnung der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft durch einige weisse middleclass- und upperclasskids findet sich in einem Essay des Schriftstellers Norman Mailer, der 1957 mit dem Titel „The White Negro: Superficial Reflections on the Hipster“ erschien, und das fast schon programmatisch durch ein längeres Zitat eines Artikels der Journalistin Caroline Bird vom Harper’s Bazaar eingeleitet wurde:
„Unsere Suche nach den Rebellen dieser Generation hat uns zum Hipster geführt. Der Hipster ist ein umgestülptes enfant terrible. Er versucht, es den Konformisten heimzuzahlen, indem er sich im Hintergrund hält … Man kann einen Hipster nicht für ein Interview gewinnen, denn sein Hauptziel liegt darin, sich der Gesellschaft fernzuhalten, die, so meint er, jeden nach ihrem Bild zu formen sucht. Er greift zu Marihuana, weil es ihm die Erlebnisse vermittelt, an denen der „square“ nicht teilhaben kann. Vielleicht trägt er einen breitkrempigen Hut oder einen Zoot Suit, aber für gewöhnlich zieht er es vor, sich unauffällig herumzudrücken. Der Hipster kann ein Jazzmusiker sein; selten ist er ein bildender Künstler, fast nie ein Schriftsteller. Er verdient sich möglicherweise seinen Lebensunterhalt als Kleinkrimineller, als Landstreicher, als Gelegenheitsarbeiter auf Rummelplätzen oder als selbständiger Fuhrunternehmer in Greenwich Village, aber einige Hipster haben als Komiker beim Fernsehen oder als Filmschauspieler eine gesicherte Zukunft gefunden. (So war der verstorbene James Dean ein Hipsterheld) … Man fühlt sich versucht, den Hipster als infantil im Sinne der Psychiatrie hinzustellen, sein Infantilismus ist jedoch ein Zeichen der Zeit. Er versucht nicht (…) seinen Willen anderen aufzuzwingen, sondern begnügt sich mit einer bisher nie widerlegten, weil nie auf die Probe gestellten, magischen Omnipotenz … Als der einzige radikale Nonkonformist seiner Generation übt er allein durch Zeitungsartikel, die über seine Vergehen, über seinen unstrukturierten Jazz und seinen emotionalen Kauderwelsch erscheinen, einen wirkmächtigen, weil Underground-Appeal auf die Konformisten aus.
Aus: „Geboren 1930: Die nichtverlorene Generation“ von Caroline Bird, Harper’s Bazaar, Februar 1957.“
Norman Mailer entwirft in der Folge das fast schon klaustrophobische Szenario einer amerikanischen Gesellschaft, deren Psyche immer noch durch die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zutiefst erschüttert ist. Insbesondere die Massenvernichtungswaffe Atombombe sowie die Massenvernichtungslager der Nazis hätten eine nachhaltig verstörende Wirkung entfaltet, da die Menschen zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit der bedrückenden und unterdrückten Erkenntnis leben müssten, dass ein Tod durch Massenvernichtungswaffen oder ein Tod in Massenvernichtungslagern kein blosses Hirngespinst irgendeines Psychopathen sei, sondern tatsächlich schon Realität geworden war und somit auch immer wieder Realität werden könnte. Eine zutiefst traumatisierende Erkenntnis, die die Menschen nicht nur mit einem möglichen Tod bedrohte, sondern darüber hinaus noch mit der voll umfänglichen Auslöschung seiner Existenz, die mit dem Leben auch die erinnerte Einzigartigkeit jedes Menschen, seine Würde, seine Ideen, sein Andenken für immer vernichten würde. Der Tod durch den „deus ex machina“ in den Gaskammern und in den radioaktiv verseuchten Städten würde das gelebte Leben des Individuums, so Mailer, zu einer blossen Ziffer in irgendeiner riesigen Statistik werden lassen, die lediglich übrig gebliebene Zähne verzeichnet und zählt. Der Zweite Weltkrieg habe der menschlichen Natur seinen Spiegel vorgehalten, der jeden erblinden liess, der einen Blick in ihn warf. Die Erfahrung, dass von Menschen errichtete Zivilisationen so mörderisch wie teilnahmslos sein konnten, Millionen von Menschen in die Gaskammern zu schicken, liess einen jeden tief in die Abgründe des menschlichen Wesens blicken. Mailer diagnostiziert sodann ein Klima der Angst in der amerikanischen Gesellschaft der Gegenwart, das jeden Widerspruch ersticke und das drückende Jahre des Konformitätszwangs und der Depression zufolge hatte.
Diese Diagnose des Schriftstellers, erstellt im Herbst 1957, vermag den heutigen Leser verwundern, wähnte man doch die USA, welche aus dem Horror des Zweiten Weltkriegs als unangefochtene Supermacht hervorgegangen waren, gerade in den 1950er Jahren in Zeiten des gesellschaftlichen Aufbruchs und der wirtschaftlichen Prosperität, denen noch viele viele mit Wohlstand und Fortschritt gesegnete Jahre folgen sollten. Dabei wird aber übersehen, dass die neue und alleinige Supermacht nach Ende des Zweiten Weltkriegs nur wenige Jahre wirklich unangefochten war, schon bald sollte sie von einer beängstigend schnell erstarkenden zweiten Supermacht herausgefordert werden. Am 29. August 1949 zündete die Sowjetunion erfolgreich ihre erste Atombombe und egalisierte damit den waffentechnologischen Vorsprung der USA. In den Folgejahren ging es dann Schlag auf Schlag. Gemäss der Truman-Doktrin, die den Einfluss der Sowjetunion eindämmen sollte, traten die USA 1950 in den Koreakrieg ein, der schnell eskalierte, als sich die Volksrepublik China unterstützt von der Sowjetunion mit hunderttausenden Soldaten auf Seiten Nordkoreas engagierten. Der chinesische Ansturm war so überwältigend, die Gebietsverluste und Niederlagen für die US-geführten und US-dominierten UN-Truppen so gross und heftig, dass Präsident Truman, der eine Ausweitung des als zunächst begrenzt angesehenen Konflikts befürchten musste, sich gezwungen sah, zum ersten Mal in der US-Geschichte den Nationalen Notstand auszurufen, um Militär, Industrie und auch die Gesellschaft auf einen möglichen Dritten Weltkrieg vorzubereiten. Nur mit grossen Mühen gelang es der US Army in der Folgezeit unter Preisgabe des ursprünglichen Kriegsziels, der Wiedervereinigung Koreas, den Staus quo ante, die Teilung des Landes in Nord- und Südkorea entlang des 38. Breitengrades wiederherzustellen. Noch während des Koreakrieges konnten die USA am 1. November 1952 mit der Zündung der ersten Wasserstoffbombe kurzzeitig wieder einen waffentechnologischen Vorsprung erringen, der jedoch bereits neun Monate später durch die Sowjetunion egalisiert wurde, die dann noch einen drauf setzte, indem sie am 22. November 1955 die erste transportable Wasserstoffbombe zur Explosion brachten, ein erster kleiner technologischer Vorsprung der UdSSR, den die Amerikaner erst sechs Monate später, am 21. Mai 1956, wieder einholen konnten. Zwischenzeitlich hatten die Sowjets aber eigene strategische Bomber mit interkontinentaler Reichweite entwickelt, die 1954 in Dienst gestellt wurden, und schliesslich demonstrierten sie im Oktober 1957, als sie den ersten Satelliten mit einer Trägerrakete ins All schossen, dass es ihnen zudem gelungen war, mit dem Trägersystem R-7 eine zuverlässige Interkontinentalrakete zu entwickeln. Insbesondere der erfolgreiche Abschuss des Sputnik-Satelliten war für die USA ein Schock, nicht nur da sie aktuell dem Coup der Russen technologisch nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hatten, sondern auch, weil ihnen schlagartig klar wurde, dass die Sowjets technisch in der Lage waren, das Territorium der USA jederzeit mittels strategischer Bomber oder Interkontinentalraketen nuklear anzugreifen. Die Bedrohung mit dem Tod durch den „deus ex machina“, der nach Mailer die us-amerikanische Gesellschaft in den 1950er traumatisierte, die Möglichkeit der totalen Vernichtung in radioaktiv verseuchten Städten, die so umfassend ist, dass von den Individuen nicht viel mehr bleiben würde als eine Zahl in irgendeiner Statistik der übrig gebliebenen Zähne hatte sich im Verlauf der 1950er Jahre verdichtet und war im Herbst 1957, zum Zeitpunkt des Erscheinens seines Essays, erschütternde Realität geworden, eine unumstössliche Tatsache, mit der sich die amerikanischen Bürger auseinanderzusetzen hatten, die sich bezüglich ihrer technologischen und demokratischen Errungenschaften eigentlich für überlegen hielten, bis jetzt ein Grauen aus den tiefsten Tiefen des menschlichen Abgrundes sie sprichwörtlich heimzusuchen drohte, das sie selbst oder ihre Regierung im Zweiten Weltkrieg zuerst über die Menschheit bzw. über Hiroshima und Nagasaki gebracht hatten. Neben dieser äusseren Bedrohung erwuchs nicht der ganzen amerikanischen Gesellschaft in toto aber doch ihren Intellektuellen, ihren Abweichlern, ihren Freigeistern und Radikalen – also den Nonkonformisten – zu Beginn des Kalten Krieges eine weitere, innere Bedrohung. Und das ist wohl das, was Mailer meinte, wenn er schreibt, dass ein Klima der Angst jeden Widerspruch ersticke und einen Konformitätszwang auslöse:
„Schlimmer. Man konnte kaum noch den Mut aufbringen, ein Individuum zu sein, mit seiner eigenen Stimme zu sprechen, denn die Jahre, in denen man sich selbstgefällig als Teil einer Elite hatte betrachten dürfen, weil man ein Radikaler war, sie waren nun für immer vorbei. Wich ein Mensch von der Meinung der anderen ab, so wusste er, dass sein Leben gezeichnet war, und dieses Zeichen konnte ihm jederzeit, im Falle einer offenen Krise, zum Verhängnis werden.“

Norman Mailer 1960
Nun löst jede äussere Bedrohung einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, immer einen gewissen Konformitätsdruck auf alle Mitglieder dieser Gemeinschaft aus. Die gewaltige Bedrohung der amerikanischen Gesellschaft während der Entfesselung des Kalten Krieges, deren Territorium bis dahin noch nie wirklich ernsthaft bedroht worden war, löste aber nicht nur einen Konformitätszwang aus, sondern eine allgemeine antikommunistische Hysterie, die jeden vermeintlichen Abweichler massiv mit der Vernichtung nicht unbedingt der körperlichen, aber doch der bürgerlichen Existenz bedrohte. Personifiziert wurde diese Bedrohung des intellektuellen Individuums durch den Senator des Staates Wisconsin. Anfangs seiner Senatskarriere eher unauffällig agierend, profilierte sich der Republikaner Joseph McCarthy Anfang der 1950er Jahre mit Angriffen auf die Administration des Präsidenten Harry S. Truman, eines Demokraten, der er unterstellte kommunistisch unterwandert zu sein. Er profitierte hierbei von der weit verbreitenden und wachsenden antikommunistischen Stimmung in der Mainstreamgesellschaft, die sich immer mehr in eine Hysterie geiferte, auch weil sie sich den technologischen Aufschwung des neuen Feindes nur durch Verrat erklären wollte und konnte, was zumindest im Falle der sowjetischen Atombombe auch tatsächlich zutraf. Klaus Fuchs, ein Wissenschaftler des Manhattan-Projekts, der bereits während des Zweiten Weltkriegs wesentliche Details der amerikanischen Atombombe an die Sowjets verraten hatte, flog 1950 auf, weshalb in der Folgezeit die Verschwörungstheorien innerhalb der amerikanischen Mainstreamgesellschaft selbstredend immer absurdere Höhen erklommen.
Es war aber nicht nur McCarthy, der in diesem Zusammenhang immer exemplarisch genannt wird, welcher die antikommunistische Hetze mit immer haltloseren Vorwürfen und Unterstellungen gegen immer mehr Politiker, Künstler, Intellektuelle und Nonkonformisten anstachelte. Ausserdem beteiligt an der Jagd nach vermeintlichen Hochverrätern und Kommunisten waren das sogenannte „Komitee für unamerikanische Umtriebe“ des Kongresses, das schon seit Ende der 1930er Jahre bestand und eigentlich zum Zwecke der Gefahrenabwehr nationalsozialistischer Unterwanderung gegründet worden war, sich aber mit dem Beginn des Kalten Krieges anders orientierte sowie das FBI unter J. Edgar Hoover, der bereits 1950 eine Liste mit den Namen von 12.000 Personen vorlegte, die dem amerikanischen Staat gegenüber angeblich illoyal seien und deren „Internierung“ er allen Ernstes forderte. Und auch wenn dieses unrühmliche Kapitel der amerikanischen Geschichte, das die Verfolgung des vermeintlich „Unamerikanischen“ beschreibt, natürlich nicht mit dem furchtbarsten Kapitel der deutschen Geschichte verglichen werden kann, so enthält es doch einige Elemente, die nicht nur den Juden Norman Mailer erschaudern liessen. Es erzählt von einer Mainstreamgesellschaft, die nur zu gerne den ganzen Verschwörungstheorien von den angeblich „unamerikanischen“ Hochverrätern Glauben schenkte und die vermeintlich aufrichtigen Amerikaner in verantwortlicher Position wie McCarthy und Hoover aufforderte, mit Unnachsichtigkeit gegen die „Volksverräter“ vorzugehen, die nicht selten unter massiver Verletzung ihrer Bürgerrechte dann mittels haltloser Vorwürfe verfolgt, diffamiert, bedroht, denunziert, verurteilt, inhaftiert oder ausgewiesen wurden. Der soziale Druck, der auf „andersdenkenden“ Menschen in dieser Zeit in den USA lastete, muss erheblich gewesen sein, zumal Mailer ausführt:
„Eine totalitäre Gesellschaft stellt an den Mut ihrer Menschen ungeheure Anforderungen und eine nur zum Teil totalitäre Gesellschaft sogar noch höhere, denn die Lebensangst ist grösser. Tatsächlich erfordert fast jede Art nicht konventioneller Betätigung unverhältnismässig großen Mut.“
Eine totalitäre Gesellschaft, deren Bürger in dieser Gesellschaft aufgewachsen, die an deren Totalität von Geburt an gewöhnt worden sind, entwickeln nach Mailer eine geringere Lebensangst als Menschen, die in einer der freiesten Gesellschaften der Welt aufwachsen und auf einmal erfahren müssen, wie in dieser freien Gesellschaft eine Totalität erwächst, und damit auch eine Fallhöhe der Freiheit, die immer grösser und grösser wird, sodass sich die Nonkonformisten – zumindest als denkende Individuen – zwangsläufig fragen müssen, wie gross diese Fallhöhe noch werden kann und welche persönlichen Konsequenzen das eigene abweichende Denken in einem zunehmend totalitäreren Staat bei der nächsten oder übernächsten Eskalationsstufe der Hysterie oder des Hasses der Mainstreamgesellschaft anlässlich einer neuen aussenpolitischen Krise – und an Krisen gab es seinerzeit keinen Mangel – noch haben könnte. Denn in Gesellschaften, die totalitär ins Rutschen geraten sind, so lautete für den Intellektuellen eine Erkenntnis aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, bedenke man besser alle noch möglichen Konsequenzen oder Realitäten und eine mögliche letzte Konsequenz, so hatte er lernen müssen, war die Realität der Gaskammern gewesen.
„Aus jeder Pore des amerikanischen Lebens“, folgert nun Mailer, „steigt der ekle Gestank der Angst empor, und wir leiden an einem kollektiven Versagen des Mutes.“
Und wenn es doch auch seltene und vereinzelte Beispiele des Mutes in dieser Zeit des alles erstickenden spiessigen Mainstreams gegeben haben mag, so identifiziert Mailer eigentlich nur eine kleine Gruppe von Menschen, die es verstanden hat, die sich ihnen anbietenden düsteren Lebensbedingungen für sich nicht nur anzunehmen, sondern auch noch in rebellische Lebensenergie umzukehren: „…wenn es unser aller Los sein soll, mit dem augenblicklichen Tod durch einen Atomkrieg, mit dem verhältnismäßig schnellen Tod durch den Staat als l’univers concentrationnaire oder mit einem langsamen Tod durch Konformismus im Nacken zu leben, wobei jeder schöpferische und rebellische Instinkt erstickt wird (…), es dann nur eine einzige lebensspendende Antwort gibt, nämlich die Bedingungen des Todes zu akzeptieren, mit dem Tod als unmittelbare Gefahr zu leben, sich von der Gesellschaft zu lösen, ohne Wurzeln zu leben und sich aufzumachen auf eine Reise in die unerforschten Gefilde der rebellischen Imperative des Ichs.“ Es ist der „ Existentialist“, der in seiner speziellen amerikanischen Machart als „Hipster“ die Bühne betritt, um der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft der spiessigen „squares“ gewitzt seinen Individualismus entgegenzusetzen, dessen Genese nach Mailer einer ganz speziellen „ménage-à-trois“ zu verdanken ist, die sich in den Bars und den Kaschemmen heruntergekommener Vergnügungsviertel in den amerikanischen Großstädten gefunden hatte, eine Verbindung zwischen weissen urbanen Bohemiens, jugendlichen Kriminellen und jungen Afroamerikanern, wobei letztere die grösste und entscheidende Mitgift in diese Verbindung miteinbrachten, ihre kulturellen Leistungen und Vermögen, wie natürlich den Jazz, aber auch ihren Slang, den „Jive oder Hip Talk“, eine Art Code, den nur Eingeweihte verstanden, dann aber auch noch etwas anderes und ganz Entscheidendes, und das man vielleicht, wenn auch ein wenig euphemistisch, das „Know-How der Unterdrückten“ nennen könnte. Wenn Mailer feststellt, dass totalitäre und teiltotalitäre Gesellschaften unterschiedliche Anforderungen an den Mut ihrer Nonkonformisten stellt, da die Lebensangst unterschiedlich ausgeprägt sein muss, so trifft dies auf die schwarzen Amerikaner der 1940er und 1950er Jahre natürlich in einem besonderen Masse zu, da ihnen nicht nur aufgrund der offiziellen Rassentrennung die vollen Bürgerrechte verwehrt blieben, sondern sie auch in ihrem Alltag regelmässig dem zuweilen brutalen Rassismus der weissen Mainstreamgesellschaft ausgesetzt blieben, und somit den Hass, der in den Jahren der antikommunistischen Hetze der Truman und Eisenhower-Jahre den weissen Nonkonformisten entgegenschlug, bereits seit fast 200 Jahren schmerzhaft gewöhnt waren, da für sie die USA immer schon ein totalitärerer Staat waren als der vermeintlich freiheitliche Staat, der ihren weissen Gleichaltrigen erst jetzt ins totalitäre Rutschen geriet.
Das Amerika der 1950er Jahre waren in diesem Sinne eigentlich zwei Amerika, ein Amerika, in welchem die weissen Nonkonformisten als freie Bürger aufgewachsen waren, das sich aber in der Zeit der McCarthy-Ära für sie zunehmend zu jenem „anderen“ Amerika auswuchs, dem Amerika, das deren Einwohner, die unterdrückten Nachfahren der Sklaven, in vielen vielen Jahren als ein „totalitäres“ Amerika schon bestens gelernt hatten. Genug Zeit also, um eine Lebenseinstellung oder eine Lebensstrategie zu entwickeln, die zum Zeitpunkt des Durchbruchs des Bebops, der schwarzen Kulturleistung, die zum ersten Mal eine Art Abwehrmechanismus gegen weisse Plagiatisierung und Vereinnahmung mit einbedacht hatte, nämlich die Flüchtigkeit der spontanen Improvisation, wahrscheinlich auf ihrem Zenit stand, da die „Ekstase des Jetzt“, die Zelebration des genialen und flüchtigen Moments dem „lebensintensiven“ Augenblick unglaublich viel Wert beimessen musste, eben weil man als schwarzer Amerikaner in Zeiten des offenen Rassismus, des Hasses und der Gewalt nie wirklich wissen konnte, ob, und wenn ja wie viele Momente dieser flüchtigen Lebensintensität noch folgen würden.
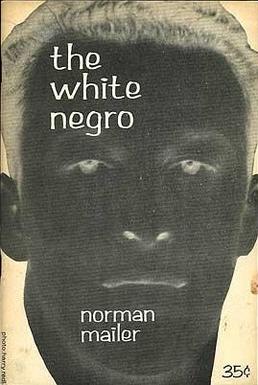
Norman Mailer war – wie wir alle – ein Kind seiner Zeit und deshalb in seiner ureigenen Zeit gemessen an den Maßstäben unserer Zeit jemand, den man heute einen „strukturellen“ Rassisten nennen könnte, selbst wenn man gnädig ein „wider Willen“ anfügen dürfte. Mailer bewegte sich zwar in intellektuell-progressiven Kreisen, die jedoch 1957 noch nicht sensibilisiert genug waren, um moralische Bedenken entwickelt zu haben, bestimmte Klischees, Vorurteile oder Begriffe wie „Neger“ zu verwenden, die uns heute empören. Dennoch enthält sein Essay einige sehr luzide Gedanken, die sich in der sozio-historischen Analyse in ihrem vollen Umfang nur aufschlüsseln lassen, wenn die deutsche Übersetzung möglichst nahe am amerikanischen Original bleibt, was bei einer akkuraten Quellenanalyse grundsätzlich immer und selbstverständlich der Fall sein sollte, auch wenn die Lektüre dann mitunter schmerzt. So bemerkt Mailer zu der alltäglichen Lebenssituation der Afroamerikaner seinerzeit:
„Jeder Neger, der leben will, lebt von seinem ersten Tag an mit der Gefahr. Kein Neger kann eine Strasse mit der selbstverständlichen Sicherheit herunter schlendern, dass ihm nicht irgendwo auf seinem Weg Gewalt begegnen werde. Die formelhaften Beschwörungen der Sicherheit für den durchschnittlichen Weissen: die Mutter und das Zuhause, der Job und die Familie, sind noch nicht mal ein Hohn für Millionen Neger, sie sind schlichtweg unmöglich. Der Neger hat die einfachste aller Alternativen: lebe ein Leben voller Demütigung oder ein Leben in steter Gefahr. In so einer Lage, in der Verfolgungswahn genauso überlebenswichtig ist wie Blut, überlebte der Neger nicht nur, sondern begann sogar sein Haupt zu erheben, indem er den Bedürfnissen seines Körper folgte, wo er nur konnte. In jeder Faser seiner Existenz wissend, dass das Leben Krieg war, nichts als Krieg, konnte sich der Neger die verfeinerten Verklemmtheiten der Zivilisation selten leisten und bewahrte sich so die Überlebenskunst des Primitiven, er lebte in der ungeheuren Gegenwart, er existierte allein für die Kicks seiner Samstagnacht, wobei er den drängenderen körperlichen Freuden den Vorzug vor den geistigen gab. Und in seiner Musik verlieh er dem Charakter als auch der Qualität dieser seiner Existenz Ausdruck, seinem Zorn und den unendlichen Variationen der Freude, der Lust, der Verlorenheit, des Grollens, der Verkrampfung, der Umklammerung und der Verzweiflung seines Orgasmuses. Denn Jazz ist Orgasmus, er ist die Musik des Orgasmus, des guten als auch des schlechten, und so richtete er sich an eine ganze Nation, und zwar in der Sprache der Kunst, und selbst wenn er verwässert wurde, pervertiert, korrumpiert oder beinahe umgebracht, so sprach er egal in welcher populär weichgespülten Version dennoch immer von den existentiellen Zuständen in der Flüchtigkeit des Augenblicks, was jetzt auch von einigen Weissen so verstanden wurde, da es eben die Sprache der Kunst war, die sie unmittelbar ansprach, und ihnen durch die Musik vermittelte: „Ich fühle so, und du tust es jetzt auch.““
Weisse Nonkonformisten übertraten eine unsichtbare Grenze zwischen den beiden Amerika, traten, nach Mailer, ein in das Amerika der Nachfahren der Sklaven und eigneten sich so die schwarze Kunst an, ein totalitäres Regime durch die Konzentration auf die Existenz im Augenblick zu „unterleben“:
„Ein neuer Menschenschlag von Abenteurern, urbane Abenteurer, die des Nachts auszogen, um mit dem Kompass des schwarzen Mannes nach aufregenden Erfahrungen und Erlebnissen zu suchen, die ihnen eine neue Realität eröffnen sollten. Der Hipster absorbierte somit die existentialistischen Synapsen des Negers, und kann deshalb praktisch als weisser Neger angesehen werden.“
Und diese radikale Art des Existentialismus zu leben, die absolute Hinwendung auf die eigenen Bedürfnisse im Augenblick, deren Erfüllungen es ermöglichen sollen, die eigene Existenz mit allen Sinnen und so intensiv wie irgendmöglich zu fühlen, sich selbst zu spüren, ist es für den Hipster nach Mailer zwingend notwendig, seine eigenen Bedürfnissen und Emotionen kennenzulernen, sie zu ergründen und zu erforschen, was letztendlich nichts anderes bedeutet als die Überformungen der Zivilisation an sich selbst Schicht für Schicht abzutragen, denn ein überzivilisierter Mensch, so Mailer, kann höchstens vorgeben ein Existentialist zu sein, wenn es gerade „chic“ ist, Existentialist zu sein, doch wird er diesen Status sogleich für den nächsten Chic opfern. Nach Mailer enthält diese Hinwendung auf die Gegenwart, deren maximale sinnliche Auskostung, auch eine religiöse Komponente, da sie nur möglich wird angesichts der tatsächlich empfundenen Bedrohung durch den Tod, die dieser Hinwendung die maximale emotionale Tiefe geben soll, welche den Hipster auch vom „überzivilisierten Poser“ unterscheidet. Der Hipster „fühlt“ den durch die jederzeitige Möglichkeit des Todes gegebenen Auftrag, seiner Existenz die grösstmögliche emotionale Erfüllung im „Jetzt“ zu geben. Sein durch den möglichen Tod gestifteter Lebens-Sinn ist das Erforschen, Erkennen und Annehmen seiner ureigenen emotionalen Bedürfnisse und deren Erfüllung in der unmittelbaren Gegenwart, da er diese Befriedigung nicht auf Morgen verschieben kann, eben weil er um die Möglichkeit weiss, dass es keinen weiteren Morgen geben könnte. Der Hipster der späten 1940er und 1950er Jahre kann sein „Leben“ nicht auf „später“ vertagen, er muss es „ jetzt“ leben und um diesem Leben in der möglichen Kürze der Zeit die grösstmögliche Intensität zu geben, muss er für sich auch herausfinden, was ihm die intensivsten Erlebnisse und Erfahrungen sein könnten. Mailer schreibt:
„Um ein Existentialist zu sein, muss man in der Lage sein, sich selbst zu fühlen – muss man seine eigenen Sehnsüchte, seine eigenen Zorn, seinen eigenen Schmerz kennen, muss man sich über den Charakter der eigenen Frustration bewusst sein und wissen, was sie überwinden könnte. (…) Um ein wirklicher Existentialist zu sein (…), muss man religiös sein, muss man einen eigenen Sinn für das „Ziel“ haben – was immer dieses Ziel auch sein mag – aber ein Leben, das durch den eigenen Glauben an die Notwendigkeit der intensiven sinnlichen Erfahrung geleitet wird, ist ein Leben, welches allein der Überzeugung verpflichtet ist, dass die eigentliche Grundlage der Existenz die Suche ist, die zu einem bedeutungsvollen aber mysteriösen Ende führt; es ist unmöglich, solch ein Leben zu führen, wenn nicht die eigenen Gefühle ihre tiefste Überzeugung beisteuern.“
In diesem Sinne versteht Mailer den Hipster auch als einen philosophischen Psychopathen, der anders als der wirkliche und diagnostizierte Psychopath, welcher an einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet, die, zumindest laut Wikipedia „mit dem weitgehenden Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht.“, das tut, was er tut, weil er es tun will, da er sich im Gegensatz zum Psychopathen mit den Gründen oder den Motiven seines Verhaltens auseinandergesetzt hat. Der Hipster ist, wenn man so will, ein Egomane aus Prinzip, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, er verschwendet kein Mitgefühl gegenüber den „squares“, denn diese sind für ihn noch nicht einmal bemitleidenswerte Spiesser, er lehnt soziale Verantwortung ab, da er nicht eingewoben sein will in das soziale Geflecht der Mainstreamgesellschaft, die von ihm zuallererst Anpassung verlangen würde, und er kann im herkömmlichen Sinne gar kein Gewissen haben, da es ja dieses zivilisatorische Über-Ich war, das er mit als erstes über Bord werfen musste, weshalb er, so Mailer, die gut-bürgerlichen Moralvorstellungen durch die Moral des schwarzen Mannes ersetzt, „…der nicht so privilegiert war, seine Selbstwertschätzung aus der vollmundigen Verkündung der kategorischen Verdammnis zu ziehen…“ und welcher von der ehemaligen Sklavenhaltergesellschaft gezwungen wurde, in dem ihm zugewiesenen sozialen Bodensatz eine ganz spezielle Moral zu entwickeln, der vom weissen braven Durchschnittsbürger schon immer „… automatisch als kriminell oder böse oder unreif oder morbid oder selbstzerstörerisch oder verdorben…“ verdammt wurde. In diesem Bodensatz der Kriminellen, Zuhälter, Prostituierten und Drogenhändler entwickelte er eine eigene Moral, eine ethische Differenzierung zwischen „gut“ und „böse“, die sich allein in der sozialen Interaktion alltagspraktisch bestimmt, denn das Leben versteht der Hipster als eine Kette von Wettbewerbssituationen zwischen Menschen, in welchen sich das „Gute“ oder das „Böse“ im gewonnenen „Kick“ oder der erlittenen Frustration herausschält. Ernest Hemingway, der, laut Mailer, neben D. H. Lawrence und Wilhelm Reich einer der geistigen Väter der Hipster sein könnte, wenn sie ihn denn je gelesen hätten, trifft das „Moralverständnis“ der Hipster vielleicht am besten, wenn er feststellt, dass einem Mann das am besten entspricht, was ihn sich gut und männlich fühlen lässt, und dass deshalb dasjenige, was einen Mann sich gut fühlen lässt, das Gute schlechthin sein müsse. Was, so schliesst der deutsche Jazz-Experte Joachim-Ernst Behrend in seinem Essay „Hip“, der 1962 erschien, so ziemlich genau die Philosophie des Hipsters sein könnte, wenn der denn überhaupt jemals ein Interesse an Philosophie gehabt hätte. Ein Hipster aber, der sich „gut“ fühlt, der „swingt“ und es versteht, seinen Bewusstseinszustand im „Swing“ zu halten, indem er lernt, auch in den nächsten Situationen der Bewährung, seien diese eine Messerstecherei oder ein Liebesakt, zu bestehen und eine grösstmögliche sinnliche Erfahrung aus ihr zu ziehen, eröffnet sich nach Mailer eine immer grössere Chance „im Einklang mit dem Swing“ oder im Jive Talk formuliert: „with it“ zu sein:
„Aber „with it“ zu sein, bedeutet die Gnade erfahren zu dürfen, näher an den Geheimnissen des inneren unterbewussten Lebens zu sein, das dich nähren wird, wenn du „it“ hören kannst, du wirst dann dem Gott näher sein, von dem jeder Hipster glaubt, dass er irgendwo in den Sinnen seines Körpers wohnt, dieser gefangen gehaltene, verstümmelte und dennoch grössenwahnsinnige Gott, der It ist, der Energie, Sex und Kraft ist (…); nicht der Gott der Kirchen, sondern das unerreichbare Versprechen des Geheimnisses, das im Sex liegt, das Paradies der grenzenlosen Energie und des Empfindens jenseits der nächsten Welle des nächsten Orgasmus.“
In diesem Sinne betrachtet und beurteilt der Hipster seinen Mitmenschen nicht als „gut“ oder „böse“ in ethischer Hinsicht, sondern vielmehr als eine „Kollektion von Fähigkeiten“, wobei einige dieser Fähigkeiten besser entwickelt sind als andere, und wiederum einige Menschen als kompetenter angesehen werden, mehr Fähigkeiten in kürzerer Zeit für sich zu entwickeln, vorausgesetzt, sie verfügen über den speziellen Charakter, der sie zur rechten Zeit „swingen“ lässt. Hier offenbart sich, nach Mailer, auch das besondere Hipster Verständnis von „Charakter“. Für den Hipster ist der Kontext einer Bewährungssituation immer wichtiger als der handelnde Charakter, da der Kontext, die Umstände, die Bewährungssituation dominieren, in welcher der Charakter handeln muss, ohne den Kontext signifikant verändern zu können. Und da es nunmal ungleich fordernder ist, selbst eine belanglose Bewährungssituation in einem ungünstigen Umfeld zu bestehen als in einem günstigen, versteht sich der Hipster gleichzeitig nicht nur als seinen Charakter, sondern auch als seinen Kontext, denn egal wie die Bewährungssituation schliesslich ausgehen wird, ob als Erfolg oder Versagen, wird dieser Ausgang Auswirkungen auf seinen Charakter haben und somit auch den Ausgang der nächsten Bewährungssituation im nächsten und anderen Umfeld beeinflussen. Da der Charakter oder die Persönlichkeit aber durch den Hipster als ständig ambivalent und dynamisch verstanden wird, gibt es nichts Festes in der Welt, keine unumstösslichen Wahrheiten oder Gesetzmässigkeiten mehr, die immer Geltung besitzen, sondern nur noch das, was der Hipster auf dem immerwährenden Klimax der Gegenwart fühlt. Daraus muss dann fast zwangsläufig die Negierung der herrschenden gesellschaftlichen Werte und somit die Befreiung des Hipster-Selbsts vom Über-Ich folgen:
„Die einzige Hip-Moral (und natürlich ist das eine immer gegenwärtige Moral) ist es zum einen, zu tun, was man fühlt, wann immer und wo immer es möglich ist, und zum anderen – hier beginnt der Krieg zwischen dem Hip und den Squares – sich in die Mutter aller Schlachten zu werfen: um die Grenzen des Möglichen für sich selbst zu erweitern, für sich selbst allein, und nur weil es einem das ureigene Bedürfnis ist.“
Eine Moral, die sich im Kern auf die zwei Prinzipien „Erkenne-Dich selbst“ und „Sei-Du-selbst“ reduziert und welche die Gegenwart bis zum Exzess vergöttert, übertrifft, so Mailer, in ihrem Anspruch sogar die Ansichten des Marquis de Sade über Sex, Privateigentum und die Familie, wonach alle Männer und Frauen zumindest zeitweise den berechtigten Anspruch auf die Körper aller anderen Männer und Frauen hätten. Es ist dieser gefühlte Nihilismus des Hip, der in letzter Konsequenz gedacht, alle sozialen Schranken und Kategorien auslöschen würde, der, just als der Glaube in die Menschheit in den Gaskammern und atomaren Schmelztiegeln verlorengegangen ist, ein romantisches Bild des freien Primitiven in dem Dschungel der immerwährenden Gegenwart heraufbeschwört. Und es ist dieser wildromantische Nihilismus des Hip, der die Menschen, endlich befreit von den mordenden Autoritäten der Staaten, die doch einst gegründet wurden, um den Menschen vor dem Menschen zu schützen, ein Versprechen, das im Zweiten Weltkrieg so furchtbar und mehrfach gebrochen worden ist, nach Entkleidung der Fesseln der Zivilisation sich selbst zurückgeben will. Das ist nicht nur mutig, weil sich der Hipster als radikalster Nonkonformist so gegen jede gesellschaftliche Norm stellen muss, sondern auch mutig, weil er seine Jugend und seinen Glauben dem Ungewissen aussetzt und eigentlich aufgrund der Ungeheuerlichkeit seines Anspruchs nur scheitern kann, und letztlich unglaublich naiv, da er dem Nihilismus des Hip unterstellen muss, dass in ihm die Kreativität obsiegen statt dass – was letztlich viel wahrscheinlicher ist – im Dschungel der immerwährenden Gegenwart das Recht des Stärkeren, Gewalttätigeren, die Autorität des Staates furchtbar ersetzen wird.
Nach Mailer gibt es in den USA des Jahres 1957 bei von ihm geschätzten 10 Millionen Psychopathen nicht mehr als etwa hunderttausend Männer und Frauen, die sich bewusst als Hipster bezeichnen würden. Eine kleine Minderheit also unter insgesamt 170 Millionen Amerikanern, die Mailer jedoch hellsichtig als eine Elite oder als gesellschaftliche Avantgarde begreift, welche die zukünftige Entwicklung des Landes massgeblich beeinflussen könnte. In welchem Ausmasse, ob friedlich oder gewalttätig, ist er sich nicht sicher. So könnte mit der völligen Gleichberechtigung der Afroamerikaner die bisher selbstbezogene „Bewegung“ des Hip, gewappnet mit dem Knowhow der schwarzen Unterdrückten und verfeinert durch die verdreht-elaborierten Raffinessen der urbanen Bohemiens, sich zu einer Rebellion auswachsen, deren sexueller Impetus auf die anti-sexuellen Reflexe des amerikanischen Establishments prallen würde, was wiederum eine gesellschaftliche Gegenreaktion zur Folge hätte und in der Zuspitzung ein Klima des Hasses mit massiven Interessenkonflikten, sodass der herrschende und geheuchelte Konformitätszwang zwangsläufig kollabieren müsste. „Eine Zeit der Gewalt, der neuen Hysterie, der Verwirrung und Rebellion wird dann wahrscheinlich die Ära der Konformität ablösen.“ Denn obwohl die Hipster vergleichsweise wenige sind und sie in ihrem hedonistischen Selbstbezug auch keinerlei Interesse daran haben, zu „missionieren“, übt neben ihrem „Underground-Appeal“ durch Habitus und Gestus auch ihre Sprache eine anziehende Wirkung auf die amerikanischen adoleszenten Jugendlichen auf, die diese gewissermassen instinktiv verstehen, da sich der intensive Lebenshunger der Hipster mit ihrem Verlangen nach Leben und ihrer Sehnsucht nach Rebellion deckt. Dass die Sprache des Hip, hervorgegangen aus dem Jive-Talk der Jazzer, neben ihrem besonderen Charakter als Insider-Code für die Mitglieder einer Avantgarde trotzdem und auch eine besondere Wirkmächtigkeit in der Zeit entfalten sollte, ist dennoch ein von Mailer wohl kaum beabsichtigter „Clou“ des Essays „The White Negro“, der nicht zuletzt durch die erste deutsche Übersetzung des Essays sehr anschaulich offenbart wird, die bereits 1959 in „Reklame für mich selber“ im Herbig Verlag erschien. Mailer verwendet im Originaltext durchgängig immer wieder einige Begriffe des Hip, er widmet ihnen auch einen ganzen erklärenden Abschnitt. Diese Passagen sind in der deutschen Ausgabe überwiegend unbrauchbar übersetzt, der erklärende Abschnitt fehlt in der deutschen Übersetzung völlig. Offensichtlich hatten die damaligen Übersetzer grosse Probleme mit der richtigen Deutung scheinbar einfachster englischer Wörter, da ihnen der Kontext fehlte, den der Essay Mailer zwar mitlieferte, den sie aber nicht zu deuten verstanden, weshalb sie den Originaltext „lehrbuchgemäss“ übersetzten und somit mitunter munteren Nonsens fabrizieren mussten. Die Deutung und das Verständnis des „Hip“ ist extrem kontextabhängig, da die richtige Deutung eines Begriffes sowohl eine Bedeutung als auch deren Gegenteil sein kann, je nachdem, wie der Begriff betont, welchen Gestus seine Aussprache begleitet oder welcher schriftliche Kontext notiert worden ist, der richtig interpretiert werden muss. Und das wirklich Verblüffende und auch Beeindruckende ist, dass heutigen deutschen Lesern die Übersetzung eines über 60 Jahre alten us-amerikanischen Textes, der unter Verwendung des Hip entstand, viel leichter fällt als den deutschen Übersetzern vor 63 Jahren, nicht weil wir heute den Kontext vielleicht besser kennen, sondern weil uns einige Begriffe des „Hip“, dessen Vor-, Vor-, Vorläufer einst aus Westafrika als „chippie“ aufgebrochen ist, schon lange in Fleisch und Blut übergangen sind, da wir diese Begriffe als Anglizismen in ihrer richtigen „Hip-Bedeutung“ als auch ihrer „Doppelbödigkeit“ längst eingedeutscht haben, Begriffe wie „cool“, „crazy“, „flip“, „dig“ und natürlich „hip“, aber auch „action“, den die ersten deutschen Übersetzer von Mailers „The White Negro“ mit „Handeln“ oder „Handlung“ übersetzten und von dem wir heute wissen, dass dieser Begriff gerade in diesem Kontext doch immer nur „Äktschn!“ meinen kann.
Norman Mailer sollte Recht behalten, auch wenn er selbst später einräumte, in seinem Essay einige Facetten des Hipstertums übertrieben oder auf die Spitze getrieben zu haben: Ab diesem dem Heute so seltsam nahen Damals, 1957, hatte jede neue Generation in den USA (und nicht nur dort) eine Wahl: Entweder man war Hip oder man war Square – entweder Rebell oder Konformist.
Und der Witz ist, dass das Hipster-Ding zu dem Zeitpunkt, 1957, als Mailer endlich davon Notiz nahm, es also gewissermassen an die Mainstream-Oberfläche blubberte, es eigentlich als Avantgarde-Phänomen schon längst durch war.
VII. Beat
Am 5. September 1957 erschien „On the Road“, ein Roman, der bereits 6 Jahre zuvor geschrieben worden war, angeblich in nur drei Wochen in die Schreibmaschine gehämmert, um dann doch in den darauffolgenden Jahren unveröffentlicht zu bleiben, bevor er endlich, in den Jahren immer wieder verändert, gekürzt oder ergänzt, doch einen Verleger fand, und der trotz der bis heute umstrittenen Qualität zu einem, wenn nicht sogar zu dem wirkmächtigsten literarischen Werk der Nachkriegszeit überhaupt werden sollte. Der Autor Jack Kerouac hatte die „literarische Bewegung“ der von ihm so genannten „Beat Generation“ mitbegründet, die beileibe aus keiner Generation bestand, sondern aus einem kleinen Haufen mehr oder weniger Gleichgesinnter, dessen harter Kern sich wiederum eigentlich auf nur drei Männer reduzierte: Jack Kerouac, Sohn franko-kanadischer Eltern römisch-katholischen Glaubens, geboren und aufgewachsen in kleinbürgerlichen Verhältnissen einer Kleinstadt in Massachusetts; Allen Ginsberg, Sohn einer jüdischen Familie, aufgewachsen in bürgerlich-akademischen Verhältnissen einer Kleinstadt in New Jersey; William S. Burroughs, Spross einer Industriellen-Familie, geboren und – bis auf einen etwas missglückten Internatsaufenthalt in Alamos – aufgewachsen in grossbürgerlichen Verhältnissen in St. Louis. Alle drei, nach Herkunft und noch überschaubarer Vita aber so was von Anti-Hipster, lernten sich vermittelt durch einen gemeinsamen Bekannten gegen Ende des Weltkrieges in New York City kennen; wohin es Jack Kerouac aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten als Running Back des Lowell High School Football Teams verschlagen hatte, die den Talentscouts der Columbia Universität nicht verborgen geblieben waren; wo Allen Ginsberg, ebenfalls Student der Columbia, von einer Karriere als Dichter träumte und wo Burroughs, zehn beziehungsweise zwölf Jahre älter als Kerouac und Ginsberg, die beide damals so Anfang 20 waren, bereits mit einem Harvard-Diplom in der Tasche und ausgestattet mit einer grosszügigen monatlichen Apanage seiner Familie, im Begriff stand – nun ja – eine ziemlich entspannte Drogenkarriere zu starten. Und wenn man als Greenhorn in NYC damals im Begriff stand, eine ziemlich entspannte Opiatabhängigkeit zu starten, war die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, Herbert Huncke kennenzulernen, denn eine ziemlich entspannte Drogenkarriere erfordert nunmal die Bewältigung gewisser logistischer Schwierigkeiten, ein Metier, das seinerzeit nur wenige so gut beherrschten wie eben besagter Herbert Huncke, der „Bürgermeister des Times Square“, dem Revier der Hustler. Huncke war Junkie, Stricher, Dealer, Einbrecher, Schnorrer, Dieb, Hehler, aber vor allem war er Hipster, und verfügte so über die nötige Portion abgehangene „Street Wisdom“, die für alle drei Exponenten der zukünftigen „Beat Generation“, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen von Interesse sein sollte. Für Burroughs, weil dieser stets hip gekleidete und mit ausgesuchten Umgangsformen ausgestattete Huncke ihm nicht nur das kleine ABC der Junkies vermitteln sollte. Für Ginsberg, der in diesen seinen jungen Jahren einen ausgeprägten Rimbaud-Fimmel entwickelte, ein zuweilen häufiger vorkommendes postpubertäres Phänomen, und nicht nur deshalb, sondern auch weil er – das muss man ihm lassen – eine untrügliche Nase für den Zeitgeist besass, fest davon überzeugt war, dass genau jetzt, fast unmittelbar nach dem Ende des Krieges, nach Hiroshima und Nagasaki, nach Auschwitz, ein neues Zeitalter heraufdämmerte, welches alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen würde, weshalb er unermüdlich nach Anzeichen oder Indizien für das Heraufdämmern dieser neuen Zeit, dieser neuen Welt, dieser neuen Menschen suchte, und genau dieser seltsame Underground-Dandy Huncke mit seinen hippen Klamotten, seinem modischen Äusseren, seinen gepflegten Umgangsformen, seiner Vorliebe für diese seltsame Musik, den Bebop, seiner persönlichen Bekanntschaft zu Billie Holiday, Charlie Parker, Lester Young und anderer Grössen des Jazz – kurz – seinem ganzen elaborierten und raffinierten Stil oder Habitus nach, der in krassem Kontrast zu seiner anrüchigen „Erwerbstätigkeit“ in der Gosse stand, ein ziemlich fettes und faszinierendes Indiz für eine neue Welt war, die inmitten der alten wie eine Blume des Bösen erblühte. Auch Kerouac teilte diese Faszination, wenn auch weniger intellektuell gefiltert wie bei Ginsberg, sondern mehr emotional verstehend, dass Hunke, dieses seltsame Wesen, der Schlüssel zu einer sehr exklusiven und aufregenden Erfahrungswelt, der absonderlich fremden Welt der Hipster, sein könnte, die sich jungen Nachwuchsschriftstellern aus dem verträumten Neuengland nicht so ohne Weiteres öffnen würde, es sei denn, sie vertrauten einem Insider, der sie in diese fremden Gefilde einführte, ihnen ihr Innerstes offenbarte, ihnen ihre Sprache und Regeln erklärte. Und Huncke erfüllte ihre Erwartungen, sein Schaden sollte es gewiss nicht sein, er setzte Burroughs höchstpersönlich den ersten Schuss Morphium, versorgte die „Beat Generation“ mit allen möglichen Drogen und zeigte, erklärte ihnen seine Welt. In den 1990er Jahren erinnert sich Huncke in einem Interview mit dem deutschen Journalisten Alfred Hackensberger an diese Zeit:
„Um es auf einen Nenner zu bringen, sie waren doch alle zusammen einfache, brave Studenten, die in sehr wohlbehüteten Verhältnissen aufgewachsen sind und in völlig anderen Gegenden als ich zu Hause waren. Sie waren eine eng verbundene Gruppe intellektueller Studenten, die daran interessiert waren, einen Unterwelt-Typen kennenzulernen. Sie haben wirklich viel Zeit damit verbracht, sich den Kopf über mich zu zerbrechen. Ich bin mir sicher, sie hatten viele Lösungsvorschläge entworfen, wie ich mein Leben ändern, es in den Griff bekommen könnte. (…) Außerdem musste ich ihnen Drogen besorgen, zu denen sie am Anfang keinen Zugang hatten. Danach wollten sie unbedingt einige kriminelle Tricks erlernen oder auch dabei zusehen, wie ich klaute. Na ja, und Anweisungen, wie man sich in der Unterwelt zu verhalten hatte, welche Regeln, Gesetze es gab, und natürlich wollten sie alles über die Sprache wissen, die dort gesprochen wurde. Wie und was ich ihnen erzählte, war in vielerlei Hinsicht völlig neu für sie. (…) Keiner von denen musste sich als 15jähriger Bengel die geringsten Sorgen um das Essen auf seinem Teller machen, geschweige denn über das Bett, über das Haus, in dem sie schliefen. Wahrscheinlich dachte keiner in diesem Alter darüber nach, wie er am besten sein eigenes Leben führen könnte. (…) Von zu Hause auszureißen, um ein freies selbstbestimmtes Leben zu führen, war höchstens ein Thema, das sie in irgendwelchen Büchern nachlasen. Wie Burroughs etwa, der vom Gangsterleben träumte, nachdem er doch diese Biographie, wie hieß sie noch mal… ach, ist ja auch egal, jedenfalls träumte er davon, ein Gangster zu werden, ein Mann der Unterwelt. Und tatsächlich trieb er sich als 32jähriger aus gutem Hause hier in New York in der untersten Klasse der Unterwelt herum. Und das ausgerechnet mit meinem damaligen Kumpel, Phil White, um in der U-Bahn spät nachts Leichen zu fleddern. Für mich war das alles ja nichts Besonderes, Autos aufzubrechen, in ein Haus einzusteigen, mit Drogen aller Art zu dealen, auf den Strich zu gehen, wenn man kein Geld für ein Hotel, (sic!) hatte in einem 24-Stunden-Kino zu schlafen oder auf Benzedrin in einem Automatencafé den nächsten Tag zu erwarten. Und das alles von Stadt zu Stadt, über Tage, Wochen, Monate, Jahre, Tausende von Meilen kreuz und quer durch das Land, von Chicago nach Los Angeles, St. Louis, New Orleans, Austin, San Diego, Miami und was weiss ich noch wohin als Tramper. Kein Wunder, wenn man da nur an Jack Kerouacs Roman „On the Road“ denkt, dass diese Studenten sehr beeindruckt gewesen sein müssen und viel Zeit damit verbrachten, über mich und mein Leben zu diskutieren. Andauernd wurde ich irgendwelchen Leuten vorgestellt, oder sie stellten mir irgendwelche Leute vor, an die ich meistens, bereits eine Sekunde später, nicht mehr erinnerte. Kaum einer der Jungs hat es richtig bemerkt – plötzlich war ich ein fester Bestandteil der Szene. Was diese Studenten damals so faszinierte, weiss ich bis heute nicht genau. Natürlich waren sie davon begeistert, einen Typen aus der Unterwelt zu kennen, den man regelmässig trifft. Bekannten konnte man ihn sogar als „Freund“ vorstellen, dabei mit den Augen zwinkern und deutlich machen, „He, Kumpel, wenn du etwas brauchst, Drogen, Waffen oder sonst etwas, kein Problem. Ich habe beste Kontakte.“, wobei mir mehrfach auf die Schulter geklopft wurde. Über ihre Beziehungen zur Unterwelt kamen sie sich richtig hip vor. Sie dachten, dadurch würden sie sich deutlich von der bürgerlichen Welt unterscheiden.“
(Alfred Hackensberger: I AM BEAT)
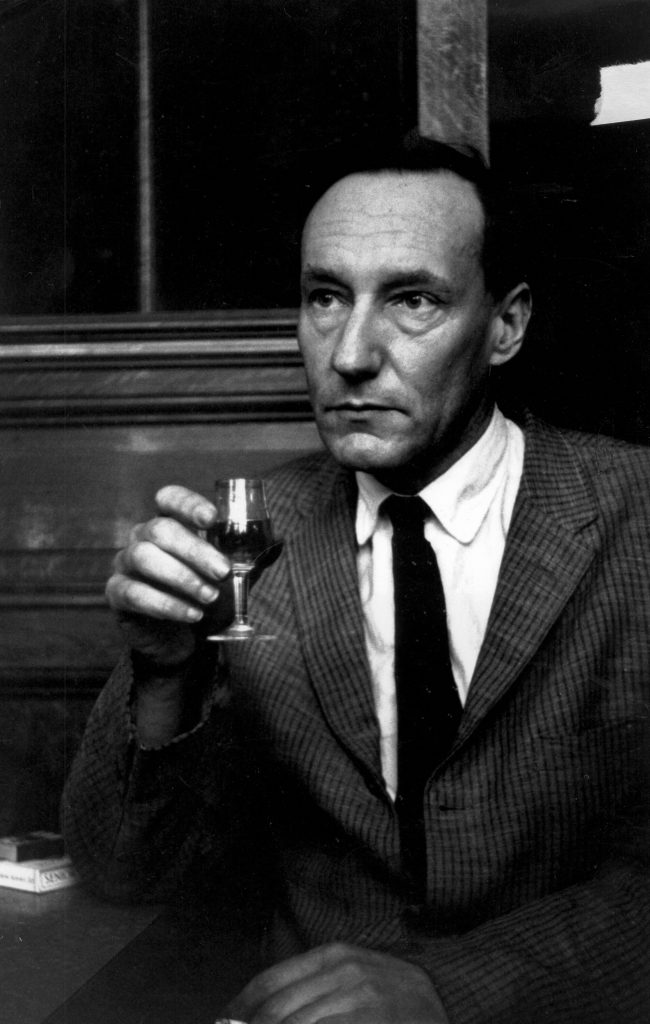
William S Burroughs im Café des Beat Hotels, Paris. Frühe 1960er Jahre
Herbert Huncke war gegen Ende des Krieges, als er zunächst Burroughs und dann die anderen Mitglieder der zukünftigen „Beat Generation“ kennenlernte, 30 Jahre alt, also im gleichen Alter wie Burroughs, aber 10 Jahre älter als Ginsberg und die meisten anderen Beats. Einziger Spross einer Mittelstandsfamilie, aufgewachsen in Chicago, riss er im Alter von 12 Jahren von zu Hause aus und lebte fortan auf der Strasse, streifte als Hobo durch die USA, bestritt seinen Lebensunterhalt und Drogenbedarf durch Kleinkriminalität und Prostitution, bis er 1939 In New York „sesshaft“ wurde, wo er sich schnell in dem Unterwelt-Milieu der Hustler, Drogensüchtigen, Dealer, Prostituierten und Gauner der 42nd Street und des Times Square als feste Grösse etablierte. Auch bedingt durch seine Drogenabhängigkeit, erhielt er schnell Zugang zu der jungen Jazz-Avantgarde, die sich Mitte der 1940er Jahre formierte und deren Protagonisten nicht selten drogenabhängig waren, seinerzeit ein schwerwiegendes Vergehen, das von der Justiz hart sanktioniert wurde, und sich somit im selben konspirativen Teufelskreis zwischen Drogen- und Geldbeschaffung wie Huncke bewegte. Mit dem damals noch unbekannten Tenorsaxophonisten Dexter Gordon geht Huncke auf Diebestour, bricht Autos auf und plündert die Mäntel in den Garderoben der Restaurants und Bars, dennoch ist sein Interesse an der neuen Musik, an den Musikern nicht auf den gemeinsamen Drogenkonsum beschränkt. Huncke ist gewissermassen zur rechten Zeit am richtigen Ort und bekommt so die Entwicklung des neuen Stils im Jazz hautnah mit, lange bevor der Bebop populärer werden sollte. Er wächst als einer der wenigen Weissen in die Szene hinein und erhält somit einen ganz unmittelbaren Zugang zu dieser Avantgarde und ihrer Musik, die ihm zum Sound seiner Lebenswelt werden sollte. Huncke ist – und nicht nur nach Mailers Lesart – ein Parade-Hipster („White Negro“) durch und durch, der aber bei den „Beats“ tatsächlich unterschiedliche Interessen weckt. Für Burroughs ist Huncke zunächst so etwas wie der Wiedergänger von Jack Black, dessen Autobiographie „You Can’t Win“ er als 14jähriger gelesen und die ihn so beeindruckt hatte, dass es zu einer Art „Lebensbuch“ für ihn werden sollte. Jack Black war ein Hobo und Einbrecher, der in den Jahren um die Jahrhundertwende auf der Strasse lebte, wenn er nicht gerade im Knast sass. In seinem 1926 veröffentlichten Werk berichtet er ziemlich offen und differenziert von seinen Erfahrungen „on the road“, seinen kriminellen Eskapaden, seinen Erfahrungen im Milieu der Panzerknacker, seiner Drogensucht, seinen Knastaufenthalten undsoweiter. Was dieses Buch, das im Übrigen ein grosser Erfolg in den USA war und auch in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder neu aufgelegt wurde, bemerkenswert macht, ist die innere Einstellung oder die Lebens-Philosophie, die der Autor Jack Black darin offenbart. Danach war es ihm immer fremd, auch nur darüber nachzudenken, einer legalen Arbeit nachzugehen, obwohl er gewusst habe, dass sein Leben dann angenehmer und leichter verlaufen würde, denn sei er nie faul oder träge gewesen, jedoch sei eine legale Erwerbstätigkeit und ein normales Leben für ihn immer die Angelegenheit anderer Menschen gewesen. Aber auch wenn er diese Menschen nie verstanden und auch nie für ihr der Norm entsprechendes Leben verurteilt habe, so repräsentierten sie für ihn die Gesellschaft. Und die Gesellschaft war nunmal das Gesetz, war die staatliche Gewalt, war die soziale Kontrolle und war in letzter Konsequenz die unerbittliche Strafverfolgung unliebsamer sozialer Abweichung. Die Staat war für Jack Black wie eine Maschine, die darauf abgestimmt war, Menschen wie ihn, die ein radikales – und vielleicht sogar uramerikanisches – Verständnis von Freiheit hatten, in Fetzen zu schreddern: Der Staat war somit sein ganz persönlicher Feind. Jack Black war so gesehen ein „Outlaw aus Prinzip“, kein Gauner, der aus irgendwelchen traurigen Gründen auf die schiefe Bahn geraten war und sich fortan immer weiter in den Fallstricken der Normenkontrolle verstrickte oder ein Glücksritter, der dem schnellen Dollar nachjagte, ohne moralisch sichere Beurteilung der dafür notwendigen Mittel und Methoden, sondern ein Mann, der durchaus die Möglichkeiten für ein spiessiges und komfortables Leben gehabt hätte, was er später in seinem Leben auch unter Beweis stellen sollte, der sich aber reflektiert und deshalb willentlich für ein Leben in einer kriminellen Subkultur gegen das Gesetz entschieden hatte, da er das System, das dieses Gesetz repräsentierte, aus tiefstem Herzen verachtete.
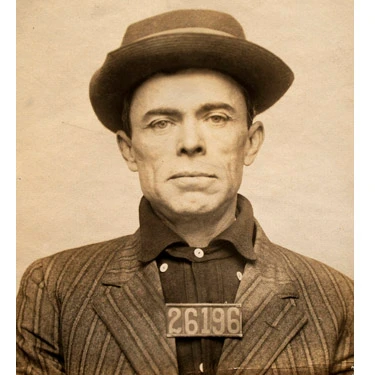
Vielleicht Jack Black AKA Tom Callahan
Jack Black war somit ein früher Vertreter der Gesetzlosen, die nach Beginn der Great Depression genannten Wirtschaftskrise 1929 eine Welle der Kriminalität in den USA auslösten, also ein Vorgänger solch illustrer Charaktere wie Bonnie and Clyde oder John Dillinger, der aber zum einen lange genug lebte und zum anderen auch intellektuell in der Lage war, das „Lebensgefühl“ eines Outlaws der damaligen Zeit literarisch zu beschreiben, was den meisten anderen aufgrund ihres vorzeitigen Ablebens und ihres oftmals überschaubaren intellektuellen Vermögens leider nicht vergönnt war. Anders als Black gerieten seine Nachfolger weniger aus „Interesse“ auf die schiefe Bahn als vielmehr durch die wirtschaftliche Not, welche die 1930er Jahre nicht nur in den USA prägten. Die „Great Depression“ waren harte Jahre der Zäsur in der Wirtschaftsgeschichte der USA. Zunächst verheissungsvolles Einwanderungsland, das sich von 1620 bis 1890 in den Jahren der „American Frontier“ auf den Spuren und Pfaden der Pioniere immer weiter nach Westen ausdehnte, und so jedem Neuankömmling ein Stück Land, ein Stück Zukunft versprach, was auch eine Art Gleichheitsversprechen beinhaltete, in dem Sinne, dass ein jeder Pionier die gleiche Chance auf eine „goldene“ Zukunft haben sollte, dann in den Jahren von 1865 bis 1914 geprägt durch eine rasante Urbanisierung und Industrialisierung, die das noch junge Land zur weltweit führenden Wirtschaftsmacht aufsteigen liess, welche nun geradezu märchenhafte Karrieren und Biographien wie die von Rockefeller, Vanderbilt und Carnegie ermöglichte, die den Mythos des „American Dream“ fast unaufhörlich befütterten, eröffneten sich in den Roaring Twenties scheinbar auch für weite Kreise der amerikanischen Bevölkerung der wirtschaftliche Horizont, die 1920er Jahre waren Jahre der Prosperität, des nicht nur finanziellen Reichtums, der aber letztlich nur auf einer riesigen Kreditblase gründete, die dann am „Schwarzen Donnerstag“ im Oktober 1929 nach Jahren des unregulierten Kapitalismus und der damit einhergehenden ungezügelten Börsenspekulationen platzte.
Als die Party vorbei war, legten sich die Jahre der Rezession wie Mehltau über das Land, der amerikanische Traum entwickelte sich für viele zum Albtraum, da man nicht nur feststellen musste, dass das Vermögen in den USA tatsächlich nicht nur sehr ungleich verteilt war, weshalb ein Grossteil der Bevölkerung nur über ein sehr geringes Vermögen bzw. Auskommen verfügte, das diesen Amerikanern nicht erlaubte, die zuvor eingegangenen Verbindlichkeiten zu bedienen, was viele das eigene Heim oder eigene Farm kosten sollte, sondern auch schmerzhaft begriff, dass das amerikanische „Momentum“, die amerikanische „Bewegung“ zum Stillstand gekommen war. Jahrhunderte war es, abgesehen von ein paar kleineren Brüchen und Sprüngen, immer nur vorwärts, immer nur weiter gegangen, erst immer weiter nach Westen und als die „American Frontier“ endlich die Küsten des Pazifik erreicht hatte, wuchs sie in Gestalt der Wolkenkratzer und Fabrikschornsteine und Aktienkurse gleichsam in die Höhe. Das war ja das eigentliche Versprechen, das die Vereinigten Staaten seinen Bürgern und Einwanderern gegeben hatten, dass das amerikanische „Momentum“ immer weiter gehen werde, es immer weiter nach vorne und oben gehen müsse in diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mit der Grossen Depression wurde dieses Zukunfts-Versprechen erstmals gebrochen, das Land verharrte für Jahre im bleiernen Stillstand.
1932 waren 25% der Amerikaner arbeitslos, der grosse Rest hielt sich und die Familien mit mies bezahlten Jobs so einigermassen über Wasser, die Durchschnittslöhne waren um 60% gefallen, das landwirtschaftliche Einkommen um über 50%. 1934 setzte dann noch das ein, was man in den USA die „Dust Bowl“ nennt, eine Naturkatastrophe in den „Great Plains“, die, bedingt durch eine ungewöhnliche zehn Jahre anhaltende Dürre und der ökologisch fatalen grossflächigen Rodung des Prairiegrases, fruchtbares Farmland buchstäblich zu Staub werden liess.

Verstaubtes Land. Dallas, South Dakota, 1936
Das Volk verarmte. Mit diesem gebrochenen Versprechen auf eine verheissungsvolle Zukunft ging aber auch der Bruch eines unausgesprochenen „Gesellschaftsvertrages“ einher, den es so nur in den Vereinigten Staaten gibt und gab, da der Staat – und hier vor allem der Westen – letztlich auf den Pionierleistungen seiner zukünftigen Bürger gründete und gründet. Es waren die Pioniere, die den amerikanischen Westen nicht selten mit Waffengewalt eroberten, besiedelten, verteidigten und somit dem noch jungen Staat ein immer grösseres Territorium erschlossen. Der Pionier agierte hierbei zunächst fast vollständig im rechtsfreien Raum, war nicht selten auf sich allein und seine nächsten Angehörige gestellt und musste sich grösstenteils ohne staatliche Unterstützung bewähren. Er war somit sein eigenes Gesetz, aber auch seine eigene Exekutive, deren Legitimation allein aus den Läufen der Gewehre kam. Der Staat zog erst später nach der Inbesitznahme und Erschliessung des Landes mit seinen Strukturen nach. Und erst wenn er nachzog, ging auch das Gewaltmonopol vom Siedler auf den Staat über. Bis dahin nahm sich der Pionier mittels Waffengewalt das, was er zum Überleben brauchte nach eigenem Gutdünken und natürlich nahm er es anderen Menschen weg, denn das Land war ja nicht herrenlos, sondern im „Besitz“ der Indianer. Diese Erfahrung der „American Frontier“ als das Heroische Zeitalter der Eroberung des Westens ist ein Grundpfeiler des amerikanischen Gesellschaftsverständnisses als auch unabdingbarer Bestandteil der amerikanischen Mentalität und wird oft vergessen, wenn aus europäischer Sicht über den amerikanischen „Waffenwahn“ diskutiert wird. Im amerikanischen Westen war anders als in Europa zuerst der Pionier und dann das Gesetz und wenn er sein Gewaltmonopol – nicht seine Waffen! – an den Staat übergab, der Pionier also zum Bürger wurde, dann erwartete er selbstredend etwas dafür und das waren in erster Linie die Garantie innerer und äusserer Sicherheit, aber auch die faire Chance auf ein Leben in Wohlstand und eine Zukunft für seine Kinder. Und dieser unausgesprochene Gesellschaftsvertrag, der Verzicht auf das persönliche oder private Gewaltmonopol zugunsten staatlich garantierter Sicherheit und staatlichem Wohlstandsversprechen, wurde durch die Grosse Depression gebrochen, da die Nachfahren der ersten Pioniere sich vergegenwärtigen mussten, dass ihnen nicht nur das Gewaltmonopol, sondern auch die Aussicht auf eine sichere Zukunft genommen war, da sich die neuen Pioniere an den Finanzmärkten im ebenfalls fast rechtsfreien Raum des deregulierten Kapitalismus böse verspekuliert hatten, woran sie vom Staat aber nicht gehindert worden waren. Die USA standen somit wie alle anderen von der Weltwirtschaftskrise gebeutelten Nationen vor der Beantwortung einer Sozialen Frage, die grosse Tragweite entwickeln sollte und die in Europa zum Erstarken politisch extremer Bewegungen wie dem Faschismus oder dem Kommunismus führte. Kollektivistische kommunistische oder faschistische Bewegungen blieben in den USA der 1930er Jahren aber eher Randerscheinungen, die keine wirkliche politische Kraft entfalten konnten. Stattdessen verzeichneten die USA einen enormen Anstieg an Gewaltkriminalität, die unter anderen von Protagonisten ausgeübt worden ist, die heute noch im kollektiven Gedächtnis nicht nur der USA stark verankert sind, eben solche Figuren wie Bonnie and Clyde, John Dillinger aber auch Pretty Boy Floyd, Baby Face Nelson oder Alvin Karpis.
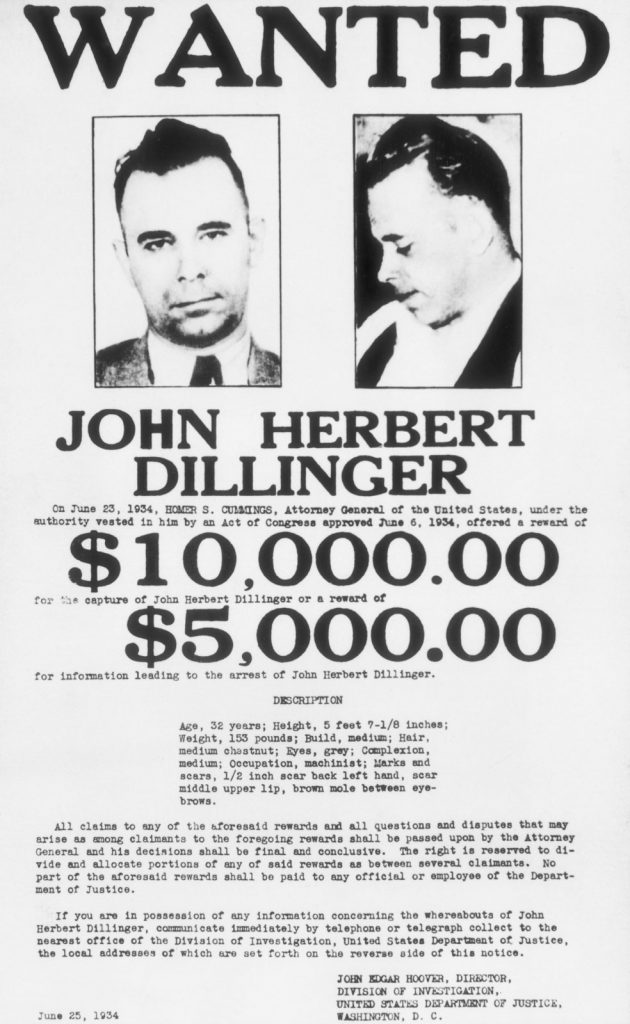
Und dass diese Kriminellen heute immer noch so präsent sind, dass sie Eingang fanden in die us-amerikanische Folklore, ist an sich schon sehr bemerkenswert, handelt es sich doch bei diesen Figuren eigentlich um ganz gewöhnliche Kriminelle, Bankräuber in der Regel, denen über ihr Kriminell-Sein hinaus – Kriminelle gab es zu allen Zeiten – nichts Ungewöhnliches anzuhaften schien. Aber es ist gerade dieses Gewöhnliche, dass diese Kriminellen zu ihrer Zeit zu etwas Ungewöhnlichem machen sollte. Sie waren eben nicht Teil der Mafia italienischer, irischer oder jüdischer Prägung in den Städten an der Ostküste, die ab 1920 nach Beginn der Prohibition vornehmlich durch Alkoholschmuggel immer reicher und mächtiger wurde, bis sie anfing wie ein Krebsgeschwür gefährlich tief in die amerikanische Gesellschaft hinein zu wuchern, sondern Individualisten, die zumeist in kleinen Banden und manchmal ohne grossen Plan und immer ohne eine hinter ihnen stehende Organisation das Gesetz herausforderten. Und deshalb verwundert es in der Nachschau nur auf den ersten Blick, dass der junge J. Edgar Hoover, der ab Mai 1924 dem FBI vorstand und sich daran machte, dieser bis dahin eher verschnarchten Truppe ein professionellere und effiziente Schlagkraft zu verpassen, ausgerechnet immer wieder Vertretern dieser vagabundierenden Banditen aus dem mittleren Westen und dem Süden und der Provinz der USA das Etikett des „Public Enemy Number One“, des Staatsfeindes Nr. 1, anheftete, während die nach ihrem Wirkungs- und Organisationsgrad eigentlich doch viel gefährlicheren Mobster der Ostküste dieser vermeintlichen Ehre seitens Hoover nie zuteil wurden. Und da wird dann immer geschrieben und behauptet, dass es Hoover in erster Linie darum gegangen sei, seiner Truppe und auch sich selbst schnellstmöglich ein entsprechendes Renommee oder einen Ruf in der Öffentlichkeit zu erarbeiten, indem er die tatsächliche Gefährlichkeit seiner Fahndungsobjekte stark künstlich überhöhte. Und da kann natürlich etwas dran sein, aber vielleicht hat Hoover auch nur verstanden, dass der gewöhnliche Mobster anders als der gewöhnliche Bandit in diesen sehr besonderen Zeiten dem Staat viel weniger gefährlich werden konnte, ganz einfach weil der Mobster den Staat als Grundvoraussetzung für seine sehr spezielle Art der Erwerbstätigkeit braucht. Der Mobster braucht den Staat, weil dieser genau die Dienstleistungen und Waren, die er im Angebot hat, von Staats wegen verbietet und damit sehr teuer und für ihn sehr einträglich macht. Und er braucht ihn auch, gerade weil der Staat das Angebot verbotener Dienstleistungen und Waren verfolgt und strafbewehrt sanktioniert, denn sonst könnte ja jeder kommen und es dem Mobster gleichtun. Es gibt eines, an dem der geschäftsbewusste Mafioso überhaupt kein Interesse hat, und das ist die Anarchie. Und jetzt könnt man natürlich schreiben, dass auch der gewöhnliche Bandit ein grosses Interesse dran haben müsste, dass der Staat die Grundvoraussetzungen seiner sehr speziellen Erwerbstätigkeit bereitstellt. Es muss ja schliesslich Papiergeld geben, dessen Wert der Staat garantiert, und schnelle Autos, Waffen und eine Infrastruktur und Banken und auch eine Polizei und Gefängnisse usw., denn sonst hätte ja jeder kommen und es dem Banditen gleichtun können. Und genau das ist der Punkt: Dillinger, Bonnie and Clyde und Kollegen genossen in der verarmten Bevölkerung, deren Vorfahren einst ihr privates Gewaltmonopol an den Staat übertragen hatten, eine unglaubliche Popularität, die bis heute nachhallt. Die Gefahr, dass immer mehr in bitterer Armut lebende Amerikaner ihrem Beispiel, das Gewaltmonopol eigenmächtig von einem enttäuschenden Staat auf das Individuum „rückzuübertragen“, folgen würden, was letztendlich und tatsächlich zur Anarchie hätte führen können, war also nicht zu unterschätzen, weshalb Hoover den Beweis erbringen musste, dass man mit dieser Nummer unmöglich durchkommen konnte. Und das tat er, auf seine Weise professionell und effizient, Bonnie and Clyde wurden in einen Hinterhalt gelockt und ohne den leisesten Versuch, sie festzunehmen, förmlich von Kugeln durchsiebt; John Dillinger wurde verraten, ebenfalls in einen Hinterhalt gelockt, der eine formidable Situation zur Festnahme ermöglicht hätte und dennoch „auf der Flucht?“ von hinten erschossen; Pretty Boy Floyd soll nach einer von drei divergierenden Zeugenaussagen, die heute noch auf der Webseite des FBI bestritten wird, aus nächster Nähe durch einen FBI-Agenten mittels einer Maschinenpistole erschossen worden sein, obwohl er bereits verwundet und wehrlos am Boden lag; Baby Face Nelson war da eher eine sehr spezielle Nummer, sein Hass auf die G-Men, die „Government-Men“ des FBI, einhergehend mit seiner Gewaltbereitschaft war wohl beispiellos. Nachdem ihm die Al Capone Gang, bei der er anzudocken versuchte, aufgrund seiner notorischen Unbeherrschtheit wieder den Laufpass gab, kam er bei der Dillingerbande unter und wurde, nachdem das FBI Dillinger zur Strecke gebracht hatte, von Hoover zu Nelsons grosser Genugtuung zum bis dahin dritten Staatsfeind Nr. 1 ernannt.

Baby Face Nelson
Vier Monate nach dem Tod von Dillinger und gerade erst vor einigen Minuten am Morgen des 27. Novembers 1934 einem Hinterhalt des FBI entkommen, fuhr der 25jährige zusammen mit seiner Frau am Steuer und einem Kumpanen auf dem Highway in einem natürlich geklauten brandneuen Ford nach Chicago, als er im entgegenkommenden Verkehr einen Wagen erspähte, den er als FBI-Fahrzeug erkannte. In diesem Fahrzeug sassen tatsächlich zwei FBI-Agenten, die auch in diese Gegend entsandt worden waren, um nach Nelson zu suchen. Wahrscheinlich erkannten sie den als gestohlen gemeldeten Ford von Nelson ebenfalls, jedenfalls entspann sich eine wilde Kurbelei zwischen den beiden Fahrzeugen, in deren Verlauf sich der stärker motorisierte Ford Nelsons hinter das Fahrzeug der G-Men setzte. Nelsons Kumpan feuerte Salven aus einer Thompson Maschinenpistole, der sogenannten Tommy-Gun, in den Wagen der FBI-Agenten, die das Feuer erwidern konnten, bevor sie unverletzt den Highway verliessen und auf ein Feld fuhren.

Im April 1932 präsentierte erstmals einen V8 für die PKW-Massenproduktion.
V8 for The People
Zwischenzeitlich hatte ein weiteres Fahrzeug mit zwei FBI-Agenten die Verfolgung von Nelsons V8 aufgenommen, der von der vorangegangen Schiesserei bereits in Mitleidenschaft gezogen worden war, darum beständig an Leistung verlor, weshalb Nelson sich offensichtlich und allen Ernstes entschloss, den Wagen zu wechseln. Er stoppte den Ford, während das Fahrzeug der G-Men in ungefähr 30 Meter Entfernung zum Stehen kam. Was dann folgte, ging als „Battle of Barrington“ in die amerikanische Kriminalgeschichte ein und sollte ein ganz spezielles Licht auf Baby Face Nelsons Verständnis über die Legitimation staatlicher Gewalt werfen. Nelsons Frau brachte sich in einem Strassengraben in Sicherheit, als Nelson und sein Gefährte hinter dem Ford in Deckung gingen, um sofort das Feuer auf die zwei FBI-Agenten zu eröffnen, die ihrerseits in der Deckung ihres Wagens das Feuer erwiderten. Nelson soll bereits in den ersten Sekunden der Schiesserei getroffen worden sein, mindestens eine Kugel aus der Maschinenpistole einer der Agenten durchschnitt Leber und Bauchspeichedrüse und trat an seinem Rücken wieder aus, was Nelson aber nicht daran hinderte, den Schusswechsel fortzusetzen, der mittlerweile bereits an die zwei Minuten dauerte. Nelson wird klar gewesen sein, dass mit jeder weiteren Sekunde das Eintreffen von Verstärkung für die zwei FBI-Agenten wahrscheinlicher werden würde, weshalb er eine schnelle Entscheidung der Schiesserei suchen musste. Nachdem seine Tommy-Gun eine Ladehemmung hatte, schnappte er sich ein Gewehr aus dem reichhaltigen Waffenarsenal im Inneren des Fords. Neuere Untersuchungen der alten Unterlagen des FBI legen den Schluss nahe, dass es sich bei dem Gewehr um ein Colt Monitor B.A.R handelte. Ein Gewehr mit enormer Durchschlagskraft und schneller Schussfolge, eigentlich eine Kriegswaffe und extra weiterentwickelt für das FBI, welches es in diesen Tagen immer öfter mit motorisierten und bis an die Zähne bewaffneten Gangstern zu tun bekommen hatte. Mit diesem Gewehr konnte man deren Autos mühelos zu Metallschnipseln verarbeiten, wie auch seine Projektile problemlos die damals gebräuchlichen Schusswesten durchdrangen.

FBI-Agent mit einem Colt Monitor Maschinengewehr. Eigentlich eine Kriegswaffe, die für das FBI weiter entwickelt und angepasst wurde
Zur Überraschung der Agenten als auch seines Kumpans verliess er schwerverletzt mit dieser Waffe im Anschlag die Deckung und ging auf die zwei G-Man zu, in schneller Folge feuernd, setzte er einen der Beamte mit zwei Schüssen ausser Gefecht, bevor ihn der andere FBI-Agent mit einem Schrotschuss von den Beinen holte. Nelson stand wieder auf und traf den zweiten FBI-Agenten, der jetzt hinter einem Telefonmast Deckung suchte, mit drei Schüssen, einen davon in den Kopf, gerade als dieser von dem Schrotgewehr abliess, um seine Dienstpistole zu ziehen. Nelson näherte und beugte sich über den wehrlosen und schwerverletzten Agenten und es ist nicht überliefert, ob er auch erkannte, wer da vor ihm lag: Special Agent Herman E. Hollis und damit einer jener drei Männer, der zum einen den tödlichen Schuss auf John Dillinger abgegeben haben könnte, so genau wurde das damals nicht untersucht, und zum anderen auch derjenige, der laut einer von drei Zeugenaussagen den bereits verletzt am Boden liegenden Pretty Boy Floyd aus nächster Nähe mit einer Maschinenpistole erschossen haben soll. Ohne einen weiteren Schuss abzugeben, humpelte er zu dem Wagen der Agenten, stieg ein und fuhr damit zu seinem Ford, verfrachtete dort sämtliche Waffen und anderes Zeug in den neuen Wagen und flüchtete dann zusammen mit seiner Frau und dem Kumpan am Steuer. Special Agent Hollis verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus, sein tödlich verletzter Kollege kurze Zeit darauf, ebenso wie Baby Face Nelson, der in einem Unterschlupf im Bett liegend gegen halb Acht Uhr abends in den Armen seiner Frau verschied. Drei Tote eines Gewaltausbruchs, der auch in den bewegten Zeiten von damals als außergewöhnlich exzessiv angesehen werden kann, aber neben der Rohheit und unbedingten und entschiedenen Verbissenheit Nelsons erstaunt vor allem und eigentlich die Vermeidbarkeit dieser Auseinandersetzung. Baby Face Nelson verfügte schliesslich über den schnelleren Wagen, selbst wenn er tatsächlich von den ersten beiden Agenten im entgegenkommenden Fahrzeug erkannt worden war, hätte er einfach und schnell weiter fahren können. Stattdessen lässt er seinen Wagen wenden und dreht damit die „übliche Beziehung“ zwischen Gaunern und Staatsmacht einfach um. Nicht der Staat verfolgt ihn, sondern er verfolgt die Repräsentanten der Staatsgewalt. Nicht er flieht vor der Festnahme, sondern die FBI-Agenten fliehen vor dem sicheren Tod.

Baby Face Nelson mit einem Ford V8
Elf Monate später nach dieser Wahnsinnstat sollte die Mafia Commission, das oberste Entscheidungsgremium der amerikanischen Mafia in New York, den Tod von Dutch Shultz, ein berüchtigter Mobster der sogenannten „Kosher Nostra“, beschliessen, da er sich nicht an das Verbot der Commission halten wollte, den Staatsanwalt Thomas Dewey umzubringen. Dewey sass mit seinen Ermittlungen nicht nur Shultz arg im Nacken, sondern sollte in der Folgezeit auch noch andere Grössen der Mafia bald nach Sing Sing oder auf den elektrischen Stuhl befördern, dennoch schreckte die Mafia vor der Ermordung Deweys zurück. Sie offenbarte damit gewissermassen eine rein „geschäftliche“ Beziehung zur Staatsgewalt, denn man wägte kühl ab, ob der Einsatz von Gewalt gegenüber einem Vertreter des Gewaltmonopols sinnvoll ist oder nicht, ob er nützt oder eher schädlich fürs Geschäft sein könnte, da er den staatlichen Verfolgungsdruck unter Umständen noch erhöht. Damit erkannte die Mafia das Gewaltmonopol des Staates anders als Baby Face Nelson aber auch implizit an. Der Mobster bestreitet oder bekämpft nicht das Gewaltmonopol des Staates an sich, er sucht vielmehr nach einem Umgang mit ihm, der ihm den grössten Nutzen oder den kleineren Schaden verspricht. Baby Face Nelsons Gewalt gegenüber den FBI-Agenten als die Repräsentanten des staatlichen Gewaltmonopols kennt aber überhaupt keinen Nutzen in diesem Sinn, noch nicht einmal „Notwehr“ oder Selbstverteidigung, sie ist damit nicht „geschäftlicher“, sondern „rein privater“ Natur. Ein wahnsinniger Akt der exzessiven Auflehnung der ersten individuellen amerikanischen Gewalt gegen deren zweite institutionalisierte Form. Baby Face Nelson ist damit ein – zugegebenermassen sehr exponierter – Vertreter der Out-Laws der Ära der Grossen Depression, die „ausserhalb“ des staatlichen Gesetzes nach ihrem eigenen Gesetz lebten, dessen Legitimation allein aus den Läufen der Gewehre, aus ihrer ureigenen Gewalt, kam. William S. Burroughs ist 1914 geboren und damit 12 Jahre älter als beispielsweise Ginsberg, die Jahre der Grossen Depression waren, obwohl in gehobenen Verhältnissen aufgewachsen, natürlich prägend für ihn. Eine Zeit der grossen Not, in denen nicht wenige dieser Outlaws schon zu Zeiten ihres Wirkens zu regelrechten „Rockstars“ wurden und von denen dann wiederum einige zu modernen „Robin Hoods“ verklärt worden sind. Pretty Boy Floyds letzten Weg säumten zwischen 20.000 und 40.000 Menschen, sie ist damit bis heute die grösste Beerdigung, die Oklahoma je erlebt hat.
Anders als die legendären Kriminellen, Revolvermänner und Glücksritter des „Wilden Westens“ markieren ihre scheinbaren Wiedergänger, die populären Kriminellen der „Great Depression“, einen Bruch in der us-amerikanischen Geschichte. Ihre Vorgänger des „Wilden Westens“ gingen zwar ebenso wie sie in die Folklore der USA ein, allerdings waren sie ein Phänomen der „American Frontier“, sie agierten vornehmlich in dem rechtsfreien Raum, dem Land hinter der Nahtstelle der institutionalisierten Gewalt, und waren damit Teil der Gesetzlosigkeit, mit der sich die Pioniere konfrontiert sahen, als sie zuerst für sich und damit später auch für den jungen Staat das Land erschlossen. Mit der Etablierung und Konsolidierung staatlicher Strukturen bis an die Küsten des Pazifiks verschwanden dann auch nach und nach diese ersten legendären Outlaws bzw. wurde der Kriminalität der „Glorienschein“ der American Frontier als identitätsstiftende Nationalsaga genommen, sie sank herab zur nur noch gewöhnlichen Kriminalität. Die legendären Figuren des Wilden Westens waren Teil der Erzählung der „American Frontier“, sie waren Elemente des rechtsfreien Raums, der Anarchie, die eben durch die Ausweitung der „American Frontier“ überwunden werden konnte. Insofern ist gerade auch die Bewährung in der Anarchie und die anschliessende Überwindung der Gesetzlosigkeit Teil der amerikanischen Erfolgsgeschichte der „American Frontier“, anders verhält sich mit den heute noch legendären Kriminellen der Ära der Grossen Depression, sie wurden populär, als das amerikanische Zukunftsversprechen gebrochen worden war und durch ihr Auftreten im vielleicht kritischsten Moment der amerikanischen Staatsgeschichte eröffneten sie, wenn auch sicher nicht gewollt, eine politische Dimension, da sie durch ihren Habitus und ihr „Gewaltverständnis“ auf den amerikanischen Mythos der „American Frontier“ verwiesen, jetzt da die erste und offizielle Erzählung der „American Frontier“ (vorübergehend) erstarrt und an ihr Ende gekommen war. Eine Gegenbewegung oder eine Gegenkultur fällt nicht auf einmal vom Himmel, sie braucht Vorbilder, Idole und muss eine „passende“ Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung treffen, sonst läuft sie ins Leere. In einer Zeit aber, da sich weite Teile der Amerikaner um ihren Anteil am American Dream betrogen fühlten, dessen Möglichkeit – und nicht mehr als nur das – ihnen der Staat nicht mehr garantieren konnte, gewinnen gewöhnliche Kriminelle aus dem Volk, die sich damit nicht nur nicht abfinden wollen, sondern die sich ähnlich wie ihre Vorväter aus eigener Gewalt und gegen die staatliche Gewalt einfach nehmen, was sie wollen und brauchen, fast automatisch enorme Popularität und damit zwangsläufig auch eine politische Dimension, da sie die sich durch die Great Depression stellende Soziale Frage auf eine spezifisch amerikanische Weise beantworten. Woody Guthrie, der Vater des modernen amerikanischen Folksongs, späteres Vorbild von Bob Dylan, zeitlebens ein Sympathisant der kommunistischen Idee und somit auch entschiedener Vorkämpfer der Arbeiterrechte, erfasste – nach J. Edgar Hoover, versteht sich – diese politische Dimension der neuen amerikanischen Volkshelden als einer der ersten und versuchte sie im Sinne seines kommunistisch geprägten Lösungsansatzes der damals im Raum stehenden Sozialen Frage zu instrumentalisieren. Fünf Jahre nach dem Tod von Pretty Boy Floyd dichtete er für den gleichnamigen Song unter anderen folgende Zeilen:
„As through this world you travel, you’ll meet some funny men:
Some will rob you with a six-gun, and some with a fountain pen.
And as through your life you travel, yes, as through your life you roam,
You won’t never see an outlaw drive a family from their home.“
Er singt von einer Welt, in der man seinerzeit lustigen Gestalten begegnen konnte: „Einige werden dich mit einem Revolver ausrauben, die anderen mit einem Füllfederhalter. (…) Aber du wirst niemals einen Outlaw sehen, der eine Familie aus ihrem Zuhause vertreibt.“ In diesen Zeilen ganz zum Schluss dieses Liedes konfrontiert Guthrie, nachdem er Pretty Boy Floyd in den vorangegangenen Versen als Robin Hood charakterisiert hatte, dem durch die verfolgende Staatsgewalt zu Unrecht alle möglichen Verbrechen angedichtet werden und der aber tatsächlich und in Wahrheit die verarmten Farmer mit dem von ihm geraubten Geld unterstützte, damit diese ihre Farmen vor der Bank retten konnten, das alte Amerika der Pioniere und Siedler mit dem neuen Amerika der Banker und Spekulanten, die diese wirtschaftliche Katastrophe unter den Augen und mit Förderung des Staates ausgelöst hatten. Es ist eine Konfrontation der zwei amerikanischen Gewalten, für die sinnbildlich der Revolver des Banditen und der Füllfederhalter des Bankers stehen, wobei sich der Füllfederhalter des Bankers, hinter dem wiederum die institutionalisierte Gewalt des Staates steht, für den einfachen Amerikaner als weitaus gefährlicher erweist, da der Outlaw – nicht der Bandit – als Repräsentant der ersten individuellen Gewalt, ihn, den einfachen Amerikaner niemals von der Farm oder von dem durch dessen Vorväter in Besitz genommenes Land vertreiben würde. In der Diagnose liegt Guthrie richtig, da er die zwei Gewalten der „American Frontier“, die institutionalisierte Gewalt des Staates und die ursprüngliche Gewalt des heroischen Pioniers nicht nur beschreibt, sondern sie auch einander gegenüberstellt, um sodann die erste individualistische Gewalt als volksnäher, wenn nicht sogar als die Gewalt des Volkes zu charakterisieren. In dieser Gegenüberstellung der zwei Gewalten beschreibt Guthrie einen Konflikt, der aufgrund der Besonderheit der amerikanischen Geschichte auf einmal eine politische Dimension eröffnet, und der sich anders als Guthries wahrscheinliche Hoffnung, die diesem Konflikt zugrundeliegende Soziale Frage in einem europäisch-kollektivistischen Sinne aufzulösen, nicht erfüllen kann, da eben die Outlaws der Great Depression wie Pretty Boy Floyd und Konsorten den verarmten amerikanischen Massen eine andere ur-amerikanische Lösungsalternative eröffnen, einen anderen Weg, den aufgrund der harschen Reaktion des Staates, zwar nur sehr wenige bereit waren zu gehen, der aber zum einen eben amerikanisch-individualistisch und eben nicht europäisch-kollektivistisch ist. Eine „Alternative“, die auf eine durch einen tiefen Vertrauensverlust erschütterte Bevölkerung trifft, die zwar in der allergrössten Mehrheit nicht zum Revolver oder zur Tommy-Gun greifen wird, aber dennoch die Protagonisten des neuen alten amerikanischen Weges gerade wegen ihres Zitats der heroischen Bewährung in der „American Frontier“ bewundert und vielleicht bis heute idolisiert, womit eine neue und zweite amerikanische Erzählung begann, die neben der alten nicht nur bestehen bleiben wird, sondern von nun an kunstvoll fortgewoben werden sollte und welche man vielleicht die Erzählung der amerikanischen Gegenkultur nennen könnte. Und wahrscheinlich ist es genau das, was den jungen Burroughs faszinierte, Jack Blacks „You can’t win“ kam das erste Mal 1926 heraus, da war der Burroughs gerade mal zwölf Jahre alt, danach sollte die „zweite amerikanische Erzählung“ nach dem Schwarzen Freitag im Oktober 1929 ihre ersten Kapitel schreiben, da die Outlaws die Schlagzeilen der amerikanischen Zeitungen für Jahre beherrschen sollten, das Leben aus eigener Gewalt, das Leben gegen die Regeln des Staates, welcher die Herausforderungen, die die „American Frontier“ für das Individuum bereit hielt und an denen es sich existenziell bewähren konnte, verbot, verfolgte und sanktionierte. Was blieb, war der Untergrund, in dem die zweite amerikanische Erzählung fortgeschrieben wurde als die Geschichte einer Gegenkultur, die sich eben gegen die etablierte Kultur der ersten Erzählung wendete. Und Huncke, dessen Lebenslauf dem des verehrten Jack Black erstaunlich ähnlich war, wurde gewissermassen Burroughs persönlicher Zeremonienmeister, der ihn, den Sohn aus gutem Hause, in das Leben eines Kriminellen einweihen sollte, wobei es Burroughs wohl weniger um die Hippness Hunckes gegangen ist, als vielmehr um dessen Know How als Outlaw, ein kleiner aber sehr wichtiger Unterschied zu den Interessen der anderen beiden „Gründungsmitgliedern“ der sogenannten Beat Generation, Kerouac und Ginsberg, was dann wieder die literaturwissenschaftlich zu beantwortende Frage aufwirft, ob denn Burroughs wirklich als Mitglied dieser „literarischen Bewegung“ anzusehen ist oder er nicht vielmehr seine ganz ureigene Bewegung war. Wie auch immer: Burroughs war ein lehrreicher Schüler Hunckes, der eigentlich ohne existentielle Notwendigkeit – der monatliche Scheck seiner Eltern erreichte ihn immer noch regelmässig – bald schon anfing, das Leben eines großstädtischen Kleinkriminellen und Dealers zu führen, Drogenabhängigkeit inklusive, versteht sich, was dann doch auch einige finanzielle Probleme mit sich bringen sollte. 1946 ging er dann noch einen Schritt weiter bzw. einen Schritt zurück in seiner persönlichen Selbstfindung als gefühlter Inhaber der ersten anarchisch-amerikanischen Gewalt, Burroughs wurde wegen Beschaffungskriminalität verhaftet und unter der Auflage, sich der Obhut seiner Eltern zu überantworten, zu einer viermonatigen Haftstrasse auf Bewährung verurteilt. Er ging auch tatsächlich zunächst zu seinen Eltern nach St. Louis, blieb dort aber nicht sonderlich lange, kehrte zurück, holte seine ebenfalls drogenabhängige Freundin Joan Vollmer, die spätere Mrs. Burroughs, aus der Psychiatrie, schwängerte sie und eröffnete der werdenden Mutter – ganz der fürsorgliche Familienvater – seine Vorstellungen bezüglich der zukünftigen Existenzsicherung der jungen Familie, die im Wesentlichen darin bestanden, eine 36 Hektar grosse Ranch vierzig Meilen nördlich von Houston zu kaufen, um dort – wasdennsonst? – Marihuana anzubauen, was nach Lage der damaligen Dinge – über eine gewisse „Berufserfahrung“ verfügte Burroughs ja jetzt – am meisten einbringen sollte. Burroughs wurde also nicht nur gewissermassen Pionier und bezog mit der kleinen Familie, die noch aus Vollmers vierjähriger Tochter aus erster Ehe bestand, die im Juli 1947 einen Halbbruder bekommen sollte, und welche noch zumindest zeitweise durch Herbert Huncke höchstpersönlich ergänzt werden sollte, wenn dieser gerade mal nicht im Knast sass, eine eingeschossige Hütte mit Wellblechdach ohne fliessend Wasser, Strom und Heizung, auf texanischem Farmland. Wie der angehende Schriftsteller und jetzige heroische Teilzeit-Pionier dort seine Tage zu verbringen gedachte, schildert Steve Watson in „Die Beat Generation“, gewissermassen das Standardwerk über die „Literatur-Bewegung“, wie folgt:
„Abgesehen von Zeitungen, Unterhaltungen und der Hausarbeit bestand die Hauptbeschäftigung ihrer Tage in der Jagd auf Skorpione und im Schießen. Burroughs schoß mit einer Kleinkaliber-Scheibenpistole auf Flaschen, Opossums und Baumstrünke und rief gelegentlich ein „He, die Rotröcke kommen!“ in die gottverlassene Gegend. Um fünf begann die Cocktailstunde gefolgt von gegrillten Steaks. Nach dem Essen schoß Burroughs wieder, dann hörte man auf einem blechern klingenden Victrola Musik. (…) Nachbarn jenseits des Kiefernwaldes spekulierten über die Identität des Grüppchens aus dem Osten, das da Musik hörte und in der Gegend herumschoß, und eines Tages erzählte der Apotheker vom Ort Burroughs und Huncke, die Einheimischen hielten sie für Gangster, die mit Maschinenpistolen herumschlossen. („Was Burroughs zum Brüllen fand“, erinnerte sich Huncke. „Noch nie hat man eine so stolzgeschwellte Brust gesehen.“)“ 92
„König der Hipster“ wird fortgesetzt…