
Ab und zu gerät man an einen Zeitgenossen, der gerade oder vor nicht allzu langer Zeit einen Film im Kino oder bei Netflix, Amazon oder sonstwo gesehen hat, der ihn aus irgendwelchen Gründen nachhaltig beeindruckt, wenn nicht sogar begeistert hat, weswegen er jedem – wirklich jedem – den er trifft, den Plot des cineastischen Meisterwerks aufs Auge drücken muss, weil der nämlich so wahnsinnig genial, tiefgründig, komisch oder so gewesen sei. Und wenn man dann selbst so ein Typ ist, der es eigentlich hasst, den Plot von vermeintlich cineastischen Meisterwerken erzählt zu bekommen, eben weil man auch vielleicht zu den Typen gehört, die, wenn sie sich für den Plot interessieren würden, den Film selbst im Kino oder bei Netflix, Amazon oder sonstwo angesehen hätten, was aber bei dem Film, dessen Plot der Zeitgenosse aus Gründen der Begeisterung ganz unbedingt erzählen muss, ganz sicher nicht der Fall gewesen wäre, da dieser zu erzählende Filmplot alles andere als genial, tiefgründig, komisch oder so gewesen sein kann. Und wenn man sich dann dennoch dazu entschlossen hat, irgendwie höflich zu bleiben, hört man sich den Plot, den der cineastisch begeisterte Zeitgenosse mit leuchtenden Augen erzählt, eben an, heuchelt zuweilen ein wenig Interesse, indem man beispielsweise ein „isnichwahr!“ oder ein oder mehrere „okeeeeeh…“ oder ein „unglaublich!“ oder „ächtjetzt?“ in den Redefluss des begeisterten Cineasten wirft, der einem diese Aufmerksamkeiten mit dem Schildern von immer mehr und immer belangloseren Details eines äusserst langweiligen cineastischen Meisterwerks dankt, weshalb man dann nach einer gefühlten Ewigkeit und dem Unterdrücken mehrerer Fluchtimpulse ziemlich froh sein wird, wenn der cineastische Enthusiast sich endlich endlich zum Filmende, sei dieses ein Happy End oder ein Sad End oder nur ein Cliffhanger, durcherzählt hat, woraufhin er dann mit rosigen Wangen und einem leicht debilen Grinsen im Gesicht im Antlitz des Gegenübers, also bei einem selbst, nach irgendwelchen Anzeichen dafür forschen wird, ob man den Witz verstanden hat, ob man ganz und gar ergriffen ist aufgrund der abgrundtiefen Tiefgründigkeit des Meisterwerkes oder ob man es jetzt schon nicht erwarten kann, auch noch die weiteren Folgen der cineastischen Vollkatastrohphe erzählt zu bekommen, die aber – gottseidank – noch nicht abgedreht sind und nach Lage der Dinge auch nie sein werden, da ausser dem cineastischen Enthusiasten, der einem soeben eine halbe Stunde Lebenszeit klaute, und ein paar anderen hoffnungslos verwirrten Hansel kein Mensch diesen cineastischen Schwachsinn wirklich bis zum Ende angeschaut hat.

Und das alles hat man natürlich im Kopf, wenn man sich entschlossen hat, den zu schreibenden Text über ein altes Motorrad an einem alten Film aufzuhängen, weil man über eine alte Werbeanzeige gestolpert ist, auf der fünf junge Frauen hinter einer alten, damals jungen Norton Commando stehen, und eher nicht motorrad-werbetypisch „verführerisch“ schauen, sondern vielmehr herausfordernd, vielleicht auch ein bisschen spöttisch oder auch leicht überheblich, während über ihren Köpfen unübersehbar die drei Worte „The wild bunch“ zu lesen sind, womit die damaligen Werbestrategen Nortons offensichtlich Bezug nehmen wollten auf einen Film, der ein oder anderthalb Jahre vor der Konzeption der Werbeanzeige, die erst ab Herbst 1970 entstanden sein kann, da – wie der Experte natürlich sofort erkennt – die präsentierte Maschine mit Lucas Flügelschaltern ausgerüstet ist, die erst ab dem Modelljahr 1971 verbaut wurden, in die amerikanischen Kinos kam. Und weil diese werbestrategische Verknüpfung zwischen einem Western und einem Motorrad, die noch unterstrichen wird durch das Outfit der jungen Frauen, die unter anderem eine Lederweste, ein Jeanskleid, eine Fellweste sowie drei Cowboyhüte undsoweiter tragen, zum Zeitpunkt ihrer Verknüpfung unter Umständen ganz andere werbestrategische Ziele verfolgte, da man seitens der Werbestrategen von Norton vielleicht versuchen wollte, etwas von dem Glanz oder dem Erfolg des Westerns „The wild bunch“, der alles andere als eine cineastische Vollkatastrophe war, irgendwie für die Verkaufsförderung der Norton Commando zu nutzen, indem beispielsweise das „wild“ von „The wild bunch“ auf den besonderen Punch britischer Parallel Twins hinweisen sollte, bekommt diese Verknüpfung heute, mehr als 50 Jahre nach der Erstaufführung des Hollywoodfilms und mehr als 40 Jahre nach dem Untergang der Norton Commando, einen ganzen anderen Dreh, und das hat natürlich etwas mit dem Plot von „The wild bunch“ als auch der sehr speziellen Geschichte der „Norton Commando“ zu tun, was es dann wiederum notwendig macht, nicht nur – ‚tschuldigung! – den Plot des Westerns, sondern auch die Geschichte der Norton Commando zumindest in Teilen zu beleuchten.
Als die Norton Commando 1967 auf der Motocyclorama in London das Licht der Öffentlichkeit erblickte, präsentierte sich dem faszinierten Publikum eine seltsame sowie wahrscheinlich bis heute einzigartige Mischung von Motorrad-Stilelementen aus verschiedenen Epochen, ein kernig motorisiertes Zweirad, das gewissermassen irgendwo zwischen dem Gestern und dem imaginierten Morgen des britischen Motorradbaus festhing. Das Morgen oder die Zukunft des Motorrads, wie man sie sich bei Norton so vorstellte, manifestierte sich bei der Neuvorstellung neben einigen technischen Details vor allem im Design der Maschine, das von einem mehr oder weniger stylischem Heckbürzel, sowie einem modern geschwungenen Tank und den beiden Seitenteile dominierte wurde, die allesamt aus Fibreglass gefertigt worden waren, was ein damals mächtig angesagtes Leichtbaumaterial war. Farbgestalterisch gekontert wurden die silbernen Kunststoffteile durch eine orange bezogene Sitzbank, deren vorderen „Ohren“ sich beidseitig an den Tank schmiegten, um vielleicht als Kniekissen dienen zu können, ein Versprechen, das jedoch praktisch nie eingelöst werden konnte. Verantwortlich für dieses Design, als auch für die angeplante avantgardistische Imagekampagne war die damals erst zwei Jahre alte Londoner Markenberatungsagentur Wolff Olins, die sich in späteren Jahren einen Weltruf erarbeiten sollte. Das „Gestern“ der Norton Commando oder defensiver formulierte: ihr „Bewährtes“ zeigte sich vor allem in ihren technisch-funktionalen Teilen, der erprobten Roadholder Vorderradgabel, 1946 entwickelt und 1953 modifiziert, der Vorderradtrommelbremse von 1955/56, die man für die Commando geringfügig überarbeitet hatte, der hinteren Trommelbremse, die seit 1938 eigentlich nie überarbeitet worden war, dem Getriebe und schliesslich dem Urviech von einem britischen Zweizylinder-Reihenmotor, 1947 ursprünglich für einen Hubraum von 500 ccm ersonnen, inzwischen aber immer wieder angepasst und verbessert, als auch der Nachfrage des us-amerikanischen Marktes nach immer stärkeren Maschinen folgend zunächst auf 650 ccm aufgebohrt und schliesslich bei einem Volumen von insgesamt 750 ccm angelangt, was insbesondere schon bei einem Vorgängermodell der Commando, der Atlas, massive Probleme verursacht hatte, denn mit dem stufenweise Anwachsen des Hubraums stiegen die Vibrationen des Gleichläufer-Motors, bei dem beide Kolben gleichzeitig parallel die Zylinderlaufbahnen entlang donnerten, quasi im Quadrat, was den amerikanischen Motorradjournalisten Phil Schilling 1974 in der Rückschau zu der Feststellung trieb:
„Die Atlas war ein unglückliches Motorrad. Wenn die 650er durch ihr Schütteln die Zähne entblösste, riss der 750er durch wütende Vibrationen die Kiefer auseinander. Die Atlas vibrierte nicht mehr nur Muttern und Schrauben lose. Sie bebte vielmehr die Highways entlang und fütterte derweil die Strassengräben mit ihrem Metall.“
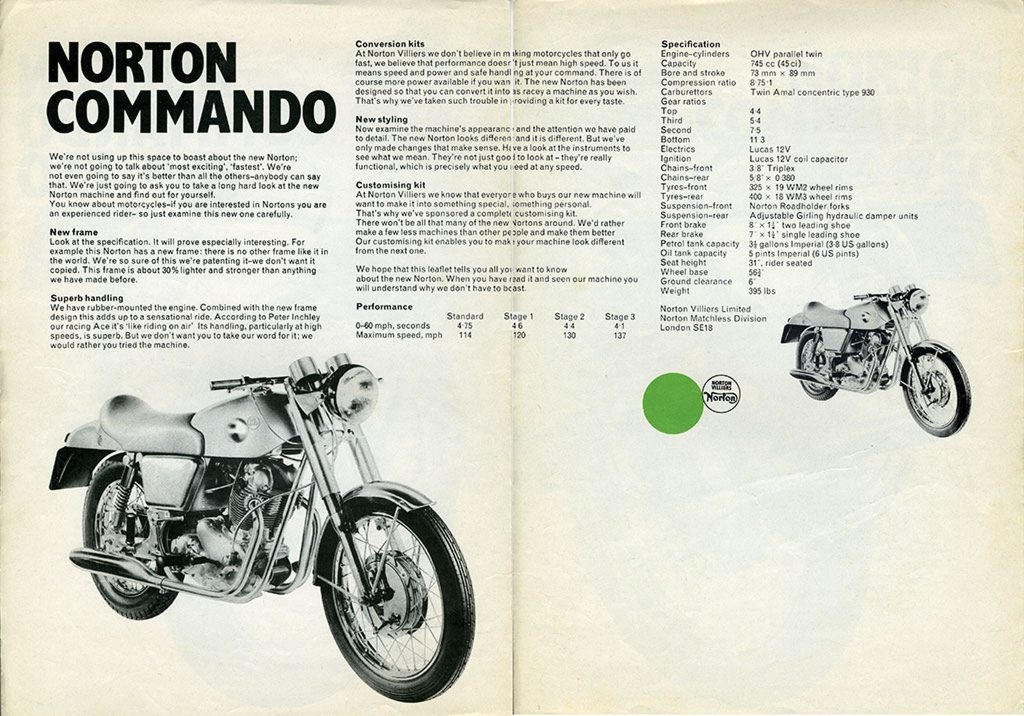
Und eben dieses Schicksal, sich im laufenden Betrieb und entsprechend höherer Motordrehzahl sozusagen selbst aufzulösen, hätte auch die Commando ereilen können, wenn man sich bei Norton nicht entschlossen hätte, das schicke Motorrad-Morgen des im „Swinging London“ der 1960er Jahre konzipierten Designs und das kernig Motorrad-„Bewährte“ der glorreichen Zeit des britischen Motorradbaus auf sehr besondere Art und Weise miteinander zu verbinden, wozu es allerdings notwendig war, den legendären und richtungsweisenden Norton-„Featherbed“-Rahmen, Anfang der 1950er Jahre entwickelt und seitdem aufgrund seiner hervorragenden Fahreigenschaften unter anderen auch von BMW kopiert und leicht modifiziert, wo er immerhin bis Mitte der 1990er Jahre verbaut wurde, aufzugeben und durch einen neuen Rahmen zu ersetzen. Und genaugenommen handelte es sich bei diesem Rahmen nicht nur um eine komplette Neukonstruktion, sondern auch um einen tiefgreifenden, um nicht zu schreiben revolutionären Eingriff in die Physiognomie eines britischen Motorrads, welcher gewissermassen den Eintritt in eine neue und einzigartige Dimension des Motorradfahrens markieren sollte, was umso verwunderlicher ist, da dieses technische Wunderwerk erstens ausgerechnet von einem britischen Motorradhersteller entwickelt worden war, denen man bis in die heutige Zeit eine gewisse Innovationsfeindlichkeit nachsagte und sagt, zweitens noch dazu von Norton, die eigentlich chronisch klamm und immer mal wieder in wirtschaftlichen Kalamitäten waren, und drittens auch noch in so atemberaubend kurzer Entwicklungszeit von nur wenigen Monaten die – naja – nennen wir es mal: Serienreife erlangte.
Ungefähr zur gleichen Zeit als Nortons Mutterkonzern AMC 1966 auch aufgrund der aufkommenden japanischen Konkurrenz sowie einer vor allem für den wichtigen us-amerikanischen wenig attraktiven Produktpalette insolvent ging und man sich bei Norton in der Folge und unter dem neuen Eigentümer Manganese Bronze Holdings Ltd. in einem Anfall nicht nur latenten Grössenwahns daran machte, auf den Trümmern grösstenteils verschnarchter Motorradmodelle und mittelalterlich anmutender Produktionsbedingungen nichts weniger als das erste Superbike der Geschichte auf die Räder zu stellen, suchte man auf der anderen Seite des grossen Teichs bei Warner Bros.-Seven Arts nach einem geeigneten Filmstoff für Sam Peckinpah, einem Regisseur, dessen Ruf in den Jahren zuvor ein wenig gelitten, der sich aber neuerdings sozusagen in der Strafrunde beim Fernsehen wieder erfolgreich einen Namen gemacht hatte, weshalb man ihm auch in Hollywood die Gelegenheit zum Comeback geben wollte. War zunächst daran gedacht, ihn einen Abenteuerfilm drehen zu lassen, vertraute man ihm, nachdem sich bei Warner Bros.-Seven Arts rumsprach, dass die Konkurrenz von 20th Century Fox sich die Rechte für „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ gesichert hatte, die Realisierung von The Wild Bunch an, wie „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ ein Western und somit nach Meinung der Studiobosse von Warner Bros.-Seven Arts bestens dazu geeignet, dem Machwerk der Konkurrenz an den Kinokassen den Rang abzulaufen. Wobei das mit dem Western so eine Sache ist, denn strenggenommen ist The Wild Bunch eigentlich gar kein Western, na gut, es spielen Pferde mit und okeh, es wird viel, sehr viel geschossen und auch tragen die Schauspieler die meiste Zeit über so ähnliche Hüte wie die Modells auf Nortons Werbeanzeige, aber das eigentliche Thema des Films ist kein klassisches Westernthema, also kein lustvolles Niedermetzeln von ganzen Indianerstämmen oder so ein Law-and-Order-Gedöns, wonach der Outlaw sich aufgrund irgendwelcher schicksalshafter Wendungen zum Good Guy wandelt, um sodann in einem aus zusammengenagelten Bretterbuden bestehenden und von Kriminalität geplagten Nest im Nirgendwo des Wilden Westens für Ordnung zu sorgen, wozu er den vielen Bad Guys in Town eine ordentliche und meistens finale Abreibung verpassen muss, sondern das eigentliche Thema von „The Wild Bunch“ ist das Heraufdämmern eines neuen Zeitalters oder anders ausgedrückt: Das Ende einer Ära und die verschiedenen Möglichkeiten von dieser Abschied zu nehmen.

So wie Mitte der 1930er in England ein neues Motorrad-Zeitalter heraufdämmern sollte, als man sich bei der zwar in Coventry ansässigen, aber von zwei Nürnbergern gegründeten Triumph Motor Company, die sowohl Autos als auch Motorräder fertigte, aufgrund finanzieller Schwierigkeiten entschloss, die Motorradproduktion aufzugeben und sich nur noch dem Automobilbau zu widmen, was Jack Sangster, Eigentümer der zu dieser Zeit erfolgreicheren Konkurrenzfirma Ariel Motorcycles, die Gelegenheit bot, die Motorradsparte von Triumph aufzukaufen. Triumph verfügte schon damals über gewachsene Geschäftsverbindungen in die USA und somit und anders als Ariel über einen Namen in einem Markt, welcher in den kommenden Jahren immer wichtiger werden sollte, weshalb es Sangster offensichtlich und klugerweise daran gelegen war, das neu erworbene Unternehmen mit immerhin 850 Mitarbeitern nicht seiner eigenen Firma Ariel Motorcycles einzuverleiben, sondern unter dem neuen alten Namen „Triumph Engineering Co.“ weiterzuführen. Die Leitung des Unternehmens vertraute er einem jungen Ingenieur an, der schon bei Ariel durch ungewöhnliche, aber innovative Kreationen, wie beispielsweise dem Motor der Ariel Four Square aufgefallen war, bei dem vier Zylinder im Quadrat angeordnet waren, auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der damals 35jährige Edward „Ed“ Turner, der, ohne formalen Berufs- oder Studienabschluss, sich sein Wissen grösstenteils autodidaktisch, in Abendschulkursen oder durch gehobenes Learning-by-Doing unter Anleitung von Ariels Chefingenieur Vale Page angeeignet hatte, wurde von Sangster mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet und sollte sich schnell als Glücksgriff erweisen.

Turner traf bei seiner neuen Aufgabe gewissermassen auf die Hinterlassenschaften seines ehemaligen Chefingenieurs Vale Page, der Ariel bereits 1932 in Richtung Triumph verlassen hatte, um dort die Produktpalette zu überarbeiten und zu attraktiveren, allerdings mit nur mässigem Erfolg, bevor er Triumph vier Monate vor der Übernahme durch Sangster wieder verlassen sollte. Neben verschiedenen Einzylindern fand Turner nun auch den Parallel-Twin der Triumph 6/1 vor, eine Kreation Pages, die Turner eigentlich bestens gekannt haben muss, war ihr immerhin 649 ccm grosser Motor doch ein konstruktiver Abkömmling seines eigenen 500 ccm Quadratvierzylinders der Ariel Four Square gewesen. Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Ariel hatten er und Page mit dem Vierzylindermotor und seinen zwei Kurbelwellen verschiedene Tests unternommen, dabei auch einmal eine der beiden Kurbelwellen samt zugehörigem Geraffel entnommen, um den Vierzylinder als Zweizylinder laufen zu lassen. Das Resultat war verblüffend, denn der sodann 250 ccm grosse Reihen-Zweizylinder entwickelte eine sehr sanfte Kraftentfaltung, wobei es kaum einen Unterschied zu machen schien, ob sie den Motor als parallelen Gleichläufer oder 180-Grad-Twin (gegenläufig) konfigurierten. Warum also, muss sich Page damals gedacht haben, sich mit einem komplizierten und versponnenen Quadrat-Vierzylinder herumplagen, wenn sich das erwünschte Ergebnis eines potenten und dabei vergleichsweise vibrationsarmen Motors doch so viel einfacher verwirklichen liesse. Ein Gedanke, den er dann später bei Triumph in Gestalt der Triumph 6/1 in die Tat umsetzte, allein verkaufte sich das Motorrad schlecht. Die Gründe hierfür waren vielfältig, letztlich aber einerlei, da sich die Herstellung des Motorrad ohnehin nur sehr schwer wirtschaftlich darstellen liess, weil man so ziemlich keines seiner Teile auch in den anderen Einzylindern, den Brot-und-Butter-Motorrädern Triumphs, verwenden konnte, sondern diese ausschliesslich für die Triumph 6/1 herstellen oder einkaufen musste, was das Motorrad schlussendlich zu teuer machte. Die 6/1 war ein Flop, ihre Produktion wurde alsbald eingestellt, aber dennoch gebührt ihr die Ehre der erste klassische britische Parallel-Twin eines renommierten Herstellers gewesen zu sein und darüber hinaus auch als konstruktives Vorbild jenes Motors gedient zu haben, der bald das Licht der Welt erblicken und dann ziemlich schnell zur stilbildenden und prägenden Ikone des britischen Motorradbaus aufsteigen sollte.
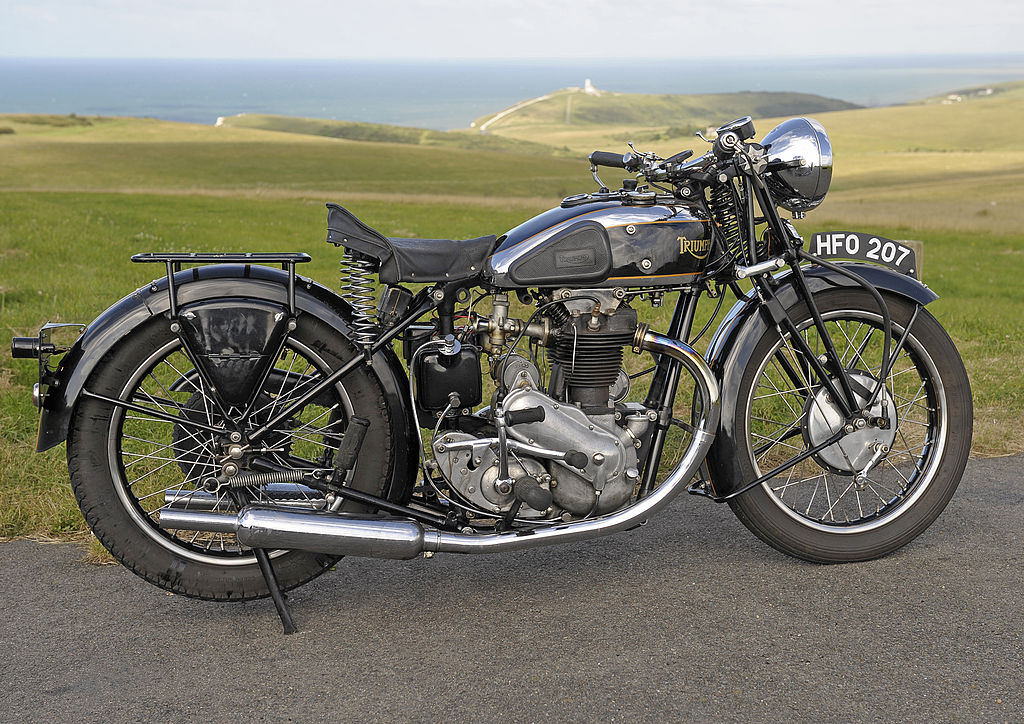
Triumph 6/1
Sam Peckinpah datierte seine Western-Ikone „The Wild Bunch“ in das Jahr 1913 und platzierte es damit zeitlich geschickt an den Nahtstellen verschiedener gesellschaftlicher und sozialer Entwicklungen. Zum einen ist es gewissermassen das Jahr 1 nach dem das, was man die „American Frontier“ nennt – also die Ausdehnung des Einwanderungslandes USA von Ost nach West, wobei der „Wilde Westen“ als kultureller, geographischer aber auch rechtlicher Grenzraum zwischen Indianerland und Siedlergebiet immer weiter nach Westen vorrückte, bis er endlich die Pazifikküste erreichte, um sich dann sozusagen aufzulösen – auch durch die offizielle US-Bundesstaat-Werdung der beiden letzten bis dahin durch Washington verwalteten Territorien Arizona und New Mexico formal abgeschlossen wurde (Die entfernten Gebiete Alaska und Hawaii sollten erst 1959 folgen). Allerdings setzte die Zersetzung des „Wilden Westens“ mit dem Heraufdämmern des von Mark Twain so genannten „Gilded Age“, dem vergoldeten Zeitalter, schon viel früher, so um 1870, ein, als das Land durch die Industrialisierung zu einem beispiellosen Wirtschaftswachstum ansetzte. Treiber dieser Entwicklung war vor allem die Eisenbahn, ein riesiges Land musste schliesslich durch die Schiene erschlossen werden und dazu benötigte man nun einmal Unmengen Maschinen, Minen, Erze, Stahl, Hochöfen, Kohle, Öl, Kraftwerke, Ingenieure, Know-How, Arbeitskräfte, Logistik, versorgende Infrastruktur und das alles finanzierende Geldgeber, Banken und Aktien. Kurz, es war die Gründungszeit der Tycoone, Typen wie Vanderbilt, Carnegie und Rockefeller machten innerhalb kürzester Zeit unvorstellbare Vermögen und Ingenieure und Erfinder wie Edison, Westinghouse und Vail schufen bahnbrechende Innovationen, von denen wir heute noch profitieren. Allerdings hatte die Sache einen Haken, obwohl oder gerade weil die USA in einem wahnwitzigen Tempo bis 1900 zum grössten Industrieproduktionsland der Welt aufstieg, konnte die gesellschaftliche und administrative Entwicklung des noch sehr jungen Staates nicht mithalten. Die Folge war ein fast ungezügelter, unregulierter Raubtierkapitalismus, der auf kleinteilige, unvorbereitete und zunehmend korruptere Regierungsstrukturen traf. Dieser Gegensatz verschärfte sich nach Fertigstellung des Eisenbahnnetzes gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch gefährlich, als die nun zur Verfügung stehenden schnelleren und billigeren Transportwege die bis dahin bestehenden regionalen Märkte auflösten und einen grossen nationalen Markt schufen, auf dem jetzt jedoch auch ein grösserer Konkurrenzdruck herrschte, dem die Unternehmen auszuweichen versuchten, indem sie sich durch Übernahmen oder auch Fusionen zu immer gigantischeren Grosskonzernen zusammenschlossen. Sehr wenige Unternehmer, Eisenbahner, Industrielle und Bankiers geboten bald über ganze Branchen, riesige Vermögen und unzählige Arbeitsplätze und konzentrierten so viel politische Macht in nur wenigen Händen, vor deren Missbrauch sie nicht zurückschreckten, sondern ganz im Gegenteil, durch Preisfestlegungen, Korrumpierung der Politik, Lohndumping und gegenseitige Absprachen faktisch weite Teile des Wirtschaftslebens der USA dominierten. Gleichzeitig strömten immer noch Jahr für Jahr Millionen von Habenichtsen aus der alten Welt in die USA, bevölkerten dort vor allem die Städten und liessen das Heer der Armen beträchtlich anschwellen. Die amerikanische industrielle Revolution untergrub so das grosse amerikanische Gleichheitsversprechen, das gerade auch dem Geist der „American Frontier“ innewohnte, dramatisch. Von 1860 bis 1900, in nur vierzig Jahren, wuchs die soziale Ungleichheit immens und ging die Einkommensschere immer weiter auseinander, sodass 1900 die reichsten 2% der amerikanischen Haushalte ein Drittel des nationalen Vermögens besassen, die reichsten 10% über drei Viertel der amerikanischen Vermögen verfügten, während die unteren 40% so gut wie nix ihr Eigen nannten. Mit anderen Worten: Die Soziale Frage stand wie ein Elefant im Raum und liess vor allem in der Mittelschicht die Angst vor sozialen Unruhen und Rebellionen wachsen. Dieser durch das „Gilded Age“ bedingten Angst begegneten dann vor allem die sogenannten WASPs, weisse angelsächsische Protestanten der Mittelschicht, mit Reformbestrebungen, die beinahe alle Facetten und Bereiche der Gesellschaft betrafen. In heutiger Diktion könnte man sagen, sie betätigten sich als Aktivisten für ein gerechteres, nachhaltigeres, gesünderes, gleichberechtigteres, sozialeres Leben für so ziemlich Alle in den USA. Dieses „Progressive Era“ genannte soziale Phänomen, das man sich nicht als kompakte und homogene Bewegung vorstellen sollte, sondern vielmehr als eine gesellschaftliche Reaktion auf die sozial unzumutbaren Resultate des „Gilded Age“, die einen Zeitgeist entstehen liessen, der unzählige voneinander grösstenteils unabhängige „Grassroots-Initiativen“ gebar, die für die unterschiedlichsten sozialen Ziele stritten, wie eine stärkere Regulierung der Wirtschaft, einen starken Staat, aber auch für eine direkte Demokratie oder die Gleichberechtigung der Frau sowie für ein Verbot des Alkohols und anderer Genussmittel, eine gesunde Ernährung, eine staatliche Kontrolle der Pharmaindustrie und sich auch schon den Umweltschutz auf die Fahnen schrieben, indem man beispielsweise die Einrichtung von Nationalparks forderte. Die „Progressive Era“ setzte um 1897 ein und sollte bis um 1920 anhalten, wobei sich die Gelehrten uneinig sind, wann genau diese Ära auslief oder ob sie überhaupt jemals ein Ende fand. Die Reformbewegungen dieser Zeit begannen zunächst lokal, eroberten bald die nationale Ebene und waren, spätestens als es ihnen gelingen sollte, einige ihrer Anhänger in politische Funktionen bis hin zum Weissen Haus zu bekommen, auch erfolgreich. Die „Progressive Era“ war eine dringend notwendige Gegenbewegung zum „Gilded Age“, die, abgesehen von einigen Spinnereien, wie beispielsweise der Prohibition, das Staatswesen aber auch das gesellschaftliche Leben der USA modernisierten und reformierten und so die schlimmsten Auswüchse des Rauptierkapitalismus auch eliminierten. Und wer sich jetzt denkt, das kommt mir aber alles irgendwie bekannt vor: Dieser ungezügelte Kapitalismus, der durch ein Netz aus Eisenbahnschienen, auf dem man Waren als auch Informationen viel schneller als früher befördern kann, erst ermöglicht wird und der unreguliert einfach immer weiter wuchert, weil das Netz aus vielen kleinen regionalen Märkten einen einzigen immens grossen macht, und so immer grössere Konzerne auf unzureichende staatliche Strukturen treffen, die auf so viel Markmacht privater Unternehmen gar nicht vorbereitet sein konnten, da sie einst viel zu kleinteilig und ineffizient angelegt worden waren. Und wer sich dann noch wundert über diese Aktivisten einer Progressiven Bewegung, die sich in vielen Nichtregierungsorganisationen zusammenschliessen, um die Gesellschaft zum „Guten“ zu verändern, was ihnen insbesondere auch dadurch teilweise gelingt, indem sie staatliche Institutionen penetrieren, dem sei gesagt: ja, das darf einem schon alles bekannt vorkommen, aber das Allerbeste ist, dass Peckinpah auch die alten weissen Männer nicht vergessen hat, die an einem sonnigen Tage im Jahre 1913 in ein texanisches Provinznest einreiten, um die Eisenbahngesellschaft um ein paar Silberdollars zu erleichtern, weil Peckinpah offensichtlich wild entschlossen war, diese Perioden oder gesellschaftlichen Entwicklungsstationen, also die „American Frontier“, das „Gilded Age“ und die „Progressive Era“, die sich in der amerikanischen Geschichte zeitweise überlappten, in den Eingangssequenzen seines Meisterwerks „The Wild Bunch“ ganz furchtbar miteinander kollidieren zu lassen.

1937 Triumph Speed Twin
Als Edwards Turners Meisterwerk wird gemeinhin der „Speed Twin 500“ angesehen, sein Parallel Twin, den er im Juli 1937 der Presse vorstellte. Angesichts des Flops der 6/1, welcher auch der eher ambivalenten Einstellung der meisten britischen Motorradfahrer gegenüber Mehrzylindermotoren zuschulden war, ein mutiger Schritt, aber Turner hatte, nachdem er von Sangster zu Triumphs Managing Director ernannt worden war, seine Hausaufgaben gemacht. Zunächst hatte er sich der Brot-und-Butter-Einzylindermaschinen angenommen, krempelte entschieden deren Motoren-Palette als auch ihr Erscheinungsbild um, wobei er auf eine stärkere Kompatibilität der Teile der unterschiedlichen Modelle untereinander achtete und sich ansonsten bezüglich des Designs an Ariels Erfolgsmodell, der Red Hunter, orientierte.

1938 Ariel Red Hunter
Technisch enthielten die Kreationen Turners kaum Innovationen, aber sie offenbarten deutlich sein Talent als Designer sowie sein Gespür für den Geschmack der Kundschaft. Zu Turners Zeit, wie auch noch in den folgenden Jahrzehnten, beschäftigten Motorradhersteller keine Designer, die Formgebung war somit allein Sache der Ingenieure. Triumphs Design vor Übernahme durch Sangster, das zuletzt von Vale Page verantwortet wurde, wirkte etwas schwerfällig, altbacken, um nicht zu sagen plump. Turner machte das Erscheinungsbild von Triumphs neuen Einzylinder-Motorrädern dagegen moderner, leichter, heller und vor allem sportlicher. Und er erreichte dies unter Vermeidung eines kompletten Re-Designs, indem er nur einige, aber dann wesentliche Akzente setzte, wie beispielsweise ein zierlicherer und verchromter Tank, eine hochgeschwungene Auspuffanlage, verchromte Sattelfedern und ein verchromter Scheinwerfer sowie viel poliertes Aluminium am Motor selbst. Und weil Turner auch über ein gewisses Talent als Werber verfügte, sorgte er für ein einheitliches Firmenlogo und verpasste den neuen Motorrädern den aggressiv-griffigen Namen „Tiger“, der dann lediglich um die vermeintliche Spitzengeschwindigkeit der unterschiedlichen Typen, also Tiger 70, 80 und 90 (mph), ergänzt wurde. Die „neuen“ Motorräder wurden zu einem Erfolg und entstaubten zudem das bis dahin verschnarchte Image der Marke, woraufhin sich Turner daran machte den neuen Parallel Twin zu konzipieren. Auch hier setzte er auf seine Masche, technisch Bewährtes unter Beachtung wirtschaftlicherer Produktionskriterien in einem neuen, moderneren Gewand zu präsentieren, allerdings behalf er sich bezüglich der verbreiteten Skepsis der konservativen britischen Motorradfahrerschaft gegenüber Mehrzylindermotoren mittels eines Kniffs. Zu jener Zeit waren Doppelport-Motoren im Trend, Einzylindermotoren, die über zwei statt nur einen Abgasstrang verfügten, also zwei Krümmer und zwei Schalldämpfer für nur einen Zylinder. Technisch machte das wenig bis gar keinen Sinn, aber es entsprach wohl dem zeitgeistig ästhetischen Empfinden, vielleicht auch weil das Motorrad so in seiner Gestaltung symmetrischer wirkte. Nicht nur um eine grösstmögliche Gleichheit der Teile zu erreichen, lehnte Turner die Konstruktion seines 500 ccm Zweizylindermotors stark an den bereits bestehenden Tiger 70 Einzylindermotor mit 250 ccm an, sondern auch um den neuen Motor möglichst leicht und schmal halten zu können, konzipierte er den Zweizylinder gewissermassen als einen verdoppelten Tiger 70 Einzylinder, mit gleicher Bohrung, gleichem Hub und parallel laufenden gleich grossen Kolben der zwei 250 ccm grossen Zylinder. Das hatte neben konstruktiven Vorteilen und Kosteneinsparungen auch einen optischen Effekt, der neue 500 ccm grosse vertikale Twin war nur ein wenig breiter und nicht ganz zwei Kilogramm schwerer als der Tiger 90 500 ccm Einzylindermotor, passte deshalb problemlos in den gleichen Rahmen wie der Tiger 90 Einzylinder und konnte somit der kritischen Kundschaft mit seinen zwei Abgassträngen an jeder Seite sozusagen optisch als Doppelport-Einzylindermotor „untergeschoben“ werden. Dabei lief er ruhiger, liess sich leichter ankicken, war leiser und hatte bessere Beschleunigungswerte als der vergleichbare 500 ccm Einzylinder, zudem war die 5T Speed Twin 500 mit 75 Pfund nur 5 Pfund teurer als die Tiger 90.

1948 Triumph 5T Speed Twin 500
Mit anderen Worten: Dieses neue Motorrad war der von Sangster geforderte „instant success“, die 5T Speed Twin 500 wurde turner-typisch gestylt zum Verkaufsschlager, ein grosser Wurf, dem Turner nur zwei Jahre später einen weiteren Coup folgen liess: Die T100 Tiger 500. War die Speed Twin eher als Tourenmaschine ausgelegt, handelte es sich bei der T100 um ihre sportliche Schwester. Als Sportmaschine erhielt ihr Motor ein paar leistungssteigernde Goodies, zudem verfügte sie neben einigen anderen Ertüchtigungen über einen grösseren Tank, einen verstärkten Rahmen und eine ziemlich neu entwickelte Vorderradgabel. Das vielleicht wichtigste Feature aber, das der Marketingfuchs Turner ihr verpassen sollte, waren die drei Ziffern 1 0 0. Damit suggerierte Triumph, dass die Tiger in der Lage war, die 100 mph zu knacken. Und das auf einer massengefertigten Serienmaschine, die zwar nicht wirklich günstig, aber dennoch im Vergleich zu anderen leistungsstarken Motorrädern der damaligen Zeit wie beispielsweise Brough Superior für breitere Kundenkreise erschwinglich war. Und tatsächlich war dieser Tiger in der Lage die 100 mph zu knacken, allerdings musste man dazu die Endkappen der beiden Auspufftöpfe entfernen, die Turner natürlich nicht zufällig entfernbar gestaltet hatte. Aber auch mit diesen Endkappen war der Tiger immerhin noch für paarundneunzig mph gut, eine Spitzengeschwindigkeit, für die man sich seinerzeit als Motorradhersteller wahrlich nicht verstecken musste. Wenn auch Triumph so kurz vor dem Krieg nicht mehr vollumfänglich von Turners Kreationen profitieren konnte, schon gar nicht, nachdem die deutsche Luftwaffe das Triumphwerk 1940 in Schutt und Asche bomben sollte, hatte man dennoch mit dem Speed Twin für die Nachkriegszeit ein Ass im Ärmel, das im Verein mit einer dann neuen und modernen Produktionsstätte ein traumhaftes Potential entwickeln sollte. Denn Turner landete mit diesen beiden Motorrädern einen veritablen „Gameschanger“, der so überwältigend war, dass die allermeisten britischen Motorradhersteller nach dem Zweiten Weltkrieg nicht umhinkamen, dieses Erfolgsrezept und damit den Parallel-Twin zu kopieren, womit Turners Motor zum Archetyp dessen wurde, was man heute einen klassischen britischen Twin nennt. Immer noch assoziiert man den klassischen britischen Twin oft und vor allem und allein mit dem Gleichläufermotor, also den beiden Kolben, die gleichzeitig und parallel die Zylinderlaufbahnen herauf und runter donnern, wobei man verkennt, dass gerade die grazile und leichte Konzeption als verkappter Einzylindermotor dem britischen Twin seinen unnachahmlichen Charakter verleiht. Andere Motorradhersteller bauten auch Gleichläufermotoren, ein Motorrad mit diesem Motor ist u. a. die Laverda 750 SF. Allerdings orientierte man sich Ende der 1960er Jahre in Italien nicht an britischen Vorbildern, sondern an japanischen, so wurde das Motorengehäuse nicht vertikal, sondern horizontal gesplittet, um die Kurbelwelle anders als bei den Briten fünffach statt nur zweifach lagern zu können. Das sollte die Kurbelwelle bändigen, jedoch wurde der Motor der Laverda dadurch auch grösser und schwerer und damit das ganze Motorrad eher etwas für die Abteilung „Wuchtbrumme“. Das kann ganz sicher auch viel Spass und Laune machen, dennoch unterscheidet es sich fundamental von einem klassischen britischen Twin, der leichtfüssig, wendig und agil, angetrieben von unglaublicher Wucht, gleichsam wie ein Mountainbike mit einem 500, 650 oder 750 ccm grossen, aber dennoch verhältnismässig leichten Motor im Rahmen die Landstrassen entlang donnert. Turners Entwurf des Parallel-Twins war radikal, so radikal, dass damit in der Zukunft noch einige Schwierigkeiten verbunden sein werden, von denen er 1937 vielleicht noch nichts ahnen wollte.

1954 Triumph T100 Tiger 500
Die Schwierigkeiten, welche die Gruppe erwartet, die 1913 hoch zu Ross und in us-amerikanischer Kavallerie-Uniformen gekleidet an einem sonnigen Tag in ein texanisches Provinznest einreitet, um das dortige Büro der Eisenbahngesellschaft zu überfallen, sollten dagegen nicht allzu lange auf sich warten lassen und waren neben ihrer Kurzfristigkeit zudem auch noch ziemlich handfester Natur, weshalb es an dieser Stelle auch vollkommen unnötig ist, mehr als die fünf Überlebenden der kommenden Schwierigkeiten an dieser Stelle kurz vorzustellen, auch und gerade da sie nach ihrem Überleben die Hauptprotagonisten von Peckinpahs „The Wild Bunch“ stellen werden. Angeführt wird diese Banditenbande, die „Wild Bunch“, von Pike Bishop, einem langsam in die Jahre gekommenen Berufsverbrecher, ebenso schlitzohrig wie skrupellos, dem es bisher immer noch gelungen ist, sich dem Zugriff des Gesetzes zu entziehen, auch wenn der Verfolgungsdruck in den letzten Jahren immer grösser wurde, weshalb auch ein hohes Kopfgeld auf ihn aufgesetzt ist. Sein grösster Vertrauter innerhalb der Bande oder auch dieser sehr speziellen Interessengemeinschaft ist Dutch Engstrom, auch er bereits jenseits der allerbesten Jahre, ebenso skrupellos wie Bishop, aber nicht so analytisch berechnend wie er, sondern eher so der Typ Gemütsmensch, der Bishop seit vielen Jahren kennt und unbedingt loyal zu ihm ist. Ganz anders als die beiden Gorch Brüder, Lyle und Tector, deren Loyalität immer dem gilt, der am besten zahlt, immer auf der Jagd nach dem schnellen Dollar, brutal und ohne Gewissen, versuchen sie stets den maximalen Profit für sich herauszupressen, ohne die geringste Scham, andere, seien es Banditenkollegen oder Huren dabei zu übervorteilen. Und schliesslich Angel, ein Mexikaner in den Mittzwanzigern, der den Wirren des Bürgerkriegs in seiner Heimat entflohen ist, um hier in den USA sein Glück zu suchen, und der schon vom Alter her nicht zu den anderen passt, auch weil er als einziger so etwas wie einen moralischen Kompass zu besitzen scheint, welcher besonders empfindlich auf die Werte Familie, Heimat und Ehre reagiert.

Colt „Peacemaker“ Single Action
Diese fünf Männer, die später im Film noch durch Freddy Sykes, einem alten Mann, der seine besten Tage als Berufskiller nun wirklich schon gesehen hat, weshalb er für das operative Geschäft der Banditen nicht mehr zu gebrauchen ist und sich darum mehr um logistische Aufgaben, wie die Organisation von Fluchtpferden und ähnlichen Kram kümmert, komplettiert werden, verkörpern in Peckinpahs Film gewissermassen die Zeit der „American Frontier“ oder wenn man es etwas weniger prosaisch ausdrücken will, die Ära des „Wilden Westens“, Amerikas Pionierzeit, als der Zugriff des Individuums auf seine Lebenschancen – wenn man so will – noch ganz unmittelbar waren, da sich noch keine oder nur sehr rudimentäre institutionelle Ebenen zwischen dem Individuum und seiner Welt geschoben hatten, die diesen direkten Zugriff zuerst reglementieren und später dann immer mehr minimieren sollten. Insofern wird der Wilde Westen durch diesen „Wilden Haufen“ ganz gut symbolisiert, stellt er doch das „Negativbild“ einer – wenn auch idealisierten – Ära dar, in der sich das Individuum seine Lebenschancen im unmittelbaren Zugriff auf das Land oder seine Ressourcen erkämpfen konnte, so wie Gesetzlose wie Pike Bishop und Konsorten sich ihre Lebenschancen im durch Waffengewalt betonten direkten Zugriff auf die Ressourcen der aufkommenden Vertreter des „Gilded Age“ erkämpfen konnten, bis diese das Land immer besser in den Griff bekamen und dann die staatlichen Institutionen in den rechtsfreien oder gesetzlosen Rückzugsraum des Wilden Westens und der Banditen nachzogen, wenn sie nicht sogar anmassend vorgaben, den Staat selbst zu verkörpern, so wie dies Pat Harrigan, Vertreter der Eisenbahngesellschaft und damit auch Vertreter des Gilded Age, später im Film auch ausdrücklich vorgeben wird zu tun. Zunächst aber steht dieser Pat Harrigan auf dem Dach des Gebäudes direkt gegenüber des Büros der Eisenbahngesellschaft, das Pike Bishop und seine Kumpane gleich überfallen werden, weil Harrigan überall das Gerücht hat verbreiten lassen, in diesem Büro würden just an diesem sonnigen Tage im Jahre 1913 eine ganze Menge an Silberdollars aufbewahrt werden. Pat Harrigan wartet also auf Pike Bishop und seine Bande, diese Plage der Eisenbahngesellschaft, und mit ihm wartet eine Horde von Kopfgeldjägern, die Peckinpah im Folgenden als die Art Abschaum charakterisiert, die einen Mann von hinten niederschiesst, um die Leiche sodann bis auf die Stiefel zu fleddern, als auch Deke Thornton, ein ehemaliger Partner und Kumpan von Pike Bishop, der einst durch dessen Unvorsichtigkeit angeschossen und verhaftet worden war, daraufhin eine traumatische Zeit im Gefängnis verbrachte und nun eine Chance zur Bewährung erhalten hat, die ihm die restliche Haftzeit ersparen könnte. Und diese Chance auf Bewährung ist – wie könnte es anders sein? – das Ergreifen oder besser noch die finale Eliminierung seines alten Gefährten als auch des harten Kerns der ganzen Bande. Und tatsächlich erkennt Thornton seinen alten Partner, als dieser mit den anderen das Büro der Eisenbahngesellschaft betritt. Die Bande sitzt nun in der Falle und das Geschmeiss des Gilded Age, die Kopfgeldjäger, bereitet sich darauf vor, Bishop mitsamt Kumpanen nonchalant über den Haufen zu ballern, sobald sie das Büro wieder verlassen werden. Allerdings entdecken die Banditen den vorbereiteten Hinterhalt und bereiten sich ihrerseits, nachdem sie natürlich die Geldsäcke in ihren Besitz gebracht haben, auf den Ausbruch vor, für den Bishop auf den richtigen Zeitpunkt wartet, der eintritt, als eine Demo – ohne Witz! – ausgerechnet der „Temperance Movement“, an deren Kundgebung sie auf dem Weg zum Büro vorbeigeritten waren, die Mainstreet entlang marschiert kommt. Die „Temperance Movement“ ist eine – Veganer gabs damals noch nicht – anfangs rein religiös motivierte Anti-Alkohol Bewegung, deren historische Wurzeln zwar bis in das 18. Jahrhundert zurückreicht, und die zunächst nur für einen gemässigten oder „gottgefälligen“ Umgang mit Alkohol eintrat, sich aber mit den Jahrzehnten immer mehr radikalisierte und spätestens mit der Gründung der „Anti-Saloon League“ 1893 sehr wirkmächtig für das generelle Verbot von Alkohol einsetzte. Die Anti-Saloon League wurde so eine der Speerspitzen der Progressive Era, sie war die erste Nichtregierungsorganisation, die es meisterhaft verstand, moderne Kommunikationsmittel wie den Telegraphen, aber auch die damaligen Massenmedien, die Zeitungen, zu nutzen, um immensen politischen Druck auf die gewählten Volksvertreter auszuüben. Die Politiker fürchteten schlussendlich die Macht dieser NGO so sehr, dass sie der Prohibition 1919 mehrheitlich zustimmten, auch weil einige von ihnen wohl nicht zu Unrecht fürchteten, bei entsprechender Unbotmässigkeit von der League bei der geplanten Wiederwahl öffentlichkeitswirksam und diskreditierend zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und das ist also das Tableau, welches Peckinpah für den ersten Shoot-Out seines Films im Jahre 1913 an der Mainstreet eines verschlafenen texanischen Provinznests versammelt hat: Eine größtenteils abgehalfterte Ganoventruppe, die – jetzt aber wirklich! – den letzten grossen Coup durchziehen will und zwar und natürlich in der Natur und im Stil des alten Westens, der mittlerweile untergegangen ist, und die inzwischen gespannt hat, dass auf dem Dach gegenüber die Lakaien der neuen Herren, die sich nicht nur den Westen, sondern mit mehr als nur zwielichtigen Methoden das ganze Land unterworfen haben, auf sie warten, um diesen lästigen, den erquicklichen Geschäftsbetrieb ihrer Herren störenden Dinosaurier endlich, endlich das schon flackernde Lebenslicht gänzlich auszublasen, während sich gleichzeitig eine Demonstration der Temperance Movement nähert, deren marschierende Aktivisten im Auftrag bescheidwissender und selbsternannter Weltverbesserer unterwegs sind, welche sich jetzt ausgerechnet im Jahre 1913 anschicken sollten, mit zunehmend undemokratischeren Erpressungsmethoden immer massiveren Druck auf gewählte Volksvertreter auszuüben, um sie sechs Jahre später allein in ihrem Sinne und mit letztendlich grossem Erfolg entscheidend zu beeinflussen.

Und irgendwann konnte man auch bei Norton Motors Ltd. den grossen Erfolg von Edward Turners Speed Twin nicht mehr ignorieren, weshalb man im Frühjahr 1947, als sich in England die wirtschaftliche Situation nach dem grossen Krieg nur sehr langsam zu verbessern begann, einen gewissen Bert Hopwood anheuerte, um ebenfalls einen Parallel Twin zu entwickeln. Ob die Entwicklung eines Zweizylinderreihenmotors tatsächlich ein Herzenswunsch der Geschäftsführung von Norton Motors Ltd. oder nur dem von Triumph getriebenen Zeitgeist zu schulden war, denn so ziemlich alle britischen Motorradhersteller entwickelten oder verbauten seinerzeit bereits Zweizylinderreihenmotoren, darf man durchaus bezweifeln, denn der massgebliche Mann bei dieser sehr besonderen Firma war zu dieser Zeit ein gewisser Joe Craig, der zwar nicht die Geschäftsführung innehatte, sondern „nur“ Chef der Entwicklungsabteilung war, nachdem er vor einem Gastspiel bei BSA lange Jahre die Rennsportabteilung Nortons verantwortete. Wenn normale Motorradhersteller normalerweise einen Rennstall unterhielten oder unterhalten, so taten und tun sie dies, um durch Erfolge im Rennsport den Verkauf ihrer herkömmlichen Motorräder anzukurbeln. Bei Norton unter der Ägide von Joe Craig verhielt sich das gewissermassen umgekehrt, Norton Motors Ltd. war eigentlich ein Rennstall, der eine nervende Motorradherstellung unterhielt, die man blöderweise benötigte, um den Rennsport zu finanzieren. Treibende Kraft hinter dieser sehr sympathischen Geschäftsidee war nun eben dieser Joe Craig, selbst ehemaliger Rennfahrer und als Nortons Rennsportchef in den 1930er Jahren dafür verantwortlich, dass ein von Arthur Carroll 1930 entwickelter Eintopf über fast ein Jahrzehnt den internationalen Rennsport dominierte, gerade weil Joe Craig es meisterhaft verstand, Jahr für Jahr mehr und mehr PS aus einem zunehmend antiquierterem Motorkonzept zu quetschen. Die Erfolge der Norton Einzylinderrennmaschinen, die man dann ab 1947 offiziell „Norton Manx“ nannte, sind legendär und auch heute noch unerreicht, kein anderer Motorradtyp hat so viele Meisterschaften und Rennen gewonnen wie Craigs immer wieder getunter Norton Eintopf. Von 1931 bis 1939 allein sieben Mal die Isle of Man Senior TT (500 ccm Klasse) als auch die Junior TT (350 ccm Klasse), damals die bei Weitem wichtigsten Rennen der Saison, wobei man als Norton Werksfahrer oft unter sich auf dem Siegertreppchen war. Die Dominanz der Norton Einzylindermaschinen war in der Vorkriegszeit geradezu erdrückend, wer Rennen gewinnen wollte, musste erst einmal an Nortons Urviechern vorbei, was meistens ein Ding der Unmöglichkeit war.

Nach dem Krieg allerdings wurden die Karten allmählich neu gemischt, die Konkurrenz, vor allem die Italiener, holten auf mehrzylindrigen Maschinen auf, während Nortons Einzylinder trotz aller Tricks langsam an sein absolutes Limit zu kommen schienen. Konnten die 1947, 1948 Isle of Man Senior TT auf nur marginal veränderten Vorkriegsmaschinen gewonnen werden, gingen die Junior TT jener Jahre verloren und das sogar deutlich. Und es sollte noch schlimmer kommen, ab 1949 waren die Rennen auf der Isle of Man Teil einer neuen Grand Prix Weltmeisterschaft, die in insgesamt 6 Grand Prix Rennen auf den Rennstrecken Europas ausgetragen wurde. Norton konnte in der 500 ccm Klasse nur das Rennen auf der Isle of Man gewinnen, alle anderen gingen verloren, was dazu führte, dass Norton diese erste Grand Prix Serie auf einem ernüchternden fünften Platz abschloss. Die Zeiten, in denen man auf einem vorsintflutlichen Einzylindermotorrad sitzend der gesamten Weltelite eine lange Nase drehen konnte, schienen unwiderruflich zu Ende zu gehen, weil auch Joe Graig, ein ziemlich gewiefter Mechaniker aber kein Ingenieur, ganz offensichtlich mit seinem Latein am Ende war. Aber dann hatte er unverschämtes Glück, zu dem er auch noch fast gezwungen werden musste, denn zum einen wurde ihm 1949 der erst später so genannte „Featherbed-Rahmen“ angeboten, dessen Potential Joe Craig nach anfänglicher Skepsis endlich erkannte und zunächst exklusiv für Norton sichern konnte. Der Featherbed war für seine Zeit geradezu revolutionär und setzte einen neuen Goldstandard gerade für den Rahmenbau von Rennmaschinen, da er auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten stabil blieb und ein präziseres Lenken ermöglichen sollte. Und zum anderen war es Nortons Geschäftsführer, Gilbert Smith, irgendwie gelungen, sich die Dienste eines Ingenieurs mit rennentscheidenden Talenten zu sichern. Die Norton-Folklore behauptet beharrlich, dass dieser Leo Kuzmicki eigentlich als Reinigungskraft eingestellt worden war, bevor seine Fähigkeiten endlich erkannt wurden und er in die Entwicklungsabteilung wechselte. Eine Legende, die heute immer noch kolportiert wird, und die vielleicht ihre Ursache darin hat, dass Norton damals kein Interesse daran hatte, die Konkurrenz wissen zu lassen, woran Kuzmicki wirklich arbeitete, und Kuzmicki selbst wiederum beinahe schon notorisch öffentlichkeitsscheu und auch sonst sehr auf Diskretion bedacht war, was wiederum mit seinem Werdegang zu tun hatte. Leo Kuzmicki, 1910 im Süden Russlands geboren, floh mit seiner Familie in den Revolutionswirren 1917 nach Dubno, das heute ukrainisch ist, nach dem Ersten Weltkrieg aber zu dem wiedergegründeten Polen gehörte, er studierte in Lwiw (Lemberg) Ingenieurwesen, wobei er sich der Thermodynamik zuwandte und hier besonders intensiv der Optimierung von Brennräumen in Verbrennungsmotoren. 1932 wurde er in die polnische Armee eingezogen, 1933 zur polnischen Luftwaffe versetzt und bekleidete 1936 bereits den Rang eines Oberleutnants. 1939, nachdem Deutschland und die Sowjetunion Polen überfallen hatten, wurde er von der Roten Armee gefangengenommen und zusammen mit hunderttausenden Polen, die nicht wie 22.000 andere polnische Offiziere sofort erschossen worden waren, im heutigen Usbekistan interniert. Während dieser Internierung wurde Kuzmicki wie seine Kameraden immer wieder verhört und auch gefoltert. Erst nachdem Hitler die Sowjetunion überfiel, was Stalin zu einem Alliierten Englands werden liess, wurde Kuzmicki freigelassen und schlug sich mit einigen zehntausend polnischen Soldaten bis nach England durch, wo er als Offizier in der Royal Air Force diente. Nach seiner Entlassung 1947 entschied er sich in Großbritannien zu bleiben, da Polen nun in Gänze von der Sowjetunion besetzt war. Aber auch in seiner neuen Heimat fühlte er sich nie vollumfänglich sicher, denn aufgrund seiner traumatischen Erfahrungen während der Gefangenschaft fürchtete er – ob zu recht oder unrecht – auch in England den langen Arm des sowjetischen Geheimdienstes. Kuzmicki arbeitete zunächst bei AJW Motorcycles in der Entwicklung, ein Job, für den ihn ein Kamerad aus der RAF empfohlen hatte. Wie und warum er dann ausgerechnet 1949 bei Norton Motors Ltd. aufschlug, liegt im Dunkel der Geschichte, seine Anstellung erfolgte jedenfalls unter grosser Verschwiegenheit, so verschwiegen, dass anfangs nur wenige Mitarbeiter wussten, was seine eigentliche Aufgabe war. Wie sich aber schnell zeigen sollte, war Kuzmicki mit seinen Fähigkeiten der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz, um aus einem in die Jahre gekommenen Einzylindermotor das absolute Maximum an Leistung herauszukitzeln. Kann sein, dass er auch mal den Boden aufwischte, nötig wird es dieser sicherlich gehabt haben, aber seine Aufgabe in der Entwicklungsabteilung bestand in erster Linie darin, den Verbrennungsvorgang im Motor zu optimieren. Hierzu war einiges an Kärrnerarbeit notwendig, Kuzmicki feilte an vielen kleinen Details, von denen Joe Craig wahrscheinlich noch nicht mal wusste, dass es sie gab. Hauptsächlich durch Verbesserung der Brennkammer, der Quetschkanten und des Kolbens erreichte Kuzmicki eine bessere Gemischaufbereitung, was mitursächlich für eine optimale Ausbreitung der Flammenfront war mit anschliessend verbesserter Hitzeabfuhr. Mit anderen Worten: Was Kuzmicki da leistete, war eigentlich Pionierarbeit. Er machte Nortons Einzylinder sehr viel leistungsstärker und gleichzeitig zuverlässiger. Zwei Eigenschaften eines Rennmotors, die sich – zumal in dieser Zeit – eigentlich gegenseitig ausschlossen. Geoff Duke, englische Rennfahrerlegende und auch höchst erfolgreich auf Nortons oder Kuzmickis Manx unterwegs, erinnerte sich in seinen Memoiren:
„(…) Leo showed me a flat-topped piston with which he replaced the previous massively domed design. He explained me the theory of squish, which seemed so unconventional at the time. The net result was a phenomenal 30% increase in power. And that was on fuel with al lower octane rating than the present-day two star! After the way he transformed the singles I had great respect for him.“
Ein „Netto-Zuwachs“ von 30% an Leistung schaufelte dann letztendlich knapp über 50 PS ans Hinterrad. Und das aus einem luftgekühlten 500 ccm Einzylinder Anfang der 1950er Jahre. (!). Man brauchte nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, was auf den Rennstrecken Europas geschehen würde, wenn man so einen potenten aber vergleichsweise leichten und zuverlässigen Eintopf in einen äusserst spurstabilen Rahmen packt. Bereits 1950 gingen diese „neuen“ Manx an den Start, mit grossem Erfolg: Norton Maschinen belegten die ersten drei Plätze der Isle of Man Senior als auch der Junior TT, für den Weltmeistertitel reichte es jedoch noch nicht ganz, die Grand Prix Serie wurde mit nur einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Platz abgeschlossen, dafür gewann Norton jedoch die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft – was mehr als nur ein Trostpflaster war. Noch besser, ja, geradezu traumhaft lief es ein Jahr später für Norton, die Grand Prix Serie wurde mit vier Siegen gewonnen, unter den ersten 10 Plätzen der Isle of Man Senior TT zählte man insgesamt 9 (!) Norton und die 350 ccm Maschinen liefen auf den ersten 3 Plätzen der Junior TT ein. Das war mehr als nur eindrucksvoll für eine Einzylinderrennmaschine, deren Motor in seinen Grundzügen bereits 1930 entwickelt worden war. Die Norton Manx wurde auch und gerade durch diese Siege, denen noch weitere folgen sollten, zu einer Legende der Motorradgeschichte. Gefeiert für diese Erfolge wurden vor allem die McCandless Brüder aus Nordirland, welche den Featherbed entwickelt und ihn zunächst Triumph angeboten hatten, wo man ihn jedoch reichlich arrogant ablehnte, und natürlich Joe Craig, der Chef der Entwicklungsabteilung, welcher die Lorbeeren für die sehr überzeugende Motor-Performance gerne in Empfang nahm. Der Kriegsflüchtling Kuzmicki aber, ohne dessen bahnbrechende Entwicklungsarbeit auch der stabilste Rahmen kaum eine Siegchance gehabt hätte, wurde von Norton nicht nur für seine Leistung nicht gewürdigt, sondern geriet auch über die Jahre zunehmend in Vergessenheit.

Aber natürlich waren die Siege in den Jahren 1951 und 1952 wie immer im Motorsport nur Momentaufnahmen. Das heisst, Norton hatte durch die Entwicklungsarbeiten von McCandless und Kuzmicki lediglich Zeit gewonnen. Schon bald würde die Konkurrenz die Vorteile von Norton analysiert haben und ihre Rennmaschinen ebenfalls ertüchtigen. Craig wusste, dass Kuzmicki so ziemlich das Maximum an Leistung aus dem altehrwürdigen Eintopf herausgeholt hatte, sehr viel mehr war nicht mehr zu erwarten, zudem ist ein Einzylinderrennmotor einem Vierzylinderrennmotor nunmal konzeptionell unterlegen und zwar aufgrund gewisser physikalischer Gesetzmässigkeiten, die auch ein Kuzmicki nicht einfach wegzaubern konnte. Wollte Craig also auch in Zukunft gegen die Mehrzylindermotoren der Konkurrenz bestehen, brauchte er auf Sicht dringend einen modernen Ersatz für seinen erfolgreichen aber dennoch in die Jahre gekommen Rennmotor. Und so erwog er den Ankauf eines französischen Vierzylinderaggregats, testete einen liegenden Einzylinder und machte sich bezüglich Flüssigkeitskühlung schlau, allein, er hatte seine Firma fast zu Tode gesiegt. Norton Motors Ltd., immer chronisch klamm, jetzt aber komplett am Ende, wurde 1953 von Associated Motor Cycles (AMC) übernommen und danach, 1954, aus dem Renngeschehen zurückgezogen. Der Einzylinder-Rennmotor-Technologieführer Norton hatte für seine exzessive Rennleidenschaft, von 1947 bis 1954 sollte Norton alle Isle of Man Senior TT Rennen gewinnen, einen hohen Preis gezahlt. Geschätzte 90% aller Mittel der Entwicklungsabteilung flossen in diesen Jahren und auch davor allein in die Optimierung der Renntechnik. Und dabei war Norton mit einem Ausstoss von je nach Auftragslage 4.500 bis 9.000 Motorrädern jährlich eine Firma von vergleichsweise kleiner Grösse, welcher der Rennsport so dringend benötigte Ressourcen entzog. Bert Hopwood, der Mann, welcher für Norton den Twin entwickeln sollte, schätzte, dass Norton in jenen Jahren wenn überhaupt einen Gewinn von 7% vor Steuern auswies, dessen Löwenanteil auch noch von der Schwesterfirma R. T. Shelley, einem Werkzeugmacher, erwirtschaftet wurde. Folge des daraus resultierenden Investitionsstaus waren grotesk veraltete Produktionsbedingungen: Museumsreife Produktionsanlagen, umständliche und schon lange nicht mehr zeitgemässe Herstellungsprozesse in einem viktorianisch anmutenden Ambiente der frühen Industriellen Revolution. Die Anekdoten aus dieser Zeit sind zahlreich, exemplarisch ist vielleicht die Erinnerung von John Gill, der 1960 eine Stelle als Testfahrer bei Norton in Birmingham antrat und sich im dortigen Werk zunächst auf einem schwarzen Teppich unterwegs wähnte, bis er feststellen musste, dass es sich bei diesem „Teppich“ um eine dicke Schicht aus Öl und Dreck handelte, die auf dem Betonboden klebte, was vielleicht vor Jahren schon Kuzmicki verstört haben könnte. Die Arbeitsbedingungen in diesem kleinen Werk in Birmingham hatten nichts bis gar nichts von dem Glamour, den Norton sich zweieinhalb Jahrzehnte lang auf den Rennstrecken der Welt einfuhr. Der Alltag an der Bracebridge Street war viel mehr laut, eng, stickig und dreckig, oder wie es Steve Wilson in seinem Werk „Norton Motor Cycles From 1950 To 1986“ formuliert:
„The result was the paradox that Norton were world leaders who operated out of a slum.“
Wobei sich das sich das mit dem „world leader“ allein auf die Rennmaschinen bezog, die von einem kleinen und auserlesenen Teil der Kundschaft weiterhin käuflich erworben werden konnten. Auf den grossen Rest der Produktpalette Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre, den eigentlichen Brot-und-Butter-Motorrädern Nortons, strahlte wenig von dem Glanz der Triumphe auf der Isle of Man ab: Sie waren nicht nur altmodisch anmutende, sondern auch noch schwere Einzylinder, die zudem auch nicht sonderlich schnell waren, da die Modellpflege und Weiterentwicklung dieser Motorräder zugunsten des Rennsports unterlassen worden war.

Nortons erster Twin: Die Dominator 7
Und da war es vielleicht alles andere als ein ungeschickter Schachzug, die eigene Entwicklungsabteilung mit solchen Nebensächlichkeiten wie der Entwicklung eines eigenen Twin-Motors erst gar nicht zu belästigen und stattdessen mit Bert Hopwood im April 1947 einen Externen einzustellen und damit zu betrauen, zumal Bert Hopwood ein alter Bekannter von Ed Turner war, was aber in der damaligen britischen Motorradbranche nichts besonderes sein sollte, denn fast alle leitenden Figuren auf der technischen Ebene haben sich irgendwie gekannt und nicht selten mal miteinander gearbeitet, sei es bei Triumph, Ariel, Norton oder BSA. Oft zogen die einschlägigen Ingenieure von Laden zu Laden und streuten ihr Wissen branchenweit, was wiederum – man kann es kaum anders schreiben – zu einer gewissen technischen Inzucht führte. Bert Hopwood hatte bereits in den 1930er Jahren mit Turner unter Val Page bei Ariel gearbeitet. Page zog dann weiter zu Triumph, die er 1936 wieder verliess, um sich neuen Aufgaben bei BSA zu widmen, woraufhin Turner ihn bei Triumph beerbte, wohin er Bert Hopwood mitbrachte, der sich jetzt um den neuen Twin bei Norton kümmerte. Bei Triumph hatte Hopwood Turner geholfen, den Speed Twin zu entwickeln. Er kannte also die Stärken und auch Schwächen des Triumph-Aggregats sehr gut und war demzufolge bemüht, vor allem die Schwächen durch seinen Entwurf – unter Berücksichtigung von Nortons antiquierten Produktionsbedingungen und limitierten finanziellen Möglichkeiten – auszumerzen oder wenigstens abzumildern. So vereinfachte er beispielsweise den Motor, indem er anders als Triumph nur eine Nockenwelle verwendete, versuchte die thermischen Probleme des frühen Triumph-Aggregates auch dadurch zu entschärfen, dass er die zwei Auspuffports möglichst weit voneinander entfernt im Fahrtwind positionierte und die Tunnel für die Stösselstangen innen im Zylinderblock integrierte, anstatt die Tunnel als Rohre wie beim Speed Twin aussen am Motor zu verbauen, was eine Maximierung der Kühlrippen stark eingeschränkt hätte. Ausserdem ersetzte er die Steuerräder durch eine Kette und den Ventildeckel durch drei kleine Inspektionsdeckel, da er die Kipphebel mit in das Gussteil des Zylinderkopfes montierte. Die beiden wichtigsten Änderungen nicht nur gegenüber Triumphs Paralleltwin, sondern auch den allermeisten anderen britischen Gleichläufermotoren, die seit Turners Coup 1937 erdacht und konstruiert worden waren, betrafen das eigentliche Herz des Motors. Hopwood verpasste der zweifach gelagerten Kurbelwelle von Nortons Twin stärkere Lager und plante gleichzeitig einen geringeren Hub von nur 72,6 mm gegenüber Triumphs 80 mm. All das sollte, so war jedenfalls der Plan, Nortons ersten Zweizylindermotor ruhiger, standhafter, öldichter und kühler machen. Allerdings sollte Hopwood die Markteinführung des von ihm fertig entwickelten Motors nicht mehr an vorderster Front miterleben, nach internen Querelen und Streitigkeiten vor allem mit Joe Craig verliess er Norton bereits im Mai 1949 wieder. Nach dem Ausscheiden Hopwoods verfuhr man bei Norton wie seinerzeit bei Triumph, sie steckten den neuentwickelten Motor unverändert einfach in den alten, rudimentär hinterradgefederten Starr-Rahmen einer Einzylindermaschine, ein Jahr später dann in eine überarbeitete Version mit Schwingarm, nannten das Ganze Dominator 7, und beliessen es erstmal dabei, auch wenn sie mit dem Featherbed eigentlich ein besseres Kaufargument gehabt hätten. Der Featherbed litt anfangs jedoch unter chronischen Lieferschwierigkeiten, war zudem teurer und ausserdem argumentierte man bei Norton damit, dass man an den alten überarbeiteten Rahmen sehr viel besser so praktische Beiwagen befestigen konnte, was aber nicht den Tatsachen entsprach. Und so erlebt der Norton-Twin seine Markteinführung als das Aggregat einer Tourenmaschine. Entweder Craigs vernichtendes Verdikt wirkte nach oder man hatte bei Norton Grundsätzliches nicht begriffen, denn der Erfolg von Turners Speed Twin fusste doch gerade auf dessen Sportlichkeit. Aber auch wenn man der ersten Parallel-Twin Norton, der Dominator 7, zeitlebens bis zu ihrem Produktionsstopp 1955 den Featherbed-Rahmen verweigerte, so war Hopwoods Design dennoch ein grosser technischer Erfolg. Der 500 ccm Motor erwies sich gegenüber dem gleich grossen Triumphaggregaten als ebenbürtig, wenn er auch anfangs über etwas weniger Leistung verfügte, zudem war er vergleichsweise leicht zu starten, zuverlässig, beschleunigte gut und war – jooooah – vergleichsweise öldicht… Norton hatte jetzt einen mehr als nur konkurrenz- und – wie sich bald zeigen sollte – ausbaufähigen Twin, der jedoch aufgrund der altertümlichen Produktionsmethoden und der umständlicheren Montage des Motors auch mehr als 10% teurer war als eine vergleichbare Triumph. Ein Malus, der immer bestehen blieb, auch wenn die grosse Stunde des Norton-Twins noch bevorstehen sollte.
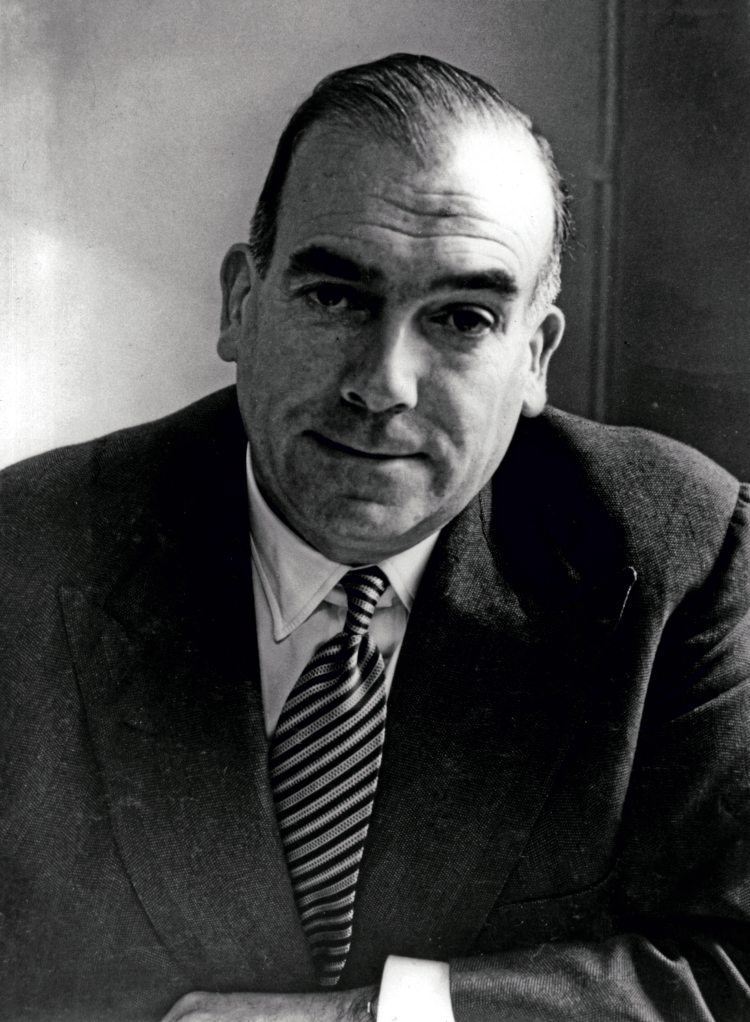
Dass sich die beiden Herren Craig und Hopwood in gegenseitiger Abneigung zugetan gewesen waren, wäre noch recht freundlich formuliert. In diesem Sinne ist auch bezeichnend, dass Craig lieber eigene Entwicklungsanstrengungen für einen Nachfolger des Manx-Motors unternahm oder gar Lösungen mit externen und auch noch französischen Entwicklungen andachte, statt auf den im eigenen Haus von Hopwood entwickelten Motor zurückzugreifen oder ihn wenigstens als Grundlage für rennspezifische Weiterentwicklungen heranzuziehen. Craig lehnte den eigenen Norton-Twin rundweg ab, ihm zufolge fehlte es dem Aggregat grundsätzlich an den für den Rennsport erforderlichen „dynamischen“ Genen. Ein durch persönliche Animositäten geprägtes Fehlurteil, wie sich spätestens ab 1955 zeigen sollte, als Bert Hopwood nach dem Ausscheiden Craigs zu Norton als Geschäftsführer zurückkehrte, sodann einen gewissen Doug Hele verpflichtete, der als Ingenieur bereits in früheren Jahren mit Kuzmicki an den Manx-Motoren gearbeitet hatte, und jetzt diese Rennaggregate, die sich bei privaten Rennställen immer noch grosser Beliebtheit erfreuten, wieder auf Vordermann bringen sollte. Doug Hele nahm sich später auch des Norton-Twins an, brachte ihn relativ schnell auf Manx-Niveau, sodass der von ihm entwickelte „Domiracer“- Prototype 1961 die Isle of Man TT auf einem sehr respektablen dritten Platz abschliessen konnte. Weiteres Renn-Potential war durchaus vorhanden, dessen Entwicklung aber wieder einmal aufgrund finanzieller Engpässe aufgegeben werden musste. In diesem Zusammenhang und in Fokussierung auf die wirtschaftlichen Umstände und die limitierten Möglichkeiten der Firma Norton erscheint das Wirken von Joe Craig in einem zunehmend schlechten Licht, war er es doch, der durch eine fast schon manische Fixierung auf Rennsporterfolge dem Unternehmen über Jahre hinweg wichtige Ressourcen entzog und somit – wenn auch natürlich nicht alleine, denn er war nie der Geschäftsführer – für die angespannte finanzielle Situation und die antiquierten Produktionsmethoden im Werk verantwortlich zeichnete. Das aber ist nur die halbe Wahrheit, der eine andere Hälfte entgegensteht, die auch heute noch in einem durchaus kräftigen hellen Licht erstrahlt, nämlich, dass gerade aus diesem dreckigen und hoffnungslos heruntergekommenen „Slum“ an der Bracebridge Street in Birmingham jene Maschinen gerollt wurden, die auf den Rennstrecken der Welt für Furore sorgen sollten und immer noch einen Ruf wie Donnerhall geniessen: Die „unerreichbaren“ Norton Manx.

The Unapproachable
Bishop wartet hinter den Glasscheiben des Eisenbahnbüros nicht mehr auf seine grosse Stunde, er wartet auf den richtigen Augenblick, sich aus der Falle, in der sich seine Bande und er befinden, herauszuwinden, und beobachtet hierzu den Demonstrationszug der „Temperance Movement“, der angeführt von einer Blasmusikkapelle langsam die Mainstream hinunter marschiert. Peckinpah lässt die Blaskapelle „Shall We Gather At The River?“ intonieren, ein amerikanisches Kirchenlied, welches durch die Offenbarung des Johannes inspiriert ist und hier auf eine besondere Stelle der Offenbarung nach Apokalypse und Jüngstem Gericht rekurriert, die Teil der Beschreibung der Neuen Welt Gottes ist:
„Und er zeigte mir auch den Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein.“ Offenbarung 22,1-4
Es ist die biblisch offenbarte Wiederherstellung der Stadt als Paradies, die in den Zeilen von „Shall We Gather At The River?“ durchklingt, deren Melodie jetzt die musikalische Einleitung sowie den Rahmen der kommenden Schiesserei liefert, indem sie die marschierenden Gläubigen auffordert, sich sinnbildlich an dem Fluss zu versammeln, der seine Quelle an dem Thron Gottes und des Lammes hat:
„Yes, we’ll gather at the river,
The beautiful, the beautiful river;
Gather with the saints at the river
That flows by the throne of God.“
Und so strömen die religiös motivierten Lämmer der „Temperance Movement“, diese Mutter aller NGOs, die Mainstreet entlang mitten durch die Stadt, die ihr Paradies werden soll, jedoch wachsen an den beiden Seiten ihres Flusses keine Bäume und schon gar keine aus dem Paradies, sondern stehen sich schwerbewaffnete Männer gegenüber, die so etwas wie ein strukturell bedingtes Missverständnis oder eine systembedingte Inkompatibilität miteinander austragen wollen, um nicht zu schreiben: Müssen. Die ersten beiden Amerika, die Vertreter der American Frontier, denen das weite Land noch eine kostbare Verheissung war, das Lebenschancen für Alle bereithielt, und die Vertreter des Gilded Age, die sich das weite Land zunehmend ökonomisch unterwarfen, bis sich diese Lebenschancen der Vielen in immer weniger Händen bündelten und dadurch die amerikanische Verheissung bis zur Unkenntlichkeit deformierten. Und so eine Gegenüberstellung kann natürlich nicht gut gehen, vor allem dann nicht, wenn ein paar wenige Dinosaurier der Frontier es partout nicht lassen können, die neuen Herren immer und immer wieder herauszufordern, weshalb ihnen jetzt das letzte Stündlein zu schlagen droht, wenn – ja, wenn – es Pike Bishop nicht gelingen sollte, die sich durch die aufmarschierende Temperance Movement bietende Gelegenheit beim frommen Schopfe zu packen.

William Holden als „Pike Bishop“ in The Wild Bunch
Aber Pike Bishop ist eben Pike Bishop und deshalb öffnet er die Tür des Büros der Eisenbahngesellschaft und schubst einen bemitleidenswerten Angestellten der Eisenbahngesellschaft durch dieselbe auf die Mainstreet, wohlwissend, dass die Kopfgeldjäger der Eisenbahngesellschaft nicht einen Moment zögern werden, um ausnahmslos alles, aber auch wirklich alles niederzuknallen, was sich durch eben diese Tür auf die Mainstream bewegt, wodurch Bishop auch die Teilnehmer der Temperance Demonstration in akute Lebensgefahr bringen wird. Aber Pike Bishop ist skrupellos, es ist ihm egal, dass die Schergen der Eisenbahngesellschaft den bemitleidenswerten Angestellten der Eisenbahngesellschaft augenblicklich unter Feuer nehmen und töten, so wie es ihm auch vollkommen egal ist, dass viele Teilnehmer der Demonstration getroffen werden und sterben, weil er entschieden hat, sie für sich und seine Bande als Deckung zu missbrauchen. Es ist ihm egal, dass die Kopfgeldjäger der Eisenbahngesellschaft unter diesen unschuldigen Lämmern ein Massaker anrichten, so wie es Harrigan, dem ranghöchsten Vertreter der Eisenbahngesellschaft vor Ort, egal ist, dass sein gekauftes Gesindel in der Gier auf das ausgelobte Kopfgeld keinerlei Probleme damit hat, unschuldige Männer und Frauen über den Haufen zu knallen. Peckinpah wurde später für die exzessive Gewaltdarstellungen in The Wild Bunch kritisiert, die im heutigen Licht, da der Zuschauer beispielsweise durch mehrere Narcos-Serien abgestumpft ist, in denen wahlweise mexikanische oder kolumbianische Ganoven sich in Zeitlupe gegenseitig die Schädelkalotte mittels einer abgesägten Schrottflinte entfernen, eher mild erscheinen. Allerdings erfüllen Peckinpahs Gewaltdarstellungen anders als die Schiessereien in den Narcos-Serien, die letztlich nur dem voyeuristischen Zuschauerbedürfnis dienen sollen, einen dramaturgischen Sinn. Peckinpah skizziert beide Gruppen, die Banditen als auch deren Verfolger, als allein von ihren Interessen geleitet, denen sie alles andere unterordnen. Werte oder gar eine höhere Moral scheinen ihnen vollkommen fremd zu sein, sie nehmen auf nichts und niemanden Rücksicht und gehen für ihre Ziele, ein paar Silberdollars, Kopfgelder oder den Tod ihrer Widersacher, sprichwörtlich auch über die Leichen Unschuldiger. Vielleicht könnte man zur Entschuldigung zumindest der Banditen anfügen, dass sie lediglich auf ihre Verfolger schiessen und die Demonstranten „nur“ als Deckung nutzen, dennoch nehmen sie die Kollateralschäden nicht nur billigend in Kauf, sie profitieren auch noch von dem sich einstellenden und tödlichen Durcheinander, das ihren Verfolgern die klare Definition ihrer Ziele erschwert.

Sam Peckinpah während der Dreharbeiten zu The Wild Bunch
In diesem Sinne sollte sich Peckinpahs Replik auf die Kritik an den für die damalige Zeit exzessiven Gewaltdarstellungen in seinem Film, er verstehe diese als eine Allegorie zu den Kriegsberichten aus Vietnam, die in jenen Jahren zur Abendessenszeit über amerikanische Mattscheiben flimmerten, und wolle seinem Publikum „eine Idee davon geben, wie es ist, nieder geschossen zu werden“, grausam bewahrheiten, denn kurz vor dem Kinostart des Films im Sommer 1969 sickerten die ersten Nachrichten von dem Massaker in My Lai in die amerikanische Öffentlichkeit, bei dem im Frühjahr 1968 amerikanische Soldaten auf der Suche nach dem Vietcong, der sich immer wieder geschickt ihrem Zugriff entziehen konnte, und deren vermeintlichen Unterstützern nach dem zynischen Motto „Kill them all and let God sort them out“ ein ganzes Dorf ausradierten und 504 Vietnamesen, darunter auch Frauen, Kinder und Greise umbrachten. Das Massaker auf der Mainstreet in Peckinpahs Film nimmt My Lai – ohne dies zu wollen – gewissermassen cineastisch vorweg, fast schon unheimlich deutlich wird dies als Crazy Lee, ein etwas debiles Bandenmitglied, den Pike Bishop beordert hat, im Büro der Eisenbahngesellschaft zu verbleiben, um die dort anwesenden Angestellten und Kunden zu bewachen, damit sie ihm und seinen Kumpanen bei ihrem Ausbruchsversuch nicht in den Rücken fallen können, einen Blick aus den Fenster wirft und das Ausmass der sich abspielenden Katastrophe sofort erfasst:
„Man, they’re blowin’ this town all to hell!“
Wenig später wird er seine Gefangenen unter vorgehaltener Waffe zwingen, wieder das alte Kirchenlied „Shall We Gather At The River?“ anzustimmen und sie dann auch noch als eine Art dreiköpfige Mini-Demonstration im Büro herumzuscheuchen, während er lauthals mitsingt:
„Gather with the saints at the river,
That flows by the throne of God“
und draussen auf der Mainstreet die ursprünglichen Demonstrationsteilnehmer der Temperance Movement zusammengeschossen werden.

Die Schiesserei auf der Mainstreet
Und das ist natürlich die Pervertierung des Kirchenliedes und Peckinpahs Verdeutlichung, dass hier am Fluss natürlich nicht das versprochene Paradies wartet, sondern jederzeit die reine Hölle ausbrechen kann, in der neben Recht, Gesetz und ethischen Normen auch christliche Werte keinerlei Bedeutung haben und statt ihrer allein diejenigen die Ansagen machen, die gerade am Drücker sind oder anders formuliert: Den Finger am Abzug haben, und das sind im Moment und zum Unglück der Bürger als auch der Banditen eben die Herren des Gilded Age, deren örtlicher Vertreter, Eisenbahnagent Pat Harrigan, das auch nochmal deutlich gegenüber den Offiziellen der Stadt ausspricht, die ihn, nachdem die letzten Überlebenden der Wild Bunch haben fliehen können, sich somit die Schiesserei gelegt hat und die Kopfgeldjäger beginnen die Leichen zu fleddern, zur Rechenschaft für dieses Massaker ziehen wollen: „Ohne die Eisenbahn wäre dies hier immer noch ein lausiges kleines Nest!“, lässt er sie wissen und „We represent the law!“. Für Pat Harrigan liegen die Dinge ziemlich klar auf der Hand, die neuen Herren nicht nur des Westens hatten sich das Land durch dessen industrielle und infrastrukturelle Erschliessung untertan gemacht und sahen sich dadurch auch im Recht, von der Bevölkerung furchtbarste Opfer einfordern zu können.

Ist es eigentlich eine Binse, dass Geschichtsschreibung nicht gerecht ist? Wahrscheinlich schon. Und deshalb verwundert nicht, dass auch die Schreibung der Motorradgeschichte nicht gerecht ist und so die Verdienste eines Mannes, der ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass sich das Motorrad vom Transportmittel der Minderbetuchten und des Proletariats zu einem Freizeitspass oder auch Lifestyle-Accessoire so ziemlich aller gesellschaftlichen Schichten entwickeln konnte, in die Vergessenheit dämmerten. Und dieser Mann erblickte im Jahre 1905 in den USA oder genauer: In Winnemucca, Nevada, das Licht der Welt. Der Sohn eines Vize-Präsidenten der Bank of America, also Spross einer ziemlich wohlhabenden Familie, von dem aufgrund seiner Herkunft eigentlich nicht erwartet werden konnte, dass er in etwas mehr als 30 Jahren einen heftigen Motorradfimmel entwickeln sollte, der eben der weiteren Entwicklung des Motorrades einen ganz entscheidenden Spin gab. Aufgewachsen in Californien, schlug er zunächst die typische Karriere eines Abkömmlings der amerikanischen Upper-Class ein, er studierte Jura an der Stanford University und an der University Southern California Law School und eröffnete nach seinem Abschluss eine Anwaltskanzlei in Los Angeles. Bis dahin zeigte Bill Johnson eigentlich null Interesse an dem, was später sein Lebensinhalt als auch -werk werden sollte, bis er 1936 seinen Urlaub auf Hawaii verbrachte, wo er einem kuriosen motorisierten Zweirad begegnete, welches seine Neugier erregte. Das Salsbury Moto Glide war in der Tat ein sehr spezielles Gefährt, zumal für die USA, dem Land der grossen Entfernungen, die es gemäss des American Way of Life doch möglichst komfortabel zu überwinden galt, denn bei diesem Gefährt handelte es sich um einen ziemlich minimalistischen… äähh… Scooter:

Auch wenn dieser Scooter noch ein wenig improvisiert aussah, so hatte er 1936 im Prinzip schon fast alles an Bord, was zehn Jahre später in Italien die erste Vespa zu einem grossen Erfolg werden liess. Ein sehr kompaktes Design, sparsamer Heckantrieb, Sitzmöglichkeit, rudimentäre Beleuchtung, Hupe und Bremse. Bereits 1938 präsentierte Salsbury eine stark verbesserte Version seines Moto Glide.
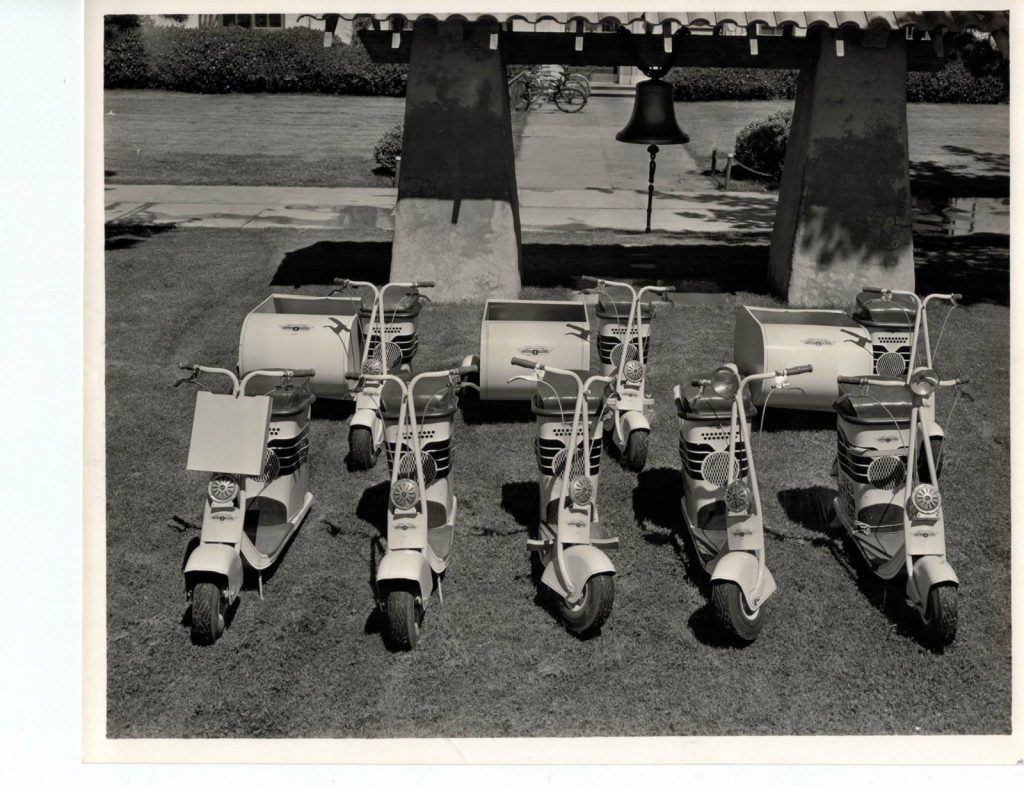
Das neue Modell verfügte jetzt über eine Kupplung, somit war es nicht mehr notwendig, den Motor nach jedem Stop neu zu starten, sowie über ein stufenloses automatisches Getriebe, eine bahnbrechende Neuentwicklung Salsburys, die das Schalten überflüssig machte. Das Moto Glide war damit seiner Zeit weit voraus, erst Jahrzehnte später sollte Piaggio seinen Vespas vergleichbare Technik gönnen. Salsburys Scooter machte das Rollerfahren somit einfacher und sicherer und wurde zum Leitbild der zweiten Generation dieser Fahrzeuggattung, deren erste Generation sich zwischen 1915 bis 1930 aufgrund teilweise eklatanter Sicherheitsmängel nicht auf Dauer bei der Kundschaft durchsetzen konnte. Salsbury jedoch entwickelte seinen kleinen Roller beharrlich und über die Jahre weiter, machte ihn komfortabler und alltagstauglicher, Endpunkt war das Model 85, welches 1947 endlich vollumfänglich als eigentlicher Stammvater der modernen Roller zu erkennen war.


DeLuxe Version mit Windschutzscheibe
Der Legende nach hatte sich E. Foster Salsbury ursprünglich von der Flugpionierin Amelia Earhart inspirieren lassen, die er in den 1930er Jahren auf dem Flughafen von Oakland beim Fahren eines Scooters der ersten Generation – vermutlich handelte es sich hierbei um einen Autoped Scooter – beobachten konnte.

Amelia Earhart (links) 1935 zusammen mit ihrer Flugschülerin auf einem Scooter. Anders als oft behauptet, handelt es sich bei diesem Scooter nicht um einen Autoped Scooter und schon gar nicht um einen E-Scooter. Entweder sind die beiden Damen auf einem unbekannten Vehikel unterwegs, das Salsburys Moto Glide allerdings sehr sehr ähnlich sieht… Oder sie fahren auf dem 1935er Prototype des Moto Glide
Allerdings bot der Autoped Scooter, der in den USA von 1915 bis 1921 und in Deutschland in Lizenz von Krupp von 1919 bis 1922 gefertigt wurde, noch keine Sitzmöglichkeit, auf ihm musste man noch stehen. Dennoch war es nicht Salsbury, der den Rollerfahrern als Erster eine Sitzmöglichkeit spendierte, auch hier gab es frühe Vorläufer.

Autoped 1919
Den ABC Scootamota (Der hiess wirklich so), komplett mit Heckantrieb, Sitzmöglichkeit, Licht und anderem Geraffel.

ABC Scootamota 1919-1922
Aber schon das nominell allererste seriengefertigte Motorrad der Welt, das Hildebrand & Wolfmüller von 1894, war – seien wir ehrlich! – eigentlich ein Roller.

Hildebrand & Wolfmüller (1894)
Johnsons Motorradfieber war – wenn auch durch einen Roller – jedenfalls entfacht und zwar so gründlich, dass er nicht nur einen Salsbury Motor Glide kaufte, sondern zusammen mit seinem Schwager gleich Teilhaber der in Los Angeles ansässigen Salsbury Corporation wurde. Erst einmal angefixt, wurde er auch ein begieriger Leser britischer Motorradzeitungen und entschloss sich schliesslich zum Kauf einer Ariel Square Four, also jenes versponnenen Motorrads mit den vier im Quadrat angeordneten Zylindern und den zwei Kurbelwellen, welches Edward Turner seinerzeit entworfen und Ariel gebaut hatte. Und eben diese Kaufentscheidung offenbart die Denke Bill Johnsons, denn kein Mensch, der einigermassen technisch beschlagen oder sonstwie bei Trost ist, kauft sich ein Motorrad, das so „sophisticated“ ist, wie es „sophisticateter“ eigentlich gar nicht mehr geht, eindeutig overengineerd und zudem mit Motorüberhitzungsgarantie bei längeren Fahrten oder dauerhaft hohen Drehzahlen.

Bill Johnson auf seiner Ariel Square Four
Johnson sah die Sache aber offenbar anders und eben dieses „anders“ war ganz entscheidend, denn er betrachtete die Ariel nicht „nüchtern“ wie ein Mechaniker oder Ingenieur dies tun würde, sondern eher mit den Augen des Enthusiasten. Ähnlich verhielt es sich mit dem Salsbury Scooter, sollte dieser zunächst vielleicht mit dem Gedanken entworfen worden sein, ein möglichst günstiges Nahverkehrsmittel auf den Markt einer von der Grossen Depression gebeutelten Nation zu bringen, das auch ärmeren Schichten die Teilnahme am urbanen Individualverkehr ermöglichen konnte, kam es „anders“, denn es trat eher ein umgekehrter Effekt ein, der Scooter wurde anfangs zum Spielzeug einer progressiven Elite, die auch in der Wirtschaftskrise über genug Kleingeld verfügte, sich so einen „hippen“ Spass leisten zu können. Denn wenn auch der Scooter zeitweise „the latest thing!“ in Californien war und Stars wie Bing Crosby, Rita Hayworth oder Olivia de Havilland sich gerne auf ihm ablichten liessen, der Salsbury Moto Glide wurde nie ein Gefährt für die Massen, im ersten Jahr, 1936, verkaufte Foster Salsbury vielleicht 300 von seinen Scootern, 1947, im letzten Jahr des Bestehens von Salsbury Motors, die Firma war zwischenzeitlich von dem Luftfahrtkonzern Northrop akquiriert und unbenannt worden, fertigte man schätzungsweise 6.500 Scooter. Das war entschieden zu wenig, um die Profitzone zu erreichen, zumal die Produktionskosten jedes einzelnen Rollers mittlerweile so hoch waren, dass selbst grössere Steigerungen der Produktionszahlen es kaum erwarten liessen, jemals die Gewinnzone zu erreichen. Northrop zog schlussendlich die Notbremse und liess seine Tochterfirma 1947 bankrott gehen. Die Firma wurde dann noch zweimal verkauft und stellte die Produktion 1950 schliesslich gänzlich ein. Das aber sollte E. Foster Salsburys Schaden nicht sein, er konzentrierte sich mit seiner eigenen Firma Salsbury Corporation auf die Produktion und den Vertrieb des stufenlosen automatischen Getriebes, dessen geistiger Eigentümer er klugerweise geblieben war, und das mit grossem Erfolg. Diese im Deutschen auch Umschlingungsgetriebe genannten technischen Wunderwerke fanden Einsatz in vielfältigen Kleinfahrzeugen wie beispielsweise in Rollern, Baustellenfahrzeugen, Wasserfahrzeugen, Buggys oder Golfcarts. So wird auch geschätzt, dass 1970 90% aller Schneemobile weltweit mit Salsburys Getriebe unterwegs waren. 1969 verkaufte er seine Firmenanteile als reicher Mann.
Dass die Salsbury Scooter Corporation 1947 das erste Mal pleite gehen sollte, konnte Bill Johnson 1936 noch nicht wissen, vielleicht aber begriff er den anfänglich einsetzenden Hype um den Scooter unter den bemittelten „Enthusiasten“ als Chance für die Zukunft des Motorrads in den USA. Nach Ende des Ersten Weltkriegs stieg Harley-Davidson zum grössten Motorradhersteller der Welt auf. Harleys spiegelten gewissermassen die geographischen, klimatischen und infrastrukturellen Anforderungen der USA an motorisierte Zweiräder wieder. Sie waren robust gebaute, schwere Maschinen mit grossen Motoren und Tanks, die ihr enormes Kraftpotential bereits bei mittleren Drehzahlen entfalteten und so ein komfortables Überbrücken von grösseren Distanzen ermöglichen sollten. Jedoch kam der bislang grösste Motorradhersteller der Welt bald unter Druck und nicht nur er, Ende der 1930er Jahre verblieben in den USA von mehreren Herstellern nur noch Harley-Davidson und Indian Motorcycle am Markt. Den Rest hatte nicht ausländische Konkurrenz zur Strecke gebracht, sondern vielmehr inländische Innovation, die Ford Motor Company hatte die Massenproduktion von Autos entwickelt und etabliert, in deren Folge immer erschwinglichere Autos die Strassen eroberten und die Motorräder nach und nach verdrängten, zudem litten die Motorradfahrer in den USA zunehmend unter einem schlechten Image, sie galten als schmutzige „greaseballs“, die sich noch nicht mal ein günstiges Auto leisten konnten, und denen man deshalb mit Spott und Verachtung begegnete. Die massiven Verluste an Marktanteilen in der Heimat konnten die amerikanischen Hersteller durch Exporte nicht ausgleichen, da sie zum einen relativ teuer waren und vor allem eher in Ländern Absatz fanden, in denen wie beispielsweise Kanada und Australien ähnliche geographische und klimatische Bedingungen herrschten, und zum anderen eine andere Nation, Deutschland, mit seinen Exporten in vielen Ländern, und hier vor allem in Europa, Südamerika und Asien, eine immer dominierendere Stellung einnahm, die auch den britischen Herstellern zunehmend zu Schaffen machte. 1928 produzierten die Briten insgesamt 147.000 Maschinen, von denen über 59% in den Export gingen. 1937 produzierten sie nur noch 82.014 Motorräder, die Deutschen mit 171.239 mehr als doppelt viel und die Amerikaner in toto lediglich marginale 17.700 Stück, was die Bedeutung des Autos in den USA noch einmal deutlich unterstreicht. Die Deutschen hatten den Briten auf vielen Exportmärkten den Rang abgelaufen, diese exportierten jetzt hauptsächlich noch in ihre Kolonien und den Commonwealth und beklagten sich ansonsten über unlauteren Wettbewerb, da NS-Deutschland seine Industrie subventionieren würde. Wenn überhaupt, so war dies aber nur die halbe Wahrheit, Ted Mellors, ein bekannter englischer Rennfahrer in jener Zeit, der auf beiden Seiten des Ärmelkanals Motorradrennen fuhr und 1939 die Lightweight Tourist Trophy auf einer Benelli gewinnen sollte, sah die Ursache für den deutschen Erfolg weniger in den Subventionen als vielmehr in der Tatsache, dass die Deutschen ein geschickteres Marketing machten, sie seien klug genug, so meinte er, ihren Kunden das zu verkaufen, was diese verlangten, anstatt zu versuchen ihnen das aufzudrängen, was sie gar nicht wollten. Und in der Tat war da etwas dran, die Deutschen hatten nicht nur ein ausdifferenzierteres Produkttableau, sondern stellten vor allem leichte Motorräder bis zu einem Hubraum von 200 ccm her. 1936 entfielen in Deutschland 60,5% aller Zulassungen von Motorrädern auf Motorkapazitäten bis zu 200 ccm, schon 1938 stieg dieser Anteil noch einmal auf 72% an. Das waren die Brot-und-Butter-Motorräder der Deutschen, und das war auch der Grund für ihren Exporterfolg: Leichte, einfache, aber grundsolide Motorräder, robuste Einzylinder-Zweitakter, billig in der Anschaffung, günstig im Unterhalt und zudem in vielen Ländern ohne Führerschein offiziell fahrbar. Dass die kleinen Dinger auch richtig schnell sein konnten, bewies Ewald Kluge 1938 bei der Tourist Trophy als er mit seiner Renn-DKW ULD 250 11 Minuten und 10 Sekunden vor dem Zweitplatzierten ins Ziel kam. DKW baute auch grössere Motorräder, beispielsweise die Super-Sport 600, aber es waren die leichten Motorräder, welche die Stückzahlen brachten, die DKW Ende der 1920er Jahre zum grössten Motorradhersteller der Welt werden liessen. Gegen diese „Leichtgewichte“ hatten die britischen Hersteller einen schweren Stand, denn erstens hatten sie kaum bis keine Motorräder in dieser leichten Motorenklasse im Angebot und zweitens waren ihre Motorräder von einer ganz anderen Art. DKW und die anderen deutschen Motorradhersteller bauten zumindest in der Breite „Vernunft-Motorräder“ für Menschen, die möglichst schnell, individuell und günstig von A nach B kommen wollten, und die Motorrad fuhren, weil sie sich kein Auto leisten konnten. Die britischen Hersteller, die ihre Motorräder vornehmlich mit grossen und mittelgrossen Motoren bestückten, bauten in der Breite hingegen ambitionierte, sportliche, teurere und zuweilen „very sophisticated“ Maschinen für Enthusiasten, die leidenschaftlich gern Motorrad fuhren. So gesehen hatte die britische Industrie angesichts abschmelzender Exportraten nur zwei Möglichkeiten, entweder sie fingen an, auch endlich etwas langweilige „Vernunft-Motorräder“ zu bauen, womit sie aber Gefahr laufen würden, ihren Maschinen den unvergleichlichen britischen Charakter zu nehmen, oder sie suchten sich für ihre „leidenschaftlichen“ Maschinen einen Absatzmarkt mit vielen Enthusiasten. Dazu brauchte es aber eine avancierte und prosperierende Gesellschaft, in welcher der Individualverkehr schon fast vollständig durch das Auto gewährleistet wurde, wodurch die DKWs für pekuniär verhinderte Autofahrer keinerlei Marktchancen hätten, und wo die Menschen auch über genug Geld und Freizeit verfügten, um einem nicht ganz so billigen Hobby nachzugehen. Und nicht nur deshalb hatte Edward Turner zusammen mit Jack Sangster schon mehr als nur ein Auge auf den nordamerikanischen Mark geworfen, als 1936 ein Schreiben aus Californien von einem gewissen Bill Johnson seinen Weg auf Turners Schreibtisch fand. Johnson lobte darin Turners Entwicklung, die von ihm jüngst erworbene Ariel Square Four, und schrieb im Folgenden ein bisschen Benzin mit ihm. Es entspann sich eine regelmässige Korrespondenz zwischen den beiden, in welcher Johnson vielleicht auch über seine Erfahrungen mit der Salsbury Motor Glide berichtete, auf jeden Fall verlieh er aber seiner Überzeugung Ausdruck, dass sowohl für Ariel aber auch für Triumph in Californien ein erfolgversprechender Absatzmarkt bestünde. Und das musste Turner wohl aufhorchen lassen, denn bis dato und ab 1926 bestand Ariels und später dann auch Triumphs glorreiche Niederlassung in den USA aus einem „Showroom“ in der New Yorker Bronx, der von einem gewissen Reggie Pink geführt wurde, seines Zeichens passionierter und bekannter „Hillclimbing“-Rennfahrer, der über diese sehr speziell amerikanische Passion auch sein Interesse an den im Vergleich zu den amerikanischen Motorrädern verhältnismässig leichten britischen Maschinen entdeckt hatte. Reggie Pink war nie „offizieller“ Ariel- und Triumphvertreter, vertrieb nebenbei auch noch die Motorräder anderer Marken, hatte auch ein paar Franchises am Laufen und verkaufte seine Motorräder hauptsächlich per Inserat in einschlägigen Magazinen und per Mailorder. Seine Verkaufszahlen waren übersichtlich, auch weil sein Lagerbestand relativ klein war und er so kaum Vorführexemplare für interessierte Kundschaft bereithalten konnte. Kurzum, wenn tatsächlich in Californien ein lukrativer Markt bestehen sollte, dann war Turners Ostküsten-Teilzeit-Repräsentant Reggie Pink ziemlich weitab vom Schuss. Nicht nur in Zeiten der wirtschaftlichen Krisen – und die Grosse Depression war eine ziemlich ausgewachsene wirtschaftliche Krise, welche das Land auch 1936 immer noch lähmte und fesselte – war die Wahl des richtigen Standorts ein ganz entscheidender Punkt. Was in Oklahoma City oder Newark aufgrund der wirtschaftlichen Situation zwangsläufig hätte scheitern müssen, hatte vielleicht im südlichen Californien Chancen zu reüssieren. Denn Southern California war „anders“. Und das hatte vor allem einen Grund, und der hiess Hollywood. Als Franklin D. Roosevelt 1933 seine Antrittsrede als frisch gewählter 32. Präsident der Vereinigten Staaten hielt, ist vor allem ein Satz im Gedächtnis seiner Landleute hängen geblieben:
„Die einzige Sache, die wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst.“
Roosevelt wurde vor allem für sein Versprechen gewählt, die Wirtschaftskrise zu bekämpfen, ein Vorhaben, bei dem sein Vorgänger Hoover glücklos geblieben war. Roosevelt Rezept hierzu war der sogenannte „New Deal“, der im Wesentlichen aus staatlichen Investitionen und sozial- und wirtschaftspolitischen Reformen bestand. Und in der Tat halfen diese Massnahmen dabei, die Wirtschaftskrise dann anfangs der 1940er Jahre auch endlich zu überwinden. „Half“, weil Wirtschaftskrisen ja immer auch ein gewisses psychologisches Moment zueigen ist, also das, was Roosevelt mit „der Furcht vor der Furcht selbst“ gemeint haben muss. Die Amerikaner brauchten in den Jahren des wirtschaftlichen Elends, der Armut und des Hungers neben den Instrumenten des New Deals auch Ertüchtigungen zur Zuversicht, das heisst, auch die „Furcht vor der Furcht selbst“ musste erfolgreich bekämpft werden. Und bei diesem psychologischen Kampf gegen die Grosse Depression hatte Roosevelt eine mächtige Verbündete, von der nicht Wenige meinen, dass sie den massgeblichen Anteil daran hatte, die wirtschaftliche Krise zu überwinden, da sie den Amerikanern in diesen elendigen Zeiten Hoffnung gab: Die Traumfabrik, welche ausgerechnet während der Grossen Depression oder vielleicht auch gerade deshalb ihr eigenes Goldenes Zeitalter begründete. Menschen, zumal in diesen elend schwierigen Zeiten, brauchen Träume, Hoffnung und Zuversicht. Und Hollywood lieferte zuverlässig, 1927, also erst zwei Jahre vor Beginn der Wirtschaftskrise, flimmerte mit „The Jazz Singer“ der erste Tonfilm in Spielfilmlänge über die amerikanischen Leinwände, ein damit noch sehr junges Medium, das sich in den folgenden Jahren erst landesweit technisch etablieren sollte, aber von Anfang an eine grosse Faszination auf die Amerikaner ausübte. Man schätzt, dass in den Jahren der Wirtschaftskrise durchschnittlich 80 Millionen Amerikaner regelmässig ein Kino besuchten, um ihrem Elend wenigstens für die Länge eines Spielfilms zu entfliehen – und zwar wöchentlich. Eingangs der Depression betrug diese Zahl noch 110 Millionen, aber auch die Traumfabrik musste in der Krise Federn lassen, die Zuschauerzahlen fielen bis 1933, dem bittersten Jahr der Krise mit einer Arbeitslosenquote von 25%, auf immerhin noch 60 bis 75 Millionen. Die Umsätze an den Tickethäuschen der Kinos fielen von 732 Millionen § im Jahr 1930 auf 482 Millionen $ in 1933. Die Filmstudios gerieten wirtschaftlich ins Schlingern, produzierten aber unverdrossen weiter und schafften 1934, auch unterstützt durch Roosevelts Neuordnung des Bankenwesen, die Wende. Hollywood hatte auf die wirtschaftliche Bedrohung vor allem mit einer Explosion der Kreativität reagiert, nachdem die Bedürfnisse und Wünsche der Zuschauer genauestens analysiert worden waren. Die Filmgenres wurden ausdifferenziert, technische Neuerungen vorgestellt wie den ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm, Schneewittchen und die sieben Zwerge von Disney, der noch heute inflationsbereinigt unter den zehn finanziell erfolgreichsten Filmen aller Zeiten rangiert, als auch immer aufwendiger produziert. Klassiker der Filmgeschichte entstanden in diesen Jahren: „Citizen Kane“, „King Kong“, „Tarzan“, „Modern Times“, „The Wizards Of Oz“, „Frankenstein“, „Scarface“ und „Gone With The Wind“, um nur einige wenige zu nennen. Und mit ihnen stiegen Schauspieler zu Megastars auf: Katherine Hepburn, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Stan Laurel & Oliver Hardy, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin, Ginger Rogers, Clark Gable und natürlich Shirley Temple, heute ein wenig in Vergessenheit geraten, war sie von 1935 bis 1938 der Filmstar mit dem grössten Umsatz, und Präsident Roosevelt soll ihr gedankt haben, dass der Kinderstar „…Amerika mit einem Lächeln durch die Depression führt.“

First Lady Eleanor Roosevelt und Shirley Temple 1938
Bereits 1936, als die Korrespondenz zwischen Johnson und Turner ihren Anfang nahm, erreichte der Umsatz an den Tickethäuschen wieder eine Höhe von 626 Millionen $, eine Steigerung von fast 30% innerhalb von nur drei Jahren. Die Filmindustrie war somit während der Wirtschaftskrise eine der wirtschaftskräftigsten Branchen in den USA. Kein Zweifel, Bill Johnson hatte recht, Southern California war der richtige Ort, da sich hier nicht nur das nötige Kleingeld, sondern auch eine ordentliche Anzahl Verrückter konzentrierte, die sich vielleicht für den neuen Freizeitspass „Motorradfahren“ begeistern könnte, wenn er, Johnson, nur die „richtigen“ Maschinen im Angebot hätte. Edward Turner gab sich überzeugt und bot Johnson die Vertretung von Triumph und Ariel Motorcycles an der Westküste exklusiv an. Johnson besprach sich mit seinem Sozius, Wilbur Ceder, der etwas älter war und über einen soliden finanziellen Background verfügte, der befand die Geschäftsidee ebenfalls als erfolgversprechend und so verabschiedeten sich beide aus ihrer Rechtsanwaltsexistenz, kauften 1937 einen bescheidenen ersten Showroom in Pasadena und gründeten 1938 die legendäre „Johnson Motors Inc.“, die zunächst aber noch anders hiess. Edward Turner schiffte zur Eröffnung die neuesten Modelle über den Atlantik, während die beiden schon die Werbetrommel rührten und in den einschlägigen Motorrad-Gazetten drei Tage der offenen Tür bewarben, zu denen sich dann – sage und schreibe – 15.000 Interessenten einfanden.

„Das sollte mein letzter Job werden sollen. Ich bin eben nicht mehr der alte. Nur noch einmal will ich in’s Schwarze treffen und dann möchte ich verschwinden.“
„Verschwinden? Wohin?
Zwei alte weisse Männer, Pike Bishop und Dutch Engstrom, liegen abends in einem ziemlich abgerissenen mexikanischen Kaff an einem Lagerfeuer und ziehen Bilanz. Und diese Bilanz ist desaströs. Von insgesamt neun Banditen, die sich unter Bishops Führung aufgemacht hatten, um das Büro der Eisenbahngesellschaft zu überfallen, haben nur fünf überlebt, neben Engstrom und Bishop noch die Gorch Brüder sowie Angel, ein junger Mexikaner. Ein sechster Überlebender war so schwer verwundet, dass er auf der Flucht nicht weiter reiten konnte und deshalb darum bat, erschossen zu werden. Eine Bitte, der Pike Bishop ohne viel Federlesens nachkam. In Mexiko traf diese sehr besondere Reisegesellschaft dann wie verabredet auf den alten Zausel Sykes, der frische Pferde bereithielt. Hier ergab sich dann auch die erste Gelegenheit einen Blick in die hastig zusammengerafften und so teuer erkauften Geldbeutel zu werfen, deren Inhalt sich jedoch nicht aus den erhofften Silberdollars zusammensetzte, sondern lediglich aus wertlosen Unterlegscheiben bestand. Was Bishop und Engstrom auf der Flucht schon geahnt hatten, verdichtete sich jetzt zur Gewissheit: Die Schiesserei auf der Mainstreet vor dem Büro der Eisenbahngesellschaft war keine zufällige Angelegenheit gewesen, sondern vielmehr ein sorgfältig und von langer Hand geplanter Hinterhalt. Man hatte sie in eine Falle gelockt, aus den Jägern waren jetzt Gejagte geworden. Und damit nicht genug, hatte Bishop unter den Jägern seinen alten Kumpanen Deke Thornton erkannt, offensichtlich machte dieser, nachdem er vor Jahren auch durch die Nachlässigkeit Bishops gefasst worden war, jetzt gemeinsame Sache mit der Eisenbahngesellschaft, die ihm dafür Hafterlass in Aussicht gestellt hatte. Das ist also die Situation, in welcher sich dieser nun ziemlich traurige wilde Haufen befindet. Die Bande ist auf nur noch insgesamt sechs Mitglieder zusammengeschrumpft, der erhoffte Geldsegen war ausgeblieben, was akuten Handlungsbedarf auslöst. Zudem werden sie nun von einem Haufen schmieriger Kopfgeldjäger verfolgt, der von einem alten Bekannten angeführt wird, der Bishops Verhaltensweisem, Ziele und Tricks bestens kennt. Und weil diese Kopfgeldjäger im Auftrag der Eisenbahngesellschaft unterwegs sind und die Eisenbahngesellschaft nun eimal ziemlich einflussreich ist, konnten sie sich sicher sein, dass sie so ziemlich überall, wo sie im Westen auftauchen, sehr schnell erkannt und verfolgt werden würden, so verlockend hoch ist das ausgelobte Kopfgeld, wobei die Eisenbahngesellschaft keinerlei Wert darauf legt, sie lebend zu erwischen, tot und über den Sattel geworfen, reichten sie den ehrenwerten Herrschaften für die Auszahlung der Belohnung vollkommen aus.

William Holden (rechts) als Pike Bishop neben Ernest Borgnine als Dutch Engstrom in The Wild Bunch. Links dahinter Jaime Sánchez als Angel
Schlechte Aussichten für eine Handvoll mittelloser Banditen, die sich untereinander auch noch so uneins sind, dass es anlässlich der Verteilung der vermeintlichen Beute beinahe zu einer Schiesserei gekommen wäre, weil die Gorch Brüder zuerst nicht zu einsehen wollten, die Beute, die sich später als wertloses Blech entpuppen sollte, zu gleichen Teilen zu teilen. Eigentlich, und das wissen sie, Pike und seine Gefährten Dutch Engstrom und der alte Sykes einerseits, die selbstsüchtigen und vollkommen gewissenlosen Gorch Brüder andererseits als auch der melancholische Mexikaner Angel, der nicht so recht zu einer der beiden anderen Gruppen in der Bande passen will, nur zu gut, hält sie lediglich der reine Zweck, die Aussicht auf schnelle Beute, zusammen, ansonsten sind sie sich in ihren Grüppchen in herzlicher Teilnahmslosigkeit zugetan. Und vielleicht schwingt auch diese traurige Erkenntnis in dem leeren Blick mit, den Pike auf die Frage von Dutch Engstrom entgegnet, wohin er, Pike, denn verschwinden wolle, sollte er ein letztes Mal in’s Schwarze treffen. Ja, wohin? Pike weiss es nicht. Wie sollte eine Antwort auf diese Frage auch lauten, da sich die Gewissheiten des alten Westens gerade auflösen, ihre ureigne Welt, die American Frontier, untergegangen ist und von einem neuen und fremden Zeitalter abgelöst wurde, deren Machthaber auf ihren Fersen sind, und man sich noch nicht einmal auf seine nächsten Gefährten verlassen kann. Pikes Blick wird fahler, er beisst sich sachte auf seine Unterlippe, bis Engstrom die Sprachlosigkeit seines alten Freundes nicht mehr ertragen kann und die peinigende Stille fast schon verlegen mit einer Frage nach der nächsten Zukunft bricht und sich nach Pikes Plänen erkundigt. Und natürlich hat Pike Bishop etwas in petto, er weiss, dass die US Armee Truppen entlang der Grenze zu Mexiko verteilt hat und natürlich müssen die Soldzahlungen zu jeder einzelnen dieser Garnisonen gebracht werden. Eine Armee zu überfallen, um sich ihrer Soldzahlungen zu bemächtigen, ist schon ein ziemlich dreistes Unterfangen. Engstrom scheint nur wenig begeistert über diesen tollkühnen Plan und wendet ein, dass es verdammt schwer sein muss, an die notwendigen Informationen über die Transporte zu gelangen. Das gibt Pike Bishop zu, hält es aber dennoch für machbar. Darauf sagt Dutch Engstrom:
„Man wird uns dort schon erwarten!“
Woraufhin Pike Bishop erwidert:
„Das würde mich auch nicht abschrecken.“
Das liest sich wie ein lapidarer Dialog, weil es eben auch ein lapidarer Dialog ist, der nicht erklärt, warum diese lapidare Antwort Pikes Dutch Engstrom im Anschluss merklich aufhorchen lässt, und er erklärt es nicht, weil der englische Originaldialog nur sehr schwach ins Deutsche übersetzt wurde, was wiederum sehr schade ist, da die originale Antwort einer der Schlüsselsätze des ganzen Films ist, ohne den es schwerer wird, den Film voll umfänglich zu verstehen. Pike Bishop sagt nämlich nicht: „Das würde mich auch nicht abschrecken.“, also, auf englisch, er sagt im Original vielmehr:
„I wouldn’t have it in any other way.“
Und das ist ein Satz, der in mehreren Bedeutungsmöglichkeiten schillert. Man kann ihn durchaus im Sinne von „nicht abschrecken lassen“ als „Das würde ich in Kauf nehmen“ übersetzen, man könnte ihn aber auch als „Ich würde es nicht anders haben wollen“ ins Deutsche übertragen. Und jetzt könnte man natürlich sagen: „Naja, is doch wurscht, weil mit „Das würde mich auch nicht abschrecken“ der Sinn oder die Bedeutungen dieser beiden möglichen Übersetzungsvarianten so irgendwie getroffen worden wäre.“ Dem is aber ganz und gar nicht so, denn je nachdem, welche der beiden Varianten man wählt, erhält man einen grundverschiedenen Film, im ersten Fall, der „passiven“ Inkaufnahme von gegebenen Risiken bei den geplanten Überfällen auf die Soldkassen, also der „Das-würde-mich-auch-nicht-abschrecken-Variante“, erhielte man einen launigen Baller-Western ganz im Sinne des noch heute in Deutschland gebräuchlichen Untertitels und des Begleittextes zu diesem Film: „The Wild Bunch. Sie kannten kein Gesetz“ ist und war auf den Filmplakaten und den Streamingportalen zu lesen und schlimmer noch: „The Wild Bunch, die kämpferische Geschichte einer Handvoll Desperados, die sich durch einen traditionellen Ehrenkodex verbunden fühlen…“, steht noch immer auf den DVD-Hüllen. Im zweiten Falle, der „aktiven“ Variante, die das Risiko eben nicht „passiv“ in Kauf nimmt, weil es nunmal gegeben ist, sondern es im Sinne von „Ich würde es nicht anders haben wollen“ geradezu aktiv sucht, erhielte man einen Film, in dem zwar wie in der ersten Variante auch viel geballert wird, was aber eigentlich nur als Vehikel dient, die besondere Motivation als auch die ihr folgenden Handlungen eines oder mehrerer Männer näher zu beleuchten, deren Selbstverständnis mit den Rahmenbedingungen eines anbrechenden neuen Zeitalters nicht nur nicht kompatibel ist, sondern ihnen zutiefst feindlich entgegensteht. Deshalb stand auf den amerikanischen Filmplakaten auch nicht: „They knew no law“, sondern beispielsweise: „Unchanged men in a changing land. Out of step, out of place and desperateley out of time.“ Was gewissermassen schon eine thematische Einleitung darstellt, die den deutschen Zuschauern bis heute vorenthalten wurde und vorenthalten wird, weshalb für viele deutsche Zuschauer, die vielleicht auch nicht so interessiert sind an amerikanischer Geschichte wie es Amerikaner naturgemäss sein sollten, „The Wild Bunch“ aufgrund schlechter Übersetzung und eines reisserischen Marketings zu einem blossen Klamotten-Western zusammengeschrumpft wird, der für damalige Verhältnisse eben ausserordentlich drastische Gewaltszenen enthält. Und das seit 1969, was mal wieder ein ziemlich drastischer Beweis dafür ist, dass, wenn Grütze erst einmal in der Welt ist oder von irgendwelchen Werbespacken in ihr prominent platziert wurde, weil man den Deutschen das tiefere Verständnis des Werkes nicht zumuten will oder sich reine Baller-Western eben besser verkaufen, diese Grütze immer und immer kolportiert wird, bis letztendlich fast alle diesen Mist auch kaufen. Aber natürlich ist der deutsche Untertitel „Sie kannten kein Gesetz“ nicht nur irreführend, sondern geradezu blödsinnig, denn eben darum geht es in „The Wild Bunch“, es geht um „das“ Gesetz schlechthin oder anders formuliert, es geht um tiefere Werte, aus denen sich wiederum Normen ableiten, die zu Handlungsmaximen oder auch informellen „Gesetzen“ werden, ohne die eine Gemeinschaft keine Gemeinschaft ist, noch als solche funktionieren kann. Dass Peckinpah diese Fundamente einer Wertegemeinschaft ausgerechnet von einer Bande Krimineller, also von Menschen, die sich bewusst ausserhalb des formellen Gesetzes gestellt haben, ausloten lässt, ist ja gerade der Witz seines erzählerischen Ansatzes, denn so verweist er darauf, dass es auch ausserhalb des Gesetzes selbst für eine gesetzlose Gemeinschaft wie dem wilden Haufen, so er denn eine Gemeinschaft sein will, eigentlich keinen norm- oder wertefreien Raum geben kann. Und deshalb ist es natürlich kein Zufall, dass Sam Peckinpah den weiteren Fortgang seines Filmes in Mexiko angesiedelt hat, denn Mexiko und hier vor allem der Norden des Landes war 1913 das, was man heute einen „Failed State“ nennen würde. Besonders Chihuahua, eine der nördlichsten Provinzen Mexikos, welche direkt an die USA grenzt, wurde von einem Bürgerkrieg erschüttert. Einer der Rebellenführer, und Rebellenführer gab es ziemlich viele, der von Chihuahua aus gegen das durch einen Militärputsch an die Macht gekommene Regime Huertes kämpfte, war ein gewisser Pancho Villa, nur einer von vielen Akteuren aus der üblichen Melange von Rebellenführern, korrupten Politikern, Warlords, Grossgrundbesitzern, Generälen, Milizenführern, ausländischen Geldgebern und anderen Profiteuren, die zusammen das veranstalteten, was man heute die Mexikanische Revolution nennt, damals aber eine ziemlich unübersichtliche Gemengelage war, da man nie so genau wissen konnte, wer gerade auf welcher Seite stand. Mit anderen Worten, Mexiko war 1913 ein Land, in welchem sich die staatlichen Strukturen weitestgehend aufgelöst hatten, aus Bauern wurden Soldaten, aus Soldaten wurden Banditen, aus Banditen Rebellen und aus Rebellen Milizionäre, die im Auftrag von Grossgrundbesitzern, korrupten Politikern oder Revolutionären mordeten.
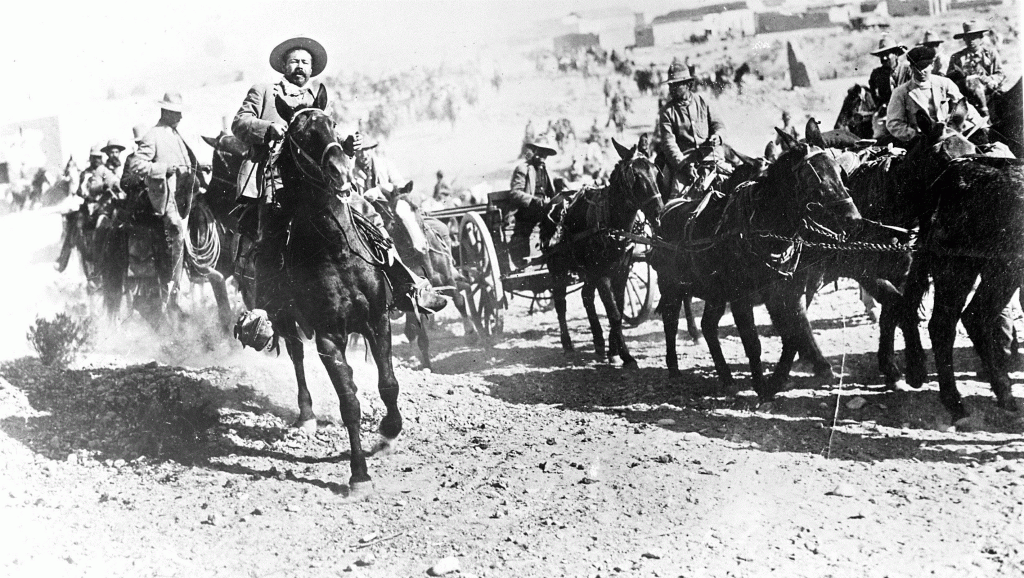
Pancho Villa als Pancho Villa höchstselbst. Das Foto wurde 1913/14 aufgenommen, also genau in der Zeit, in welcher The Wild Bunch spielt
Peckinpah führt seine Helden, die vermeintlich gesetzlosen Protagonisten der Frontier, also in ein Gebiet, in dem augenscheinlich kein Gesetz mehr herrscht, das ebenfalls gesetzlos ist, aber nicht so unschuldig oder naiv gesetzlos wie ehemals die Amerikanische Frontier, sondern gewalttätig-anarchisch gesetzlos, da es im Mexiko der Bürgerkriegsjahre natürlich nicht mehr darum ging, gemeinsam eine Wildnis zu erobern und urbar zu machen, es ging vielmehr darum, die eigenen Machtinteressen mit aller Gewalt gegen andere Machtinteressen durchzudrücken, wen man so will, also eine Art „blutiges“ Gilded Age, wenige Parteien hatten sich das Land zu eigen gemacht, aber anders als die „kultivierteren“ Konzerne des Gilded Age, die sich die USA mittels Korruption, politischer Lobbyarbeit und ihrer fast unerschöpflichen finanziellen Möglichkeiten unterworfen hatten, bedienten sich ihre mexikanischen Wiedergänger hauptsächlich der rohen Gewalt, um sich gegenseitig zu eliminieren und zu verfolgen, so, wie die angeblich kultivierte Eisenbahngesellschaft des Gilded Age jetzt ihre notorischen Störenfriede Pike Bishop und dessen Kumpane verfolgt und nach den Leben trachtet, weil ihnen mit kultivierteren Methoden eben nicht mehr beizukommen ist. Und genau über diese Hartnäckigkeit der Eisenbahngesellschaft oder sollte man vielleicht sogar sagen: Hass, wundert sich jetzt auch Dutch Engstrom, der immer noch mit Pike Bishop am Lagerfeuer liegt und nach und nach eine Whiskeyflasche leert: Es muss die Eisenbahngesellschaft viel Geld und Zeit gekostet haben, diesen Hinterhalt vorzubereiten, sagt er zu Bishop und fügt an, du musst ihnen sehr geschadet haben. Ja, antwortet Bishop, er hätte so zwei-, dreimal mit ihnen zu tun gehabt, vor allem mit einem Typen namens Harrigan, der so seine ganz speziellen Methoden gehabt hätte. Also habe er, Bishop, ihm seine Grenzen aufgezeigt und eben das könnten so engstirnige bornierte Typen wie Harrigan, von denen es eine ganze Menge gäbe, nicht verkraften. Also würde Harrigan sie nun verfolgen, allein um sie zu brechen, um sich und allen anderen zu beweisen, dass er doch richtig gelegen und sich nicht getäuscht hätte. Vielleicht aus Stolz, wirft Engstrom ein. Ja, vielleicht, meint Bishop, denn das könnten sie niemals vergessen, diesen Stolz und dass sie sich geirrt haben und getäuscht worden seien, anstatt einfach aus ihrem Fehler zu lernen. Was ist mit uns, entgegnet Engstrom nach einer Weile, wir wurden auch getäuscht, haben wir aus unserem Fehler gelernt? Er hoffe es, antwortet Bishop, er hoffe es bei Gott.

Albert Dekker (links) als fieser Repräsentant der Eisenbahngesellschaft Pat Harrigan und Robert Ryan als Deke Thornton in The Wild Bunch
Beide lauschen anschliessend Angel, der für drei mexikanische Kinder auf der Gitarre spielt und ein Lied säuselt, Engstrom liegt auf dem Rücken und schaut in den Nachthimmel, eine gefühlte Ewigkeit lang. Pike, sagt er schliesslich und als dieser sich ihm zuwendet:
„Ich würde es auch nicht anders haben wollen.“
(I wouldn’t have it no other way either)
Schon am nächsten Morgen brechen die Konflikte innerhalb der Bande wieder auf, als sie eine Sanddüne hinunter reiten. Sykes Pferd, der als letzter in der kleinen Kolonne unterwegs ist und die Packpferde im Schlepptau hat, verliert im losen Sand den Halt, Sykes stürzt, die Packpferde gehen durch und bringen unter anderen auch den vor ihnen reitenden Tector Gorch zu Fall. Der rappelt sich auf, schnappt sich – ausser sich vor Wut – den alten Sykes und schüttelt ihn durch, bis Pike Bishop interveniert und ihn auffordert Sykes loszulassen. Er hätte uns beinahe umgebracht, wir sollten ihn loswerden, schreit Tector. Jetzt packt Bishop der Zorn, wir werden niemanden loswerden, sagt er bestimmt, wir halten zusammen, so wie es immer war. Wenn du mit einem Mann reitest, dann bleibst du bei ihm und wenn du das nicht tust, bist du schlimmer als irgendein Tier. Du bist erledigt. Wir sind erledigt. Jeder von uns.

Der Sturz
Nach diesem Zwischenfall reitet die Gruppe gemeinsam weiter, ein wenig später taucht Sykes an Bishops Seite auf und bedankt sich für die kleine Ansprache Bishops über das Zusammenhalten in der Gruppe, die hätte ihm gut gefallen, und weil er gerade dabei ist, fragt er auch nach, wie sich sein Enkelsohn denn so bei dem Überfall geschlagen habe. Bishop versteht zunächst nicht recht: Enkelsohn? Ja, sagt Sykes, mein Enkelsohn, C. L., Clarence Lee, nicht sehr helle in der Birne, aber sonst ein guter Junge. Er, Sykes, hätte ihm gesagt, er solle bei dem Überfall immer genau das machen, was Mister Bishop zu ihm sagt. Jetzt versteht Pike Bishop: C. L., das war der junge Mann, dem er bei dem Ausbruch aus dem Büro der Eisenbahngesellschaft gesagt hatte, er solle dort bleiben und die Angestellten bewachen, damit sie ihm und den anderen nicht in den Rücken fallen können, während sie das Weite suchten. C. L. ist jetzt tot, anders als die Zuschauer weiss Bishop das nicht, aber er kann es sich denken, und erschossen hat ihn ausgerechnet dieser Harrigan. Er ist tot, weil Bishop ihn im Stich gelassen, ihn letztlich geopfert hat.
Er war nicht bei C. L. geblieben.
Und wer das nicht tut, ist schlimmer als irgendein Tier.
Der Hinflug

Und das Schöne ist, dass man es nicht genau weiss.
Natürlich könnte man ein bisschen mehr in die Tiefe recherchieren und vielleicht fände sich in irgendeinem verstaubten Archiv auch tatsächlich eine alte zerknitterte Passagierliste aus dem Jahr 1960, aus welcher hervorginge, wann genau in diesem Jahr mit welcher Fluggesellschaft und mit welchem Flugzeugtyp auf welcher Flugroute ein gewisser Edward Turner nach Japan geflogen ist. Aber letztendlich ist nicht wirklich wichtig, wie, wann genau und womit Herr Turner nach Japan geflogen ist. Es ist wichtig, dass er geflogen ist, denn damit ist auch gewiss, dass er viele Stunden in irgendeinem Flugzeug verbracht haben muss, und das schöne Nichtwissen ermöglicht es uns, ihn gewissermassen frei Hand in irgendein Flugzeug irgendeiner Fluggesellschaft zu setzen, die auf irgendeiner Flugroute den Flug mit Edward Turner an Bord durchführen liess, was der tatsächlichen und erwiesenen und leidlich dokumentierten Faktizität von Turners Japanbesuch im Jahre 1960 an sich ja keinen Abbruch tut. Und so könnten wir den inzwischen 59jährigen Edward Turner, der seit 1956, nachdem sein alter Chef und Förderer Jack Sangster zuerst 1944 Ariel Motorcycles und dann später 1951 auch noch Triumph Motorcycles äusserst gewinnbringend an die BSA Group verkauft hatte, wodurch die BSA Group zum weltgrössten Motorradhersteller wurde, auf Betreiben eben jenes Sangsters zum Chef der Automotive Abteilung der Birmingham Small Arms Company, kurz BSA, aufgestiegen ist, beispielsweise an Bord eines Linienflugzeuges der British Overseas Airways Corporation, kurz BOAC, verfrachten, rein im Geiste, versteht sich, denn in echt geht das ja nicht mehr, da Mister Turner inzwischen verstorben und die BOAC 1973 von der Britischen Regierung zusammen mit der British European Airways, kurz BEA, zu British Airways verschmolzen worden ist.

London Heathrow 1965
Und natürlich wäre es bei der naheliegenden Wahl einer britischen Fluggesellschaft wie der BOAC auch ebenso naheliegend, dass Turners Reise nach Japan ihren Ausgang von einem Londoner Flughafen nehmen wird, womit sich der Flughafen London Heathrow anbieten würde, welcher 1960 Heimat-Basis von BOAC war und wohin wir weit vorausschauend Herrn Turner bereits von seinem persönlichen Fahrer haben hin chauffieren lassen, wobei er, wie es seine Gewohnheit war, anstatt hinten im Fond vorne links neben dem Fahrer Platz genommen hatte. Und inzwischen hat sich Edward Turner auch schon von seinem Fahrer Frank Griffiths verabschiedet, mit dem ihn so etwas wie eine Freundschaft verband und der ihm nicht nur deshalb auch einen guten Flug wünschte. Jetzt sitzt Edward Turner also bereits in einem Linienflugzeug der BOAC, das Boarding ist abgeschlossen und die Crew bereitet sich auf den Start vor, wobei wir uns immer noch nicht entschieden haben, in welchem Flugzeugtyp Edward Turner eigentlich sitzen soll. Und diese Frage ist tatsächlich ein wenig knifflig zu beantworten, will man auf die einzige Möglichkeit, sie sicher zu beantworten, nämlich die tiefere Recherche in staubigen Archiven, verzichten, denn das Jahr 1960 markiert so etwas wie einen Epochenwandel im Personenluftverkehr, was zur Folge hat, dass wir eine verhältnismässig grosse Auswahl von möglichen Flugzeugtypen haben, die auch noch ziemlich unterschiedlich sind, und in die wir alle den guten Turner verfrachten könnten, so wir denn wollten. Da hätten wir beispielsweise die de Havilland Comet, die heute schon ziemlich der Vergessenheit anheim gefallen ist, obwohl sie mehr als nur eine ziemlich prominente Rolle im Epochenwandel des Personenluftverkehrs spielen sollte. Bereits 1943, der zweite Weltkrieg war noch in vollem Gange, der Ausgang für die Alliierten aber schon mehr als nur absehbar. Und so bereitete man in Grossbritannien, während man in Nazideutschland noch vom Endsieg träumte oder von irgendwelchen Wunderwaffen fabulierte, die nationale Luftfahrtindustrie auf die Nachkriegszeit vor, auch weil man fürchten musste, von der sehr leistungsstarken us-amerikanischen Konkurrenz nach dem Krieg abgehängt zu werden. Für ein Land wie Grossbritannien, das zu dieser Zeit noch ein weltumspannendes Empire unterhielt, waren Flugzeuge, die in der Lage sein sollten, Langstrecken schnell zu überbrücken, neben den finanziellen Verdienstchancen für die Industrie auch von sehr essentiellem Interesse, da sie es in Zukunft ermöglichen könnten, die für die Verwaltung des Empires und dessen Prosperierung notwendigen Heerscharen an Beamten, Militärs und Geschäftsleuten schneller an Ort und Stelle zu verfrachten, anstatt sie erst wochenlang per Dampfschiff durch die Gegend zu schippern, wie es damals üblich war. Also setzte die britische Regierung eigens ein Komitee ein, dessen Ziel nichts weniger war als die Neudefinition der zivilen und kommerziellen Luftfahrt. Hierzu benötigte man vor allem neue Verkehrsflugzeuge, die schneller, komfortabler sein und zudem über eine grössere Reichweite verfügen sollten als die alten Vorkriegs-Propellerkisten. Das Komitee erarbeitete dann auch tatsächlich fünf Vorschläge, von denen eines ein Düsenflugzeug war. Dies ging zurück auf die Einflussnahme eines gewissen Sir Geoffrey de Havilland, Gründer und Chef der gleichnamigen Flugzeugwerke, und war gleichermassen erstaunlich und ambitioniert, denn Düsentriebwerke galten in jener Zeit als zu unzuverlässig, zu wartungsintensiv und zu teuer im Unterhalt, um sie in der zivilen Luftfahrt wirtschaftlich und vor allem sicher einsetzen zu können.

Sir Geoffrey de Havilland
Aber de Havilland gelang es, diese Bedenken zu zerstreuen, indem er einen atemberaubenden Entwurf seiner „Comet“ präsentierte, die mit ihrer prognostizierten Leistungsfähigkeit alles deutlich in den Schatten stellen würde, was damals so in der Luft unterwegs war. So sollte de Havillands Wunderflugzeug dreimal so schnell fliegen und in viel grösseren Höhen operieren können, was den Kerosinverbrauch minimierte, und zudem sicherer, komfortabler und luxuriöser sein als das schnellste Propellerflugzeug seiner Zeit. Was de Havilland versprach, war somit tatsächlich die radikale Neudefinition der modernen Luftfahrt. Die Reaktionen des Publikums, vor allem der Fluggesellschaften waren geradezu euphorisch, wobei von Anfang an klar war, dass so ein ambitioniertes Projekt wie die Comet für die vergleichsweise kleinen de Havilland Werke auch ein immenses Risiko barg. Nachdem die ersten Fluggesellschaften, allen voran die staatseigene BOAC, die ersten Flugzeuge orderten, hingen somit Wohl und Wehe der ganzen Firma am Erfolg der neuen Jets. Die Entwicklungen begannen bereits 1947, erste Testflüge konnten schon ab 1949 unternommen werden, die, glaubte man de Havilland, allesamt problemlos verliefen. Die Comet schien tatsächlich de Havillands Versprechen, die kommerzielle Luftfahrt für immer und geradezu revolutionär zu verändern, einlösen zu können. So verfügte die Maschine über ein zeitlos modernes Design, war ausserordentlich schnell, vergleichsweise leise und bot einen fast schon luxuriösen Komfort, den man auch bei heutigen Passagierflugzeugen vergeblich suchen dürfte.

Prototyp der de Havilland Comet 1949
Nach zwei weiteren Jahren intensiven Testens konnte de Havilland schon 1952 die ersten Maschinen termingerecht an BOAC ausliefern, womit die de Havilland Comet tatsächlich das erste in Serie gefertigte Strahlenverkehrsflugzeug der Welt war, eine britische Entwicklung, die am 3. Mai 1952 zu ihrem ersten Linienflug abhob und dann ab dem 3. April 1953 auch die Verbindung London – Tokio auf der Südroute über Bangkok bediente, wobei sie die reine Flugzeit, natürlich unterbrochen von einigen Zwischenlandungen, von 86 Stunden auf nur noch 33 reduzierte. Ein unglaublicher Prestigegewinn für de Havilland und BOAC, der allerdings schon wenige Wochen später empfindlich geschmälert werden sollte. Von Anfang an litten die ausgelieferten Maschinen im Liniendienst an technischen Problemen, die vor allem die Hydraulik der Steuerung, aber auch die Elektronik und die Navigation betrafen. Am 3. März 1953 geschah dann das Unvorstellbare, eine de Havilland Comet der Canadian Pacific Airline stürzte kurz nach dem Start in Karatschi ab. Konnte man das noch irgendwie seitens der de Havilland Werke als Folge eines Pilotenfehlers „wegerklären“, kam es in den folgenden Monaten Schlag auf Schlag, bis zum 8. April 1954 stürzten noch drei weitere Comet ab, darunter auch zwei BOAC Flugzeuge. Die Maschinen schienen in der Luft förmlich auseinander gebrochen zu sein, was sich jetzt nicht mehr als Folge eines Pilotenfehlers erklären liess. Alle de Havilland Comet erhielten daraufhin Startverbot und erst äusserst langwierige Untersuchungen unter anderem in eigens dafür geschaffenen Wasserdrucktanks brachten an den Tag, dass die Druckkabinen der Jets den Anforderungen der grossen Höhen, in der moderne Düsenflugzeuge unterwegs sind, nicht gewachsen waren.

Wassertank für die Ursachenforschung
Da die Jets höher aufstiegen als herkömmliche Propellermaschinen mussten die Druckkabinen mit einem höheren Kabinenüberdruck betrieben werden. Weil das Flugzeug ausserdem in verschiedenen Höhen operierte, war die Druckkabine zudem variierenden Druckverhältnissen ausgesetzt. Diese wechselnden Druckverhältnisse stressten das Material der Druckkabinen erheblich, führten schliesslich zur Materialermüdung und es bildeten sich zunächst feine Haarrisse. Unglücklicherweise hatte de Havilland zudem quadratische Fenster verbaut, was die Rissbildung an deren Ecken noch beförderte. Ursächlich für die Abstürze war aber das Versagen der Materialstruktur rund um die Abdeckung für den Radiokompass im vorderen oberen Bereich des Rumpfes. Mit anderen Worten: Diese Flugzeuge waren mit Druckkabinen aus Eierschalen unterwegs, da man eigentlich die Stabilität von Golfbällen benötigte. Und das zeitigte fatale Folgen, schon nach vergleichsweise wenigen Flugstunden bildeten sich in den Wänden der Druckkabinen die beschriebenen Haarrisse, welche sich bei jedem Flug immer weiter vergrösserten, bis zuerst das Material rund um den Radiokompass irgendwann kapitulierte und die Druckkabinen förmlich explodierten.
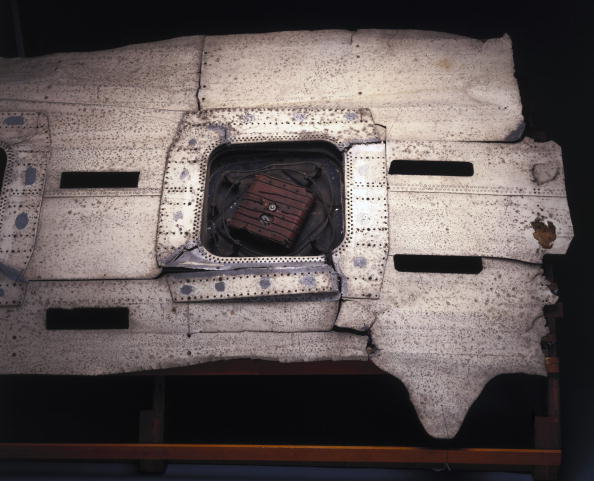
Rissbildung rund um den Radiokompass
Die ersten de Havilland Comet waren somit sehr avancierte „Experimentalflugzeuge“ mit eingebautem Selbstzerstörungsmechanismus, die reichlich naiv technisches Neuland überflogen, was insgesamt 110 unfreiwilligen Beta-Testern das Leben kostete. de Havilland musste alle bereits ausgelieferten Comet zurückrufen und machte sich an die Weiterentwicklung der Comet, deren Nachfolger, die Comet 4, aber erst 1958 an BOAC ausgeliefert werden konnte. In der Zwischenzeit behalf man sich bei BOAC mit neu entwickelten Propellermaschinen, die selbstredend von herkömmlichen Verbrennungsmotoren angetrieben wurden.
Auf der Langstrecke waren dies die Bristol Britannia und die Douglas DC-7C. Die Bristol Britannia war ein viermotoriges Langstreckenflugzeug, deren ebenfalls von Bristol Aeroplane Company entwickelten Turboprop Triebwerke jeweils 3775 PS leisteten. Insgesamt 85 dieser Flugzeuge wurden gebaut, von denen BOAC die meisten, nämlich insgesamt 33, abnahm. Die ersten im Dezember 1955, später dann noch die spezielle Langstrecken-Version 312 mit Langstreckentanks und überarbeitetem Rumpf sowie einem verstärkten Fahrwerk. Es war eine Maschine diesen Typs, mit welcher BOAC am 28. Juni 1957 den allerersten Nonstop-Flug von London an die kanadische Pazifikküste nach Vancouver durchführte. Das Flugzeug bewältigte die insgesamt 8160 Km lange Strecke immerhin in 14 Stunden und 40 Minuten. Und es war diese Maschine, die zuerst auf BOACs „Westbound Service“ eingesetzt wurde, der später Teil des „Around The World Service“ BOACs werden sollte. Die Bristol Britannias 312 flogen hierzu zweimal wöchentlich die Route London-New York-San Francisco-Honolulu-Wake Island-Tokio-Hong Kong und zwar solange, bis sie von einem neuen Flugzeugtyp abgelöst wurden. Eigentlich eine sehr schöne Route, welche auf ihrem letzten Teil San Francisco-Honolulu-Wake Island-Tokio den direkten Weg über den Pazifik, in ein unendliches Blau, nimmt, und somit auch eine Route darstellt, die Edward Turner bei seiner Reise nach Japan genommen haben könnte.

Bristol Britannia
Am 15. Oktober 1956 übernahm BOAC ihre erste Douglas DC-7C, die legendäre „Seven Seas“, die Langstreckenversion der normalen Douglas DC-7, mit vier mächtigen Propellermotoren, einer Spannweite von 38,8 Meter sowie einer Reichweite von 9.050 km ein Gigant der Lüfte und gewissermassen die letzte Entwicklungsstufe des durch Propellermotoren angetriebenen Linienflugzeuges für den Interkontinentalverkehr. Mit ihren Leistungsdaten und vor allem mit ihrer Reichweite, die es nun ermöglichte von der Westküste im Nonstopflug Ziele in Europa anzusteuern und umgekehrt, war das Flugzeug für einige Jahre faktisch konkurrenzlos, was jede Fluggesellschaft, die etwas auf sich hielt und im interkontinentalen Flugverkehr unterwegs war, zwang, sich ein paar von diesen Fliegern zuzulegen. BOAC setzte die „Seven Seas“ dann auch ab Frühjahr 1957 auf den Linien nach New York und San Francisco ein.

Douglas DC-7C („Seven Seas“)
Ende 1958 kam endlich die neu konstruierte de Havilland Comet 4 in den Flugzeugpark von BOAC, das Flugzeug war jetzt sicher, schneller und konnte mehr Passagiere befördern, verfügte aber nur über eine Reichweite von vergleichsweise dürftigen 4.000 Km. Es darf vermutet werden, dass die britische Regierung als Eigentümer von BOAC diesen britischen Jet noch in Dienst stellte, um den britischen de Havilland Werken einen publicityträchtigen Gefallen zu tuen, denn eigentlich brauchte BOAC die Comet 4 nicht mehr, schon im November 1956 hatte BOAC einen Vertrag mit Boeing über die Lieferung von 15 Boeing 707 abgeschlossen, dem neuen Superjet schlechthin, die spätere Ikone der zivilen Luftfahrt, die ebenso wie der neue Jet von Douglas, die DC-8, der Comet 4 überlegen war, da die amerikanischen Jets schneller, grösser und kostengünstiger waren und zudem noch über eine weitaus grössere Reichweite verfügten. Die ersten Boeing 707, welche vielleicht als patriotisches Feigenblatt für die britische Regierung extra mit Rolls Royce Triebwerken ausgerüstet worden waren, setzte BOAC bereits im Mai 1960 ein. Ihre Comet 4 hingegen überstellte BOAC schon ab 1959 an Partner-Airlines und fing bereits 1965 an, diesen Flugzeugtyp wieder auszumustern. Die Comet 4 war nach Meinung vieler Zeitgenossen ein famoses Flugzeug, jetzt aber kam sie einfach viel zu spät, die Konkurrenz, welche aus den Fehlern de Havillands gelernt hatte, war in der Zwischenzeit zu übermächtig geworden. Lediglich 76 Comet 4 wurden in den Jahren 1958 bis 1964 bestellt und ausgeliefert, lächerlich wenig im Vergleich zu den 1010 707, welche Boeing insgesamt auslieferte. Das Spiel für de Havilland war aus, das Rennen verloren, die de Havilland Aircraft Company kam in wirtschaftliche Turbulenzen und verlor ebenso wie die Bristol Aircraft Company, welche die Britannia gebaut hatte, die wirtschaftliche Selbständigkeit. Auf Betreiben der britischen Regierung wurde die vergleichsweise kleinteilige britische Luftfahrtindustrie restrukturiert und in grössere Einheiten zusammengefasst. Die de Havilland Aircraft Company ging 1959 in der Hawker-Siddeley-Gruppe auf, der Markenname „de Havilland“ wurde 1963 aufgegeben und heute befindet sich auf dem Gelände der de Havilland Werke ein Industriepark. Der ehemalige Verwaltungskomplex beherbergt eine Polizeistation, im alten Eingangsbereich befindet sich ein Kentucky Fried Chicken und in den ehrwürdigen Hangars wird unter anderem ein Sportstudio betrieben.

Boeing 707
Aber von all dem konnte Edward Turner, den wir ja zwischenzeitlich in ein Flugzeug verfrachtet hatten, von dem wir aber noch nicht wissen, um welchen Flugzeugtyp genau es sich handelt, 1960 natürlich noch nichts ahnen, während er auf den Start seines Fluges wartet und schon anfängt, sich auf seinen Tomatensaft zu freuen, den er wie immer auf seinen Flugreisen auch jetzt gedenkt, bald zu sich zu nehmen. Und das Schöne ist ja, dass wir nicht genau wissen, in welchem Flugzeug Edward Turner tatsächlich nach Japan geflogen ist. Wir könnten ihn also in jeden der vier verschiedenen möglichen Flugzeugtypen verfrachtet haben, die da wären: Die Bristol Britannia, die Douglas DC-7C, die Havilland Comet 4 oder die von britischen Triebwerken angetriebene Boeing 707. Nur von welchen Kriterien sollten wir uns bei der Auswahl des Flugzeugtyps leiten lassen? Etwa Faktizität? Wäre natürlich schön, weil Faktizität ist ja immer irgendwie gut, aber in unserem Fall auch ziemlich wurscht, denn es ist letztendlich für den Fortgang von „The Wild Bunch“, aber auch für die Historizität der Motorradgeschichte völlig unerheblich, in welchem Flugzeug Edward Turner nach Japan geflogen ist. Hauptsache, er WAR in Japan, auch, wenn er von San Francisco aus mit dem Ruderboot dort hin gepaddelt wäre. Dann sollten wir uns vielleicht von Sicherheitskriterien leiten lassen? Eigentlich auch unnötig, denn wir wissen ja, Edward Turner WAR in Japan und HAT die Fabriken von Honda, Suzuki und Yamaha besichtigt, und nicht nur das, IST er auch sicher wieder nach England zurückgekehrt, um dem Verband der britischen Motorradhersteller über seine Erfahrungen in Fernost zu berichten. Egal also, in welches Flugzeug wir Edward Turner verfrachtet haben, wird es immer sicher in Tokio und später wieder in London landen und selbstredend einen wohlbehaltenen Edward Turner entlassen. Welche Kriterien also dann? Naja, vielleicht könnten wir versuchen, einfach nett zu Edward Turner zu sein und ihn selbst zu fragen, mit welchem Flugzeug er gerne nach Japan geflogen wäre, um dort die Fabriken der noch jungen, aber bald schon erstarkenden japanischen Motorradindustrie zu besichtigen. Wir könnten also so tun, als ob Edward Turner, nachdem er den Entschluss gefasst hatte, die Fabriken der jungen, aber bald schon erstarkenden Motorradindustrie zu besichtigen – obwohl Turner das mit dem Erstarken seinerzeit noch nicht wissen konnte, aber sehr wohl befürchtete, was ja der eigentliche Grund dieser Reise war – in seinem Büro zum Telefonhörer griff, um seine Sekretärin Nan Plant, die Turner immer und nur und förmlich als Miss Plant ansprach, auch wenn seine Familie und er privat mit Miss Plant verkehrten, zu bitten, doch bitte einmal bei der British Overseas Airways Corporation, kurz BOAC, anzurufen, um einen Flug nach Tokio und zurück zu buchen.

Miss Nan Plant
Und natürlich kam die gewissenhafte Miss Plant dem Wunsch ihres Chefs augenblicklich nach und telefonierte mit einer Dame bei BOAC, die Miss Plant mitteilte, dass sie ein bisschen Zeit benötigen werde, die Verbindungsdaten herauszusuchen und zusammenzustellen und deshalb in ein paar Minuten zurückrufen würde. Und tatsächlich, nach einigen wenigen Minuten klingelte das Telefon von Miss Plant, es war die Dame von BOAC, welche Miss Plant davon in Kenntnis setzte, dass derzeit vier unterschiedliche Flugzeugtypen die Verbindung London – Tokio bedienen würden, nämlich die Bristol Britannia, die Douglas DC-7C, die de Havilland Comet 4 und die Boeing 707, und dass sich der geschätzte Mister Turner doch bitte eine von diesen Maschinen für seine Reise nach Tokio aussuchen möge. Ja! Klar! Natürlich ist das Mumpitz! Bei keiner Fluggesellschaft dieser Welt dürfen sich Fluggäste einen bestimmten Flugzeugtyp für ihre Reise wünschen. Schon klar! Aber das Schöne ist ja, dass man es nicht genau weiss. Und vielleicht ist es ja doch genauso geschehen. Weil die Dame bei BOAC ein ganz entschiedener Fan von Turners Sportmotorrädern war oder eine verflossene Liebhaberin von Miss Plant oder eine ehemalige Schulkameradin von Miss Turner oder wasweissich! Miss Plant notierte sich jedenfalls die vier Flugzeugtypen, deren Namen sie noch nie gehört hatte, sagte dann der Dame von BOAC, dass sie ihrerseits zurückrufen werde, sobald sie wisse, welchen Flugzeugtyp Mister Turner für seine Reise zu nutzen gedenkt, stand danach auf, weil sie glaubte, dass es besser ist, ihrem Chef den Zettel mit den Flugzeugtypen persönlich zu übergeben, statt diese seltsamen Namen – DC-7C, de Havilland, Boeing – am Telefon durchzusagen. Sie klopfte also an Edward Turners Bürotür und trat nach seinem militärisch knappen „Come in!“ ein, erläuterte ihm das, was die Dame von BOAC gesagt hatte, und übergab ihm den Zettel. Auf dem Schreibtisch des Vorstandes des damals grössten Motorradherstellers der Welt liegt also jetzt der Zettel mit den vier Namen von vier unterschiedlichen Flugzeugtypen. Und natürlich fragt sich jetzt die ganze Welt, welchen Flugzeugtyp Edward Turner für seine Reise nach Tokio auswählen wird oder besser gesagt, ausgewählt hat, denn er ist ja bereits geflogen. Das Blöde ist nur, dass wir Mister Turner nicht fragen können, denn der ist immer noch tot. Auch dürften unsere Chancen, die Antwort auf ausgerechnet diese äusserst interessante Frage in irgendwelchen staubigen Archiven zu finden, relativ gering bis nicht existent sein. Deshalb können nur wir diese Frage hier und jetzt und ein für allemal beantworten und niemand sonst. Aber der einzige unter uns, der sich überhaupt bisher einen Kopf um Edward Turners mögliche Flugzeug-Vorlieben gemacht hat, bin – seien wir ehrlich! – nunmal ich. Und ich bin der Meinung, dass Mister Edward Turner schliesslich nicht irgendwer ist, vielmehr ist er Mister Triumph, der Erfinder des Speed Twins und der Chef des weltgrössten Motorradherstellers der Welt, der Automotive Sparte der BSA Group, mithin also eines, so könnte man jedenfalls meinen, Aushängeschildes der britischen Industrie, weshalb man verführt sein könnte zu glauben, dass ein solch exponierter Vertreter der britischen Industrie natürlich und zuallererst und immer ein britisches Verkehrsmittel oder Flugzeug auswählen würde, allein schon aus Gründen des Nationalstolzes, weshalb wir oder besser gesagt: Ich mir nur noch überlegen müsste, welches der beiden zur Wahl stehenden britischen Flugzeuge Turner für seinen Flug nach Tokio ausgewählt gehabt haben könnte. So einfach ist das aber nicht und das aus genau zwei Gründen, zum einen ist der Anlass für Turners Reis zwar geschäftlicher Natur, die Auswahl des Flugzeuges ist es aber eigentlich nicht, hier kann Turner tatsächlich seinen privaten Neigungen folgen, denn sollte der geschäftliche Zweck, ihn für den gleichen Preis nach Tokio zu befördern, egal mit welchem Flugzeug, erfüllt werden, wäre den geschäftlichen Erfordernissen genüge getan. Und auch würde ganz sicher keine britische Boulevardzeitung damals titeln: „Shame on Turner! Mister Triumph takes an American Plane to Tokyo!“, wenn schon BOAC, die ja eine staatseigene Fluglinie war, selbst Flüge mit amerikanischen Flugzeugen anbot und durchführte, weshalb Edward Turner auch nicht dem Vorwurf des geschäftsschädigenden Verhalten ausgesetzt gewesen wäre, wenn er tatsächlich ein amerikanisches Flugzeug bevorzugt hätte. Und zum andern, und das ist noch viel gewichtiger als der erste Grund, hatte Mister Edward Turner durchaus so etwas wie… naja, nennen wir es mal eine spezifische us-amerikanische Seite, und das wiederum hat viel mit dem zu tuen, was geschehen ist, seitdem ein gewisser Bill Johnson im Jahre 1938 in Pasadena, Californien die „Johnson Motors Inc.“ gegründet hatte, um im Einvernehmen mit Edward Turner britische Motorräder und hier vor allem die der Firma Triumph in den USA zu vertreiben. Bereits 1939 war Edward Turner das erste Mal in die USA gereist, um Bill Johnson persönlich kennenzulernen und mit ihm zusammen einen professionellen Import und Vertrieb seiner Motorräder speziell nach Californien aufzubauen. Bisher hatten Turners Singles und Twins den neuen Kontinent nur in vergleichsweise homöopathischen Dosen erreicht, dennoch konnte insbesondere der Speed Twin zumindest in motorsportaffinen Insiderkreisen bereits auf sich aufmerksam machen, da er sich auf diversen Dirt Track-, Hill Climb- aber auch Strassenrennen nicht nur als konkurrenz-, sondern auch als siegfähig erwiesen hatte. Triumphs 500 ccm Twin überzeugte durch seine Leistung, sein geringes Gewicht, seine Zugänglichkeit für Tuningmassnahmen als auch durch seinen im Vergleich zu anderen britischen Importmaschinen günstigeren Preis. Turners Motordesign begann auf dem amerikanischen Markt seine Vorteile auszuspielen, allein waren die Triumphs noch so etwas wie ein Insidertipp. Mit Bill Johnson und seinem Partner Will Ceder sollte sich das bald ändern, zunächst lancierten sie eine landesweite Anzeigenkampagne vor allem in Magazinen, die von jungen Männern gelesen wurden, und sponsorten dann konsequent jede Form des Motorradsports. Mit Erfolg, denn Triumphs Sportmaschine, die T100 dominierte 1940 das Renngeschehen in Californien, was den Bekanntheitsgrad Triumphs enorm steigerte, Triumphs waren jetzt „in“, allerdings auch Mangelware, da es Turner vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gelungen war, genug Motorräder über den Atlantik und bis an die Westküste der USA zu schaffen. Bald nach Ausbruch des Krieges wurden die Rohstoffe in Grossbritannien rationiert und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Herstellung von „zivilen“ Motorrädern zugunsten der Kriegsrüstung verboten werden würde. Noch erhielt Triumph Rohstoffe zugeteilt, wenn auch unter der Auflage, dass 75% der hergestellten Motorräder zur Beschaffung von dringend benötigten Devisen in den Export gehen mussten. Und tatsächlich schaffte es Triumph bis in den November 1940 einige Maschinen sowie Ersatzteile über den zunehmend u-boot-verseuchten grossen Teich zu bringen, allzu viele waren es aber nicht mehr, so wird geschätzt, dass Johnson Motors oder „JoMo“ zwischen 1939 und 1941 so ungefähr 300 neue Triumphs und Ariels an den Mann bringen konnte. Im November 1940 wurden die Triumph-Werke in Coventry durch einen deutschen Bombenangriff zerstört, was den Export im Verein mit dem späteren Kriegseintritt der USA dann vollumfänglich zum Erliegen brachte. Dennoch waren diese ersten Erfolge in den USA durchaus ermutigend, Turner und Johnson blieben während der Kriegsjahre in Kontakt, diskutierten in Briefen und Telegrammen ihre Erfahrungen und kamen zu der übereinstimmenden Ansicht, dass in einem Land, dessen eigene Motorradindustrie vorwiegend schwere Maschinen für das möglichst komfortable Überbrücken von mittleren bis grossen Entfernungen herstellte, Turners vergleichsweise leichter 500 ccm Twin das perfekte Produkt für die californische Nachkriegsjugend sein würde, die zum komfortablen Überbrücken von mittleren bis grossen Entfernungen nach dem Krieg lieber das Auto nutzen wird, aber im „hippen“ englischen Sportmotorrad ein Distinktionsmerkmal erkannt hatte, das es nur so zum Freizeitspass nutzen konnte. Californien sollte damit etwas, die Transformierung des Motorrades vom individuellen Verkehrsmittel hin zum Hobby- und Freizeitgefährt, vorwegnehmen, was im Rest der Welt, aber auch in weiten Teilen der USA, so richtig erst ab Mitte der 1960er Jahre einsetzen würde. Einer der Gründe hierfür war neben dem typisch californischen Gespür für neue Trends natürlich auch die Prosperität des westlichsten amerikanischen Bundesstaates, mit anderen Worten: In Californien gab es eben mehr Menschen als anderswo, die über die notwendigen finanziellen Mittel aber auch genügend Freizeit verfügten, um sich dieses neue Hobby, das Motorradfahren allein aus Spassgründen, leisten zu können. Turner schätzte, dass Triumph nach dem Krieg so um die 1000 Motorräder pro Jahr an JoMo würde liefern können, und zwar ausschliesslich Twins, da Triumph die Herstellung und den Vertrieb von Einzylindermotorrädern nach dem Krieg einstellte. Damit vollzog Turner einen sehr entschiedenen, jedoch nicht ganz risikofreien Schnitt, denn der Heimatmarkt, Grossbritannien, war, wie der Rest der Welt, noch lange nicht so weit wie Californien. Grossbritannien sollte zwar als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgehen, hatte sich aber wirtschaftlich stark erschöpft, das Land war am Rande des Staatsbankrotts, das Empire zerbröselte allmählich und die Nachkriegswirtschaft kam auch mit der Hilfe der USA nur sehr zäh in Gang, Lebensmittel und Kraftstoffe waren rationiert und die wenigen verfügbaren Rohstoffe wurden der Industrie nach bestimmten Prioritäten zugeteilt. Ein Land in der Austerität brauchte keine glitzernden Sportmotorräder, sondern möglichst günstige individuelle Verkehrsmittel, simple Eintöpfe zumal, die Triumph aber nach 1946 nicht mehr liefern wollte und konnte. Turner setzte somit schon sehr früh auf die amerikanische Karte, bereits 1945, der Pulverrauch des Zweiten Weltkrieges war noch nicht verzogen, reiste er in der Koje eines Frachters nach New York, von wo aus er über Chicago nach Los Angeles flog, um Bill Johnson zu treffen. Turner blieb während dieser zweiten USA-Reise für drei Monate in den Staaten, die er nutzte, um die spezifische „Motorrad-USA“ besser kennenzulernen, er traf Vertreter von Harley-Davidson, besuchte unter anderem diverse Motorrad- und Scooter-Start-ups und untersuchte deren Prototypen. Der Managing Director der Triumph Engineering Inc. tauchte tief ein in den hemmungslos optimistischen, lebensbejahenden „Californian Way of Life“ und war, um es mit einem Wort zu sagen: Überwältigt!, was jetzt nicht so wahnsinnig erstaunlich ist, denn einen krasseren Gegensatz zu seiner in diesen Jahren grauen und tristen Heimat wie das sonnige und prosperierende Californien, das sich aus den Jahren der Grossen Depression förmlich heraus katapultiert hatte, lässt sich kaum vorstellen. Turner war jetzt felsenfest überzeugt, Californien und die USA waren der Exportmarkt der Triumph die weitaus besten Absatzmöglichkeiten bot. Und weil er so wahnsinnig überzeugt und gleichzeitig überwältigt war, handelte er mit seinem Chef, Jack Sangster, aus, dass er fortan jedes Jahr für sechs Monate in den USA verweilen durfte, um dort Marketing und Vertrieb seiner Motorräder voranzubringen. Ob es wirklich notwendig war, dass der Managing Director der Triumph Engineering Inc. sich fernab von der Heimat und seinem Schreibtisch am anderen Ende von der Welt jedes Jahr sechs Monate lang höchstpersönlich um Dinge kümmern musste, für die an der Westküste mit Bill Johnson und Will Ceder und später an der Ostküste andere hervorragende Leute bereitstanden, und ob nicht vielleicht auch geheime private Gründe die eigentliche Ursache für Edward Turners jahrelanges Doppelleben waren, und was eigentlich Mrs. Turner von der ganzen Angelegenheit hielt – Turner hatte seine erste Frau 1939 bei einem Autounfall verloren und 1952 seine zweite Frau Shirley geheiratet. Das Paar hatte insgesamt drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn – steht auf einem anderen Blatt. Bert Hopwood, der ab Mai 1961 mal wieder bei Triumph/BSA angeheuert hatte, erinnert sich jedenfalls, dass das Triumph-Werk bei Turners Abwesenheit und dem notorischen Desinteresse Sangsters am operativen Geschäft mehr oder weniger im Automatik-Modus lief, und sollte die Entwicklungsabteilung aus Eigeninitiative einmal aktiv geworden sein, um die Motorräder qualitativ zu verbessern, so wurde dieser unerwünschte Aktionismus bei Rückkehr des braungebrannten Turners durch einen seiner gefürchteten Wutanfälle todsicher abgestraft. Shirley Turner war durch die kleinen Kinder an das Haus gefesselt und vereinsamte zusehends, auch wenn ihr Mann zuhause war, Abend für Abend versackte er dann seinen Lunch in sich hineinkauend für gewöhnlich vor dem Fernseher, weshalb sie eines Tages feststellte, ihr Leben bestünde im Wesentlichen darin, den Nachrichtensprechern beim Älterwerden zuzusehen. Aber was auch immer Turner bewogen hatte, zum Teilzeit-Amerikaner zu werden, der Erfolg gab ihm recht, aus den ursprünglich anvisierten 1000 Motorrädern, die Turner pro Jahr in den USA verkaufen wollte, wurden schnell sehr viel mehr, die Investitionen in den Motorsport und diverse Geschwindigkeitsrekorde in der Salzwüste bei Bonneville, nach denen Turner seine Motorräder als „The fastest Motorcycle in the World“ vermarktete, zahlten sich aus. Triumph Motorräder wurden zum „Kult“ in Californien aber auch zunehmend in anderen Bundesstaaten der USA. Abgesehen von ein paar Flops, die wohl zu allererst britischer Skurrilität zu schulden waren, verkauften sich die einzelnen Modelle wie die T100, die Trophy, die Thunderbird aber später natürlich auch die Bonneville so glänzend, dass, obwohl Triumph zeitweise bis zu 70% der Jahresproduktion in die USA exportierte, die Triumphs in Amerika dennoch Mangelware blieben, da die Nachfrage das Angebot bei weitem übertraf. Wobei man dazu sagen muss, dass sich Triumphs Jahresproduktion seinerzeit, in den 1950ern, so ungefähr bei 20.000 Motorrädern einpendelte. Edward Turner, der Teilzeit-Amerikaner, hatte den USA also ziemlich viel, wenn nicht sogar alles zu verdanken, was er seinerseits ebenfalls mit Dankbarkeit, aber auch mit Interesse an seiner Wahlheimat und deren technischen Errungenschaften zurückzahlte, wie ein kleiner Ausflug in die Automobilgeschichte verdeutlichen wird. Nach seinen ersten Beobachtungen und Erfahrungen in den USA ging Turner seinem Chef Sangster relativ schnell mit der Idee auf die Nerven, für den amerikanischen Mark nicht nur Motorräder zu bauen, sondern auch ein Auto speziell für diesen Markt zu entwickeln und anzubieten. Sangster lehnte zunächst ab, nachdem Turner 1956 aber mit Hilfe von Sangster Chef der BSA Automotive Group geworden war, zu der auch der britische Autohersteller Daimler gehörte, bekam er endlich seine Chance: Edward Turner entwickelte nicht nur, sondern designte auch einen Daimler speziell für den us-amerikanischen Markt. Und zwar einen zweisitzigen Sportflitzer, ganz in der Tradition britischer Roadster, sollte man meinen und könnte man auch meinen, aber eigentlich baute Turner keinen traditionellen britischen Roadster, er schien vielmehr ein anderes Vorbild zu haben. Denn als er das Projekt das erste Mal mit einem Mitarbeiter besprach, zauberte er ansatzlos die Ersatzteilliste und die technischen Zeichnungen eines V8-Motors aus dem Schreibtisch, den General Motors für Cadillac entworfen hatte. Diesen Motor hielt er für den geeigneten Antrieb für Daimlers oder vielmehr seinen neuen verkappten britischen Roadster, wenn auch selbstredend ergänzt um Elemente der genialen Motorsteuerung, die er höchstselbst einst für die Motorradmotoren von Triumph entworfen hatte. Aber das war noch nicht alles, als Werkstoff für die Karosserie wählte er nicht Stahlblech oder Aluminium, wie man es eigentlich hätte erwarten sollen, sondern ausgerechnet glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK), auch Fibreglass genannt. GFK, das „Carbon“ der 1950er und 60er Jahre, welches aufgrund seines geringen Gewichts für den Sportwagenbau geradezu prädestiniert war, wurde nur wenige Jahre zuvor erstmals im Fahrzeugbau verwendet. Es war die californische Woodill Motor Company Inc., die ab 1952 die GFK-Karosserie einer Zulieferfirma für den Sportwagenbau verwendete, womit dem Woodill Wildfire die Ehre gebührt, das erste seriengefertigte Auto mit GFK-Karosserie gewesen zu sein, wenn auch nur in einer Kleinserie von überschaubaren 300 Stück.

Woodill Wildfire
Das Auto aber, welchem die aus GFK gefertigte Karosserie gleichsam zum Markenzeichen werden sollte, war die Chevrolet Corvette, deren erste Version, die C1, 1953 an den Start ging, Zunächst nur mit einem Reihen-Sechszylindermotor motorisiert, war sie nicht gerade ein Verkaufsschlager, was sich aber ändern sollte, als man ihr endlich, 1955, einen V8-Motor verpasste. Und schaut man sich nun die 1956 Chevrolet Corvette an:

1956er Chevrolet Corvette („C1“)
Und vergleicht man sie mit Edward Turners fertigem Daimler SP 250:

Edward Turners Daimler SP 250
So lassen sich einige Ähnlichkeiten nicht verleugnen. Und – na klar – könnte man jetzt einwenden, dass die erste Corvette einige Anleihen beim Design britischer Roadster genommen haben könnte, was auch tatsächlich der Fall war, weshalb die Corvette zwangsläufig Turners Daimler SP 250 ähneln müsse, weil dieser nunmal in der Tradition britischer Roadster stehe, eben weil er tatsächlich ein britischer Roadster ist, und deshalb beide Autos so aussehen, wie Sportwagen in dieser Zeit, den 1950er Jahren, eben ausgesehen haben. Und das stimmt natürlich alles, aber dennoch haben die erste Chevrolet Corvette und der Daimler SP 250 drei Merkmale gemeinsam, die für diese beiden Autos so ziemlich einzigartig sind, und die sie deshalb von anderen britischen Roadstern oder Sportwagen dieser Epoche unterscheiden. Und das sind: Die GFK-Karosserie, der V8-Motor – britische Sportwagen oder Roadster wie Jaguar, Aston-Martin, Triumph oder beispielsweise Austin-Healey waren seinerzeit mit Vier- oder Sechszylinderaggregaten unterwegs – und demzufolge auch das mehr oder weniger grosse „V“, welches aussen irgendwo an der Karosserie angebracht war, womit zuerst Chevrolet signalisieren wollte, dass Autos mit diesem Emblem den stärkeren V8-Motor erhalten hatten, und was dann Turner für seine Kreation gerne und mehr oder weniger dezent übernahm. Edward Turner war also nicht nur Teilzeit-Amerikaner, sondern hatte auch ein waches Auge für die neuesten technologischen Errungenschaften seiner Teilzeit-Wahlheimat. Und wenn auch der Daimler SP 250 ein ziemlicher Flop wurde, der selbst auf dem angepeilten US-Markt, auf dem es einige gutbetuchte Fans britischer Sportwagen gab, nicht reüssieren konnte, vielleicht auch, weil er so konsequent nicht-ähnlich-ähnlich um die Corvette C1 „herumdesignt“ war, weshalb er so grottenhässlich geriet, gibt es nun doch mehr als einige Indizien, die dafür sprechen, dass Edward Turner, so er denn die Wahl gehabt hätte, sich ein Flugzeug der BOAC-Flotte für seinen Trip nach Tokio auszusuchen, sich ein amerikanisches Flugzeug ausgesucht hätte, und weil er nunmal auch ein Technikfreak war, ganz sicher kein Propellerflugzeug, sondern – wenn schon, denn schon – den Vertreter einer ganz neuen Generation von Verkehrsflugzeugen, der in den nächsten Jahren gewissermassen zu dem Goldstandard der Verkehrsfliegerei werden sollte – also keine andere Maschine als die Boeing 707.
So, das hätten wir jetzt endlich. Ohne es zu wissen, hatten wir den Managing Director der Triumph Engineering Inc. also an Bord einer Boeing 707 verfrachtet. Da sitzt er jetzt schon einige Zeit, während wir uns mit der Flugzeug-Frage herumgeplagt und die Piloten die Boeing bereits auf die Warteposition vor der Startbahn bugsiert haben. Die Kabinen-Crew hatte vorher kontrolliert, dass alle Passagiere ordnungsgemäss angeschnallt sind, und dann, nach einem letzten Hinweis, dass das Rauchen während des Startvorgangs nicht gestattet ist, auf ihren für den Start vorgesehenen Sitzen Platz genommen. Nachdem die Piloten vom Tower die Freigabe erhalten haben, rollen sie jetzt auf die Startbahn und richten die Boeing 707 mittig auf dieser aus. Es folgt ein letzter Hinweis an die Kabinen-Crew, dass der Start unmittelbar bevorsteht: „Cabincrew! Prepare for Departure!“ So oder so ähnlich krächzt die Stimme des Kopiloten aus dem Lautsprecher im Servicebereich. Wenige Sekunden später erteilt der Tower Startfreigabe, der Pilot bringt die Turbinen zunächst auf 50% ihrer Leistung und dann, nachdem er sich von ihrer fehlerfreien Funktion überzeugen konnte, auf maximalen Schub. Die Boeing 707 gewinnt schnell an Fahrt, ihre Räder passieren die Nahtstellen der Betonplatten der Startbahn immer schneller, die Boeing vibriert immer stärker und schüttelt die Passagiere in ihren Sitzen durch, dann, nach Erreichen der vorgeschrieben Startgeschwindigkeit, hebt der Pilot die Nase des Flugzeuges an und die Räder verlieren in kurzer Folge den Bodenkontakt, die Boeing steigt jetzt steiler und presst das Gewicht der Passagiere in die Lehnen ihrer Sitze, sodass ihre Skelette gefühlt ein kleines Stück durch das weiche Fleisch ihres Körpers nach hinten gedrückt werden. Das Material aller besetzten Sitze ächzt und knarrt gleichzeitig unter der Anstrengung der Schwerkraft wie auf ein Kommando. Für einen kurzen Moment ist abgesehen vom Dröhnen der Triebwerke dann absolute Ruhe in der Druckkabine, bis Edward Turner hört, wie das Fahrwerk eingezogen wird und sich die Abdeckungen der Fahrwerksschächte wieder schliessen. Der Pilot fliegt die Boeing, die noch im Steigflug begriffen ist, in eine Kurve und richtet deren Nase anschliessend nach Norden aus, denn ohne dass Edward Turner dies weiss, hatten wir ihm nicht nur ein Flugzeug nach Wunsch unter den Hintern gezaubert, sondern ihm auch noch eine besonders spektakuläre Route spendiert. Und zwar die sogenannte Polroute, auf welcher die Verkehrsflugzeuge eine Zeitlang über den Nordpol mit einer Zwischenlandung in Anchorage nach Tokio geflogen sind. Das war auch so eine Art Renommier-Dings der Airlines, jede interkontinentale Fluggesellschaft, die etwas auf sich hielt, bot diese Route an, einige schenkten den Passagieren auf diesen Flügen sogar so eine Art Andenken, auf welchem ihnen bescheinigt wurde, dass sie über dem Nordpol gewesen sind. BOAC hatte diese Route auch im Programm, allerdings erst nach Turners Tokio-Flug, was uns aber natürlich und selbstredend schnurzpiepe ist. Die 707 hat jetzt ihre Reiseflughöhe erreicht, der Chief Steward tritt an die Lautsprechanlage und informiert die Passagiere darüber, dass sie die Sicherheitsgurte wieder öffnen können und dass das Rauchen wieder erlaubt ist, ausserdem werde die Kabinen Crew sogleich mit dem Bordservice beginnen und ein paar Erfrischungen offerieren, bevor sich der Lunch anschliessen wird. Die Kabinencrew eines Interkontinentalfluges von BOAC besteht zu dieser Zeit aus insgesamt sechs Personen: Dem Chief Steward, Steward One, Steward Two, allesamt Männer, und dann noch drei Damen, die aber nicht Stewardessen genannt werden, sondern „A“-Lady, „B“-Lady und „C“-Lady. Die Crew ist in Uniformen gekleidet, die entfernt an Marineuniformen erinnern, die „Ladies“ stecken in dunkelblauen Röcken, die knapp über die Knie reichen, die ebenfalls dunkelblauen Uniformjacken sind wie die Röcke sehr körpernah geschnitten, unter der Jacke, die abgelegt werden darf, tragen die Damen reinweisse Blusen, und den Kopf ziert ein Schiffchen, so eine Art Vorgänger der Pillbox, wie sie in den frühen 1960er Jahren von der Stilikone Jackie Kennedy populär gemacht werden sollte. Die Uniformen, von einem bekannten britischen Modedesigner entworfen, sind also nicht nur auf der Höhe der Zeit, sondern versprühen durchaus auch eine dezente Portion Glamour, was natürlich beabsichtigt ist.

Werbeanzeige der BOAC Mitte der 1960er Jahre. Wer oder was wohl mit „flighty birds“ gemeint war..?
BOAC war seinerzeit eine der besten Fluggesellschaften der Welt, man verstand sich als die „Elite Fleet“ und hatte eine führende Rolle bei der Etablierung dessen inne, was man heute den „Jet Set“ nennt, indem sich BOAC mit den jetzt zur Verfügung stehenden Langstrecken-Flugzeugen, allen voran der 707, weitere attraktive Destinationen erschloss, zu welchen sich dann die zahlungskräftige Kundschaft der Schönen und Reichen der 1960er und 1970er Jahre einfliegen liess. Entsprechend wichtig war BOAC deshalb das äussere Erscheinungsbild des Kabinenpersonals, was sich nicht nur auf die Uniform beschränkte, vor allem die weiblichen Mitarbeiter der Cabin Crew hatten, wenn sie auch nicht allzu gross sein durften, den gängigen Schönheitsidealen ihrer Zeit zu entsprechen, wobei von Seiten des Arbeitgebers vor allem auf schöne Beine Wert gelegt wurde. In Zeiten, da die Airlines nicht über den Preis miteinander konkurrieren konnten und wollten, weil die Kosten für ein Ticket für alle Airlines durch die IATA, dem Dachverband der Fluggesellschaften, verbindlich festgelegt wurde, musste man sich eben durch andere Merkmale unterscheiden. Eines war die Qualität des gebotenen Service während des Flugs und ein weiteres die Schönheit des weiblichen Kabinenpersonals. Die Flugbegleiterinnen hatten dementsprechend jung und hübsch zu sein und wer das in den Augen der jeweiligen Personalchefs nicht war, kam gar nicht erst an Bord einer der Maschinen, und wer es dennoch schaffte, wurde mit spätestens 35 Lebensjahren wieder aussortiert und dem Bodenpersonal zugeordnet. Nur die Schönen und Jungen sollten das Privileg haben, die Schönen und Reichen begleiten zu dürfen, was dann auch zur Folge hatte, dass manche der Schönen und Jungen durch Heirat reich geworden sind, weshalb einige Fluggesellschaften dazu übergingen, explizite Heiratsverbots-Klauseln in die Arbeitsverträge ihrer Stewardessen hineinzuschreiben. Kurzum, der Beruf der Stewardess hatte damals im Kontrast zu dem gehetzten Berufsalltag der heutigen „Saftschubsen“ eine gewisse glamouröse, wenn nicht sogar mondäne Aura, auch weil an den sehr oft illustren Zielen ihrer Reisen mindestens ein freier Tag winkte, den nicht wenige der damaligen Flugbegleiterinnen gerne nutzten, um das Partyvolk in den Clubs und Bars des Jet Sets vor Ort zu verstärken. Kein Wunder also, dass die Personalchefs sich vor Bewerberinnen kaum retten konnten, allein BOAC soll 1960 lediglich 2% der Möchtegern-Stewardessen eine Zusage erteilt haben. Eine der Auserlesenen der BOAC, es ist die „C“-Lady, nennen wir sie Carol Webb, nimmt jetzt endlich den Menu-Wunsch eines gewissen Edward Turner entgegen, der sich gegen den Kanadischen Hummer und für das Roastbeef mit Cambridge Sauce, Röstkartoffeln, Gemüseallerlei und Yorkshire Pudding entschieden hat. Und auch um ihm die Wartezeit etwas zu verkürzen, stellt „C“-Lady Carol Webb das ersehnte Glas Tomatensaft in die runde Vertiefung im Klapptisch vor Edward Turner, kurz darauf reicht sie ihm noch einen Salz- und einen Pfefferstreuer und vielleicht stellt sie sich hierbei – Miss Webb ist erst seit ungefähr zwei Wochen offizielle „C“-Lady der BOAC auf der Interkontinentalstrecke – etwas ungeschickt an, denn Mr. Turners Blick fällt in den Ausschnitt ihrer weissen Uniformbluse und was er dort entdeckt, irritiert ihn dann doch ein wenig. Natürlich gab es auch bei BOAC wie bei allen anderen Airlines bestimmte „Dresscodes“ für die Flugbegleiterinnen, diese schrieben das korrekte Tragen der Uniform genau vor, erstreckten sich aber auch über Vorschriften für das richtige Make up oder die Frisur. Vorschriften für die zu tragende Unterwäsche im Dienst gab es jedoch nicht oder fast nicht, denn es galt eigentlich als schicklich oder selbstverständlich, dass die Unterwäsche oder hier: der BH in einer Frage gewählt werden sollte, die nicht durch den weissen Stoff der Uniformbluse gewissermassen hindurch schimmert und damit die Kontur der Unterwäsche offenbart. Aber genau das tat der BH von Miss Carol Webb, der „C“-Lady auf Edward Turners Flug nach Tokio, er schimmerte in seinen Konturen durch die weisse Uniformbluse hindurch, denn der BH der „C“-Lady war nicht weiss wie die BHs der anderen Ladies an Bord von Edward Turners Flug nach Tokio und auch nicht so weiss wie die BHs der ganzen anderen „A“-, „B“- und „C“-Ladies auf den inzwischen sehr vielen Flügen Edward Turners nach den USA zu Bill Johnson und zurück. Miss Carol Webbs BH war vielmehr apricotfarben! Und genau das irritierte Edward Turner. Wir wissen natürlich nicht genau, warum Miss Carol Webb ausgerechnet bei diesem Flug gegen den impliziten Dresscode für die beim Dienst zu tragende Unterwäsche verstiess. Und – na klar! – auch der Gang in irgendein staubiges Archiv wird uns der Antwort auf diese weltbewegende Frage nicht näher bringen, denn selbst wenn wir tatsächlich noch die alte Personalakte von Miss Carol Webb fänden, welche einen Verweis, einen Tadel oder eine Abmahnung der Personalabteilung von BOAC wegen des Verstosses gegen den impliziten Dresscode für die beim Dienst zu tragende Unterwäsche enthielte, so würde uns das über ihre eigentliche Motivation, einen nicht dresscode-konformen Büstenhalter zu tragen wenig bis gar nichts verraten. Vielleicht hat Carol Webb an dem Morgen des Tages an dem Edward Turners Flug nach Tokio stattfinden sollte, sich einfach vertan, vielleicht war es noch sehr früh und dunkel, als sie sich angezogen und fertig gemacht hat, sodass sie im funzeligen Licht einer englischen Glühbirne von Lucas Industries den von ihr aus einer Schublade entnommenen Büstenhalter für weiss hielt, was er aber nicht war. Vielleicht war sie zudem in Eile, weil sie verschlafen hatte? Vielleicht aber hatte vor einigen Tagen auch Franz Copeland Murray Alexander bei Carol Webb angerufen, der jamaikanische Cricketer des West Indies Cricket Teams, den Carol Webb auf einem Flug nach Bombay kennengelernt hatte, wo er und sein Team gegen Indien spielen sollten, und den sie so süss fand, um sich mit ihr zu verabreden. Und vielleicht hatte sie extra für dieses Date den apricotfarbenen Büstenhalter angezogen, obwohl sie eigentlich fest entschlossen war, es nicht bis zum Äussersten kommen zu lassen, was dann aber leider nicht geklappt hat, weil Gerry Alexander, wie ihn seine Freunde nannten, an diesem Abend so unglaublich süss war, und sie am nächsten Morgen allein und viel zu spät mit brummendem Schädel in einem billigen Hotelzimmer aufwachte, woraufhin sie eilig ihre Klamotten zusammenraffte, sich notdürftig frisch machte, sich anzog und mit dem Taxi zum Flughafen fuhr, ohne sich zuhause noch einmal umziehen und das Fluggepäck abholen zu können. Am Flughafen angekommen, konnte sie endlich das Cocktailkleidchen gegen die Uniform tauschen, für den apricotfarbenen BH fand sich in ihrem Spind jedoch kein Ersatz. Vielleicht aber war der apricotfarbene BH, der gegen den impliziten dresscode der BOAC verstiess, gar kein Missgeschick, sondern pure Absicht? Vielleicht hatte Miss Carol Webb, die vielleicht nicht unbedingt die Hellste war, einen Tag vor Abflug die Passagierliste von Edward Turners Flug nach Tokio in die Finger bekommen und war wie immer die Namen der Passagiere der First Class durchgegangen, begierig zu erfahren, ob auf diesem Flug Prominente mit von der Partie sein würden, um dann bei dem Namen „Clifford Richard“ hängenzubleiben, woraus sie messerscharf schloss, dass es sich bei diesem Passagier nur um den bekannten Schlagersänger handeln könnte, dessen glühender Fan sie war. Und vielleicht entschloss sie sich dann in Verkennung der Tatsache, dass es sich bei „Cliff Richard“ um einen Künstlernamen handelt, Flugtickets aber unter dem Klarnamen gebucht werden müssen, dem von ihr verehrten Cliff Richard ein mehr oder weniger dezentes Signal zu senden, dass sich ein Erfragen ihres Tokioter Hotels durchaus lohnen könnte? Vielleicht war es so gewesen, aber wenn es so war ist, dürfte Miss Carol Webbs Enttäuschung ziemlich gross gewesen sein, nachdem sie hinter dem Chief Steward stehend, dem wie immer das Privileg zufiel, die Passagiere während des Boardings zu begrüssen, stets ein Auge auf die offene Kabinentür hatte, in der vergeblichen Hoffnung, der von ihr angehimmelte Schlagerstar würde sogleich in dieser erscheinen, was er jedoch nicht tat, sie aber nach Abschluss des Boardings feststellen musste, dass der durch Clifford Richard gebuchte Sitzplatz „3A“ doch besetzt war und zwar nicht durch Harry Roger Webb, wie der Schlagerstar mit bürgerlichem Namen hiess, sondern eben durch den echten Clifford Richard, einen kleinen, korpulenten, rotgesichtigen, schwitzenden, kahlköpfigen Mann mittleren Alters, der ihr schon während des Boardings durch seine Alkoholfahne unangenehm aufgefallen war, als er sich mit seinem beeindruckendem Körperumfang an ihr vorbei quetschte, um zu seinem Sitzplatz zu gelangen. Nun war dieser Clifford Richard, Geschäftsführer eines britischen Landmaschinenherstellers, auf dem Weg zu einer asiatischen Landmaschinen-Messe, gewiss kein schlechter Kerl, allerdings brachte er zwei Neigungen oder auch Eigenschaften mit an Bord von Edward Turners Flug nach Tokio, die in Kombination mit einem durch eine weisse Stewardessen-Bluse hindurch schimmernden apricotfarbenen BH eine fatale, um nicht zu schreiben, nervtötende Wirkung entfalten konnten. Zum einen litt Clifford Richard an chronischer Flugangst, weshalb er es normalerweise und unter allen Umständen vermied zu fliegen, lieber sass er auf Geschäftsreisen stundenlang im Zug oder liess sich mit der Fähre über den Kanal schippern, um auf dem Kontinent angekommen, wieder in den Zug zu steigen. Diese Art des Reisens funktionierte leidlich gut auf den britischen Inseln oder innerhalb Europas, um aber asiatische Landmaschinen-Messen zu besuchen, waren diese beiden Verkehrsmittel, die Eisenbahn und das Schiff, dann doch zu langsam und deshalb zu zeitaufwendig im Vergleich zu diesen neuen Düsenjets. Das leuchtete auch dem rationalen Verstand des Geschäftsführers eines britischen Landmaschinenherstellers ein, allein liess sich seine chronische Flugangst nicht durch den Verweis auf die enorme Zeitersparnis besänftigen, dazu brauchte es schon ein bisschen mehr. Und was es dazu brauchte, befand sich in den drei grossen Flachmännern, die Clifford Richard in den grosszügig geschnittenen Innentaschen seiner Tweedjacke – Geschäftsführer britischer Landmaschinenhersteller haben nunmal einen bewundernswerten Sinn für praktische Dinge – bei sich trug, genau genommen in nur noch zwei der drei Flachmänner, denn einer war bereits bis zur Gänze geleert und ein zweiter nur noch halbvoll. Und zum anderen litt Clifford Richard an Morbus Pick, wobei „Leiden“ seinen damaligen Gemütszustand nicht ganz traf, denn Morbus Pick oder eine Frontotemporale Demenz, wie man die Krankheit heute auch nennt, wurde bei Clifford Richard nie diagnostiziert, was auch damit zu tun haben könnte, dass Clifford Richard zu früh gestorben ist – zwei Jahre nach Edward Turners Flug nach Tokio sollte er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen – bevor die Krankheit auch zu ernsthaften Sprach- und Gedächtnisstörungen hätte führen können. Bisher äusserte sich Morbus Pick, welche eine Krankheit beschreibt, durch die sich die Stirn- und Schläfenlappen des Gehirns langsam auflösen, in ihrer Frühphase bei Mr. Richard lediglich durch bestimmte Verhaltensauffälligkeiten und Wesensveränderungen, die in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hatten. Konkret bedeutete dies, dass Clifford Richard neben einer gewissen Distanzlosigkeit eigentlich vor allem zwei Diagnosekriterien der Frühphase von Morbus Pick erfüllte und zwar das der in der medizinischen Fachliteratur sogenannten „Witzelsucht“ und das der stark gesteigerten Fixierung auf sexuelle Reize, Themen und Inhalte, was wiederum zur Folge hatte, dass Richard Clifford in zwischenmenschlichen Situationen dazu neigte, einen dämlichen schlüpfrigen Witz nach dem anderen abzufeuern und sich dabei auch noch selbst krumm und schief zu lachen, um es mal ein bisschen defensiv zu formulieren. Es konnte also wirklich nicht die Rede davon sein, dass Mr. Richard an seiner Krankheit „litt“, vielmehr amüsierte sie ihn königlich. Auch konnte eigentlich sehr selten die Rede davon sein, dass seine Mitmenschen unter seiner krankheitsbedingten Neigung, einen dämlichen schlüpfrigen Witz nach dem anderen abzufeuern, litten, vielmehr war meist das Gegenteil der Fall, denn Mr. Richard, der Geschäftsführer eines britischen Landmaschinenherstellers, bewegte sich geschäftsbedingt in einem Milieu, dem Milieu der Landmaschinenhersteller, der Landmaschinenkäufer und Landmaschinenbenutzer, welches sich durch eine gewisse dankbare Empfänglichkeit für dämliche schlüpfrige Witze auszeichnete, was sich auch in den Verkaufszahlen widerspiegelte, denn seitdem Mr. Richard die krankheitsbedingte Sucht entwickelt hatte, einen dämlichen schlüpfrigen Witz nach dem anderen abzufeuern, waren diese sprunghaft angestiegen. Wiewohl man dem Geschäftsführer eines britischen Landmaschinenherstellers zumindest bis zu diesem Zeitpunkt seiner Krankheit noch zugutehalten musste, dass er zwar die Sucht, in zwischenmenschlichen Situationen einen dämlichen schlüpfrigen Witz nach dem anderen abfeuern zu müssen, nicht mehr unter Kontrolle hatte, jedoch immerhin und bis dato erfolgreich bemüht war, hinsichtlich der Qualität seiner schlüpfrigen Witze ein gewisses Niveau dann doch nicht zu unterschreiten. Jetzt aber, nach dem Genuss von anderthalb Flachmännern besten schottischen Whiskys, war bei Mr. Richard, der sonst eigentlich kaum Alkohol zu sich nahm, schon eine – joah – gewisse Enthemmung eingetreten, dergestalt, dass Mr. Richard, als er endlich und schwitzend auf seinem Sitz in der First Class Platz genommen hatte, so etwas wie ein rüde aufmunitioniertes, entsichertes und durchgeladenes Maschinengewehr dämlicher schlüpfriger Witze war, das jedoch gerade noch von seiner Flugangst in Schach gehalten und damit leidlich neutralisiert wurde. Und so hätte es vielleicht den ganzen Flug über bis zur Zwischenlandung in Anchorage bleiben können, ein fragiles Patt zwischen Flugangst und Witzelsucht, eine alkoholisierte Balance auf des Messers Schneide, wenn nicht, ja, wenn Mr. Richard nicht nach dem Start und den dann erfolgten Hinweisen, dass man die Sicherheitsgurte wieder öffnen könne und auch das Rauchen wieder erlaubt sei, eine liebliche Stimme vernommen hätte, die zu ihm sprach: „Entschuldigen Sie, Sir, hatten Sie schon Gelegenheit, einen Blick in die Menukarte zu werfen?“, woraufhin Mr. Richard sich der Stimme zuwandte und zunächst in die wasserblauen Augen von „C“-Lady Carol Webb schaute, um dann…

Wir wissen nicht, warum Edward Turner irritiert war, als er entdeckte, dass Miss Carol Webb sich des Dresscodes der BOAC entzogen und statt einem reinweissen einen apricotfarbenen Büstenhalter angelegt hatte, wenn er überhaupt irritiert war, was wir ja auch nicht so genau wissen. Gesetzt den Fall, er war tatsächlich irritiert, dann vielleicht, weil Edward Turner ein sehr ordnungsliebender Mensch war, der es hasste, wenn etwas die Ordnung der Dinge oder hier besser: Die BOAC-Ordnung der Büstenhalter störte? Vielleicht war diese Ordnungsliebe auch der eigentliche Grund für seine regelmässigen Wutanfälle, die vielleicht immer dann einsetzten, wenn er wieder einmal entdecken musste, dass die Ordnung der Dinge in seiner Vorstellung nicht oder nicht mehr der Ordnung der Dinge in der realen Welt entsprach. Vielleicht war also nicht Ordnungsliebe der eigentliche Grund für seine regelmässigen Wutanfälle, sondern war dieser Grund vielmehr eine tief sitzende Furcht die Kontrolle über die Dinge zu verlieren? Vielleicht war Edward Turner also ein furchtgetriebener Kontrollfreak? Aber verlässt ein furchtgetriebener Kontrollfreak jedes Jahr und über Jahre hinweg die heimatliche Triumph Engineering Inc., die ja auch so etwas wie sein Lebenswerk war, um sich in Californien ein halbes Jahr lang um den Vertrieb der durch die Triumph Engineering Inc. hergestellten motorisierten Zweiräder zu kümmern, während sich die heimatliche Triumph Engineering Inc. in Merry Old England ohne die Fügungen und Weisungen des Meisters, der letztendscheidungsgewaltig gewohnt war, alles und jedes bis auch in das Detail zu weisen und zu verfügen, sich über Monate hinweg quasi im automatisierten Blindflug befindet? Und das auch noch während einer Epoche, welche mit Briefpost und Telegrafie nur sehr unzureichende Kommunikationsmittel zur Verfügung stellte, die es nicht erlaubten, sich in Californien über den Fortgang der Geschäfte und Entwicklungen in den heimatlichen Gefilden in dem Masse auf dem Laufenden zu halten, wie es eine gewissenhafte Geschäftsführung doch erfordern sollte? Wohl eher nicht. Vielleicht war Edward Turner also aus einem anderen Grund irritiert, als er den apricotfarbenen Büstenhalter durch die reinweisse BOAC-Stewardessen-Bluse der „C-Lady“ Carol Webb hindurch schimmern sah? Vielleicht kam ihm dieser apricotfarbene BH irgendwie bekannt vor? Vielleicht hatte er ihn schon einmal gesehen? Vielleicht wusste er nicht mehr wo und an wem? Vielleicht zermarterte er sich, nachdem er den apricotfarbenen BH wahrgenommen hatte, was eine Irritation in ihm auslöste, das Hirn, warum das Wahrnehmen dieses apricotfarbenen BHs eine Irritation in ihm ausgelöst hatte und ob es vielleicht sein könnte, dass er, der BH, ihm irgendwie bekannt vorkam, er, Edward Turner, aber nicht mehr wusste, wo und an wem er ihn einst gesehen haben könnte? Vielleicht hatte er schlichtweg vergessen, dass seine bezaubernde Frau Shirley genau den gleichen apricotfarbenen BH getragen hat, nachdem sie – in Vorfreude auf seine letzte Wiederkehr aus Californien – beschlossen hatte, ihre Unterwäsche-Garderobe ein wenig frivol aufzumöbeln, in der leider vergeblichen Hoffnung, Edwards Interesse an ihr würde so den ersten ehelichen Wiederkehr-Pflicht-Beischlaf deutlich länger überdauern als sonst? Vielleicht war es genau so? Vielleicht aber wusste Edward Turner sehr wohl, wo und an wem er genau den gleichen apricotfarbenen Büstenhalter einst gesehen hatte? Vielleicht gab es ja einen viel handfesteren Grund, warum Edward Turner jahrelang jedes Jahr ein halbes Jahr die Triumph Engineering Inc., seine Familie, seine Frau und die Kinder alleine liess, um sich in Californien um den Vertrieb der von der Triumph Engineering Inc. hergestellten motorisierten Zweiräder zu kümmern, womit eigentlich genug andere Fachleute befasst waren, die den us-amerikanischen Motorradmarkt sehr viel besser kannten als er? Und vielleicht hatte dieser handfestere Grund einst den gleichen apricotfarbenen Büstenhalter getragen, wie er eben durch durch die reinweisse BOAC-Stewardess-Uniform-Bluse der „C-Lady“ Carol Webb hindurch schimmerte? Womöglich hatte „C-Lady“ Carol Webb den apricotfarbenen BH gar nicht in England gekauft, sondern während eines Day Off in San Francisco? Vielleicht war dieser BH also ein us-amerikanisches Fabrikat, das in Europa gar nicht offiziell vertrieben wurde, sodass abgesehen von ausländischen Stewardessen und ein paar Touristinnen eigentlich nur Amerikanerinnen diesen BH kaufen und tragen konnten? War Edward Turners handfesterer Grund also eine US-Amerikanerin? Hatte also eine US-Amerikanerin den gleichen BH wie den, der durch die reinweisse BOAC-Stewardess-Uniformbluse der „C-Lady“ Carol Webb hindurch schimmerte und der den armen Clifford Richard fast um den Verstand bringen sollte, in einem californischen Unterwäscheladen oder der Unterwäsche-Abteilung eines californischen Kaufhauses gekauft? Aber warum nur US-AmerikanerIN? Vielleicht hatte ja auch ein US-Amerikaner diesen BH gekauft? Aber warum nur US-Amerikaner? Vielleicht hatte ja auch einfach nur ein Mann diesen BH in einem californischen Unterwäscheladen oder der Unterwäsche-Abteilung eines californischen Kaufhauses gekauft? Womöglich ein Engländer? Womöglich Edward Turner SELBST? Aber für wen nur? Vielleicht für Bill Jo..?
Okeeeeh… Es ist wohl besser, das jetzt hier abzubrechen… Warum? Na, dafür gibt’s eigentlich genau zwei Erklärungen. Und zwar – wie fast immer – eine offizielle und eine weniger offizielle, wobei die weniger offizielle die wahre Erklärung ist, während die offizielle aus dem üblichen honorigen und selbstbeweihräuchernden BlaBla besteht. Die offizielle geht so: Bei den hier vorgetragenen Zeilen handelt es sich zumindest in weiten Teilen um einen frei erfundenen Text, bei Edward Turner handelt es sich jedoch um keine frei erfundene Figur, denn Edward Turner gab es wirklich, er ist eine Person der Zeitgeschichte, zudem ist er auch noch tot, weshalb es nicht nur nicht in Ordnung wäre, ihm etwas frei Erfundenes wie beispielsweise das käufliche Erwerben von apricotfarbenen Büstenhaltern zu unterstellen, so wie es auch nicht in Ordnung wäre, ihm dazu noch zu unterstellen, dass er den apricotfarbenen Büstenhalter für seinen Freund Bill Johnson erworben haben könnte, was dann sozusagen implizit unterstellt, die beiden nicht mehr ganz mittelalten weissen Männer hätten seinerzeit Freude daran gefunden, sich gegenseitig mit Damenunterwäsche auszustaffieren, um sich in dieser ein wenig den Feierabend zu versüssen. Wobei – und das ist jetzt sehr wichtig: Es natürlich ABSOLUT okaaaaaaaaay ist, wenn nicht mehr ganz mittelalte Männer sich gegenseitig mit Damenunterwäsche ausstaffieren, um sich in dieser den Feierabend ein wenig zu versüssen. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Echt nicht! Allerdings galten zu Lebzeiten der historischen Persönlichkeiten Edward Turner und Bill Johnson andere Moralvorstellungen als heute, somit hätte es seinerzeit mit grosser Wahrscheinlichkeit einen ziemlichen Skandal gegeben, wenn herausgekommen wäre, dass die beiden nicht mehr ganz mittelalten weissen Männer Freude daran gefunden hätten, sich gegenseitig mit Damenunterwäsche auszustaffieren, um sich in dieser ein wenig den Feierabend zu versüssen, was vermutlich auch in den Verkaufszahlen der Triumph-Motorräder einen gewissen Niederschlag gefunden hätte, galten diese britischen Motorräder doch als der Inbegriff des echten „Männer-Motorrads“, ein Nimbus, der nicht nur vermutlich ein wenig gelitten hätte, wenn herausgekommen wäre, dass zwei nicht mehr ganz mittelalte weisse Männer, die nebenbei auch noch höchste und unmittelbare Verantwortung für Herstellung und Vertrieb dieser echten Männer-Motorräder hatten, Freude daran gefunden hätten, sich gegenseitig mit Damenunterwäsche auszustaffieren, um sich in dieser ein wenig den Feierabend zu versüssen. Und weil dem so ist, bleibt es natürlich unsere vornehmste Aufgabe, posthumen Schaden an dem tadellosen Ruf dieser beiden ehrenwerten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte abzuwenden, auch weil diese sich nicht mehr selbst wehren können, weil sie nämlich schon längst verstorben sind, und selbst wenn wir hierbei natürlich – aufgeklärt und modern wie wir nunmal sind – nur indigniert die Nase rümpfen können über die Moralvorstellungen einer Zeit, die so wenig Verständnis aufbrachte für die etwas speziellen Feierabendfreuden zweier nicht mehr ganz mittelalten Herren, werden wir diese Möglichkeit des Ursprungs einer eventuellen Irritation, die sich im Bewusstsein eines gewissen Edward Turner beim Erblicken eines apricotfarbenen Büstenhalters, welcher durch die reinweisse Uniformweste einer BOAC Stewardess hindurch schimmerte, vielleicht eingestellt haben mag, nicht weiter untersuchen.
Soweit die offizielle Erklärung. Die inoffizielle Erklärung – also, die einzige wahre Erklärung – nimmt keinerlei Rücksichten auf zarte Befindlichkeiten wie beispielsweise vergangene Moralvorstellungen oder gar den Ruf zweier längst verstorbener Herren. Das muss sie auch nicht, denn die inoffizielle Erklärung tritt ja sozusagen nie öffentlich in Erscheinung, sie ist gewissermassen die eigentliche Erklärung hinter der offiziellen Erklärung, die der inoffiziellen Erklärung quasi vorgeschoben wird. Sie, die inoffizielle Erklärung, ist also der eigentliche Grund oder auch die Erklärung für das Zustandekommen der offiziellen Erklärung, denn die inoffizielle Erklärung lässt die offizielle Erklärung überhaupt erst notwendig werden, weil die inoffizielle Erklärung sozusagen unsagbar ist. Und in dem hier vorliegenden Falle bedeutet das Unsagbare schlicht, dass durch eine weitere Untersuchung der weltbewegenden Frage, warum das Hindurchschimmern eines apricotfarbenen BHs durch die reinweisse Uniformweste einer BOAC-Stewardess bei Edward Turner anlässlich seines Fluges von London-Heathrow nach Tokio vielleicht eine Irritation ausgelöst haben mag, diesem Text noch weitere Leser verlustig gehen könnten. Wobei, und das kann man durchaus einwenden, es eigentlich völlig irrelevant ist, wie viele Leser diesen Kram hier lesen, weil der Autor schliesslich weder für die Zahl seiner Zeilen, noch nach der Anzahl seiner Leser bezahlt wird. Er wird gar nicht bezahlt! Allerdings könnte man dem wiederum entgegnen, dass gerade weil der Autor weder nach Anzahl seiner Zeilen oder seiner Leser bezahlt wird, er sich jede andere Möglichkeit des Geldverdienens offen halten muss. Und weil das so ist, könnte jetzt im Moment und genau hier:
X
ein Werbefilmchen aufpoppen, in welchem zu sehen ist, wie sich zwei curvy Topmodels of Color (TOCs) gegenseitig die Beine epilieren, um irgendsoein EpiLadyEpilierDings zu bewerben, was dann zur Folge hätte, dass endlich mal Geld in die Kasse des Autors kommt. Damit aber hier ein EpiLadyEpilierDings-Werbevideo mit zwei curvy Topmodels of Color (TOCs) erscheinen kann, muss dieser Text oder die Webseite auch noch die entsprechende Zielgruppe lesend am Start haben, denn sonst würde kein Werbestratege dieser Welt an eben dieser Stelle ein EpiLadyEpilierDings-Werbevideo mit zwei curvy Topmodels of Color (TOCs) buchen. Und natürlich handelt es sich bei dieser Zielgruppe mehrheitlich nunmal um Frauen im konsumfreudigen und noch epilierfähigen Alter. Weil aber in diesem Text ziemlich viel von Flugzeugen, Flugzeugabstürzen, Autos und Motorrädern die Rede war, und zudem auch noch das triste Hausfrauen-Dasein von Shirley Turner beleuchtet wurde, ist leider davon auszugehen, dass es nicht mehr so wahnsinnig viele Leserinnen bis zu dieser Stelle im Text (s.o.), wo ein EpiLadyEpilierDings-Werbevideo mit zwei curvy Topmodels of Color (TOCs) aufpoppen könnte, geschafft haben oder es schaffen werden. Sollten wir jetzt auch noch die Details von Edwards und Bills ganz speziellen Pyjamapartys eingehender untersuchen, bei welchen ein apricotfarbener BH eine pikante Rolle gespielt haben könnte, wird diese werberelevante Zielgruppe von Frauen im konsumfreudigen und noch epilierfähigen Alter danach mit ziemlicher Sicherheit gegen Null tendieren. Und um das – das Verlustiggehen von Zielgruppenleserinnen durch Zutodelangweilen, die man meistbietend an irgendwelche Werbestrategen hätte verhökern können – zu verhindern, haben wir die weitergehende Untersuchung bezüglich eines apricotfarbenen Büstenhalters abgebrochen und dazu noch mal eben so ne offizielle Erklärung abgefeuert.
Edward Turner riecht an seinem Glas Tomatensaft, den er soeben mit den kleinen Salz- und Pfefferstreuern aus Kristallglas, welche ihm dankenswerter Weise „C-Lady“ Carol Webb zusammen mit dem Glas Tomatensaft und einem kleinen silbernen Rührstab serviert hatte, gewürzt und anschliessend mit dem kleinen Rührstab umgerührt hat. Edward schmeckt die Aromen von Salz, Pfeffer und Tomatenfrucht, die in seinen Nasenhöhlen aufsteigen, in welche sich aber auch etwas Fremdes mischen, was Edward Turner als Duftmoleküle des penetranten Aftershaves seines Mitreisenden auf dem mittleren Sitz neben sich identifiziert. Edward Turner dreht den Kopf zum Fenster, um seinen Tomatensaft besser vor diesen fremden Duftmolekülen abzuschirmen. Er weiss eigentlich gar nicht genau, warum er auf seinen Flügen immer Tomatensaft zu sich nehmen muss, er trinkt Tomatensaft eigentlich immer nur im Flieger, auf dem Boden hatte er nie Tomatensaft getrunken, noch nicht mal eine Bloody Mary. Vielleicht geht diese Tomatensaftmarotte zurück auf einen Texaner, den er während eines inneramerikanischen Fluges nach Kansas City kennengelernt hatte, und der, während er seinen imposanten Cowboyhut die ganze Flugdauer auf behielt, ein Glas Tomatensaft bestellte, um ihn mit Salz und Pfeffer zu würzen, umzurühren und sodann mit zwei, drei kleinen Schlucken auszutrinken. Edward Turner weiss gar nicht mehr, was er faszinierender fand, den Cowboyhut oder dieses seltsame Tomatensaftritual, so wie er auch nicht weiss oder jemals darüber nachgedacht hat, ob ihm Tomatensaft überhaupt schmeckt. Er setzt das Glas Tomatensaft an die Lippen an und nimmt einen kleinen Schluck. Und das erste, was er spürt ist das scheinbare Zusammenziehen der inneren oder mundseitigen Kaumuskulatur und zwar auf beiden Seiten des Mundes. Wahrscheinlich die unmittelbare Reaktion auf das Anfluten der feinen Säure des Tomatensafts, welche das eigentliche Schmecken, also das Registrieren, Kombinieren, Erkennen und Einordnen der durch Geschmacks- und Duftrezeptoren auf Zunge und im Rachenraum gewonnenen und durch Hirnnervenfasern an höhere Hirnregionen weitergeleiteten Informationen, gewissermassen überholt. Der Gustofaziale Reflex, eine Art Feuerwehr, ein Warnsignal oder auch nur ein Reflex aus einem ganzen Arsenal von Reflexen im Hirnstamm, welcher eigentlich sagen will: Hey Edward, ich bin’s, ein uralter Reflex aus deinem Hirnstamm, also dem Dings, das du mit anderem Zeugs zwischen deinen beiden Ohren spazieren trägst, ein Relikt aus der Zeit, als es noch keine Kühlschränke gab und deine Vorfahren sich von der Hand in den Mund ernährten und alles Mögliche in sich hineinstopften, darunter auch Sachen wie unreife, saure Früchte, die nicht gut, wenn nicht sogar tödlich für sie gewesen wären, weshalb ich dafür sorgen musste, dass sie den Kram beizeiten wieder ausspuckten und zwar ziemlich schnell wieder ausspuckten, bevor er den Magen erreichen konnte, und dein Vorfahr und womöglich die ganze Affenhorde an einer Kolik zugrunde gegangen wäre. So gesehen, Edward, bin ich einer der Gründe, warum es dich heute überhaupt gibt, weshalb du in einem Flugzeug sitzen kannst, das nach Tokio fliegt, während du mit Salz und Pfeffer gewürzten Tomatensaft trinkst. Denn ich habe schon für dich gedacht, als es dich noch gar nicht gegeben hat. Verstehst Du, Edward? Wobei „gedacht“ vielleicht der falsche Ausdruck ist, denn natürlich denke ich nicht, ich bin ein Reflex, ich funktioniere, ich reagiere auf einen Reiz, einfach so, ein unbewusster Automatismus, den die Vorfahren deiner ehemaligen Affenhorde irgendwann einmal durch Mutation erworben und dann zwangsläufig beibehalten haben, ganz einfach, weil alle deine Vorfahren, die mich nicht hatten, irgendwann an Koliken zugrundgegangen sind, eben weil sie blöd genug waren, unreife Früchte oder andere Ungeniessbarkeiten in sich hineinzustopfen. Und jetzt bin ich immer noch da, ein kleines, fast unscheinbares Zusammenziehen deiner Kaumuskulatur, das von der feinen Säure des Tomatensaftes ausgelöst wurde, aber dennoch hast du deinen Tomatensaft nicht ausgespuckt, hast ihn nicht gegen das ovale Fenster deiner Boeing 707 gekotzt oder schlimmer noch, auf den Schoss deines Sitznachbarn, dessen Aftershave so widerlich riecht. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich zwar immer noch da bin, aber schon lange nicht mehr so mächtig wie zu der Zeit, als ich mit deiner Affenbande unterwegs war. Damals hattest Du beinahe nur mich, Edward, und ein Hirn, gerade mal so leistungsfähig, das es dir dabei half, nicht permanent gegen den nächsten Baum zu rennen und das ansonsten dafür zuständig war, Insekten, Würmer und Früchte zu identifizieren, damit du diese in dich hineinstopfen konntest. Und jetzt sieh dich an, jetzt sitzt du in dem modernsten Düsenjet deiner Zeit, den andere für dich entworfen, geplant und gebaut haben. Jetzt bist du nicht mehr nackt wie damals in der Savanne, sondern trägst einen einigermassen stilvollen aber massgefertigten Anzug, den du in der Savile Row gekauft hast. Du trinkst einen Tomatensaft, ohne eigentlich zu wissen, wie man Tomaten anbaut, aufzieht und zu Tomatensaft verarbeitet. Du würzt ihn mit Salz und Pfeffer, welche extra zu diesem Zweck von anderen aus irgendwelchen entlegenen Weltgegenden herangeschafft wurden. Es ist ein unglaublich langer Weg von der Savanne bis in den Passagiersitz einer Boeing 707. Findest Du nicht, Edward? Nur mit deinem Hirnstamm und ein paar Reflexen hättest du es unmöglich bis hierher geschafft. Dafür braucht es schon mehr. Viel mehr. Und dieses „Viel mehr“ trägst du ausserdem noch zwischen deinen Ohren spazieren. Es sind die entwicklungsgeschichtlich jüngeren Hirnregionen, welche sich nach und nach während der Evolution ausgebildet haben, bis sie endlich so leistungsfähig wurden, dass sie in der Lage waren, Rolls Royce Düsentriebwerke zu entwerfen und auch zu bauen. Aber natürlich ist das nur die halbe Wahrheit, denn damals in Savanne begann dein Tag immer gleich, ein immer gleiches Knurren im Magen, das dich zuverlässig am Morgen von deinem Baum herunter trieb, um nach Insekten, Würmern und Früchten zu suchen. Denn genau das hast du damals den lieben langen Tag gemacht, Insekten, Würmer und Früchte aufgesammelt, um diese in dich hineinzustopfen. Naja, gut, als Chef-Schimpanse hättest du noch ein paar andere, angenehmere Pflichten gehabt. Aber die wenigsten von euch damals waren Chef-Schimpansen, die allermeisten verbrachten ihre Tage damit, irgendetwas Essbares aufzutreiben, um es in sich hineinzustopfen, einfach nur um zu überleben. Jeden Tag das immer Gleiche, jeden Morgen ein knurrender Magen, danach dann Insekten, Würmer und Früchte, nur um zu überleben. Tage, Wochen, Monate, Jahre, ein Leben lang, bis dich ein gnädiger Säbelzahntiger endlich hinweggerafft hat. Und warum das alles, Edward? Ganz einfach, weil ihr, du und deine Affenhorde, damals noch keine Kühlschränke hattet. Keiner von euch ist jemals mit dem ausserordentlich beruhigenden Gedanken aufgewacht, im Besitz eines vollen Kühlschrankes zu sein. Ein Kühlschrank voll mit Insekten, Würmern und Früchten, die ihr auf Vorrat hättet sammeln können, statt sie sofort in euch hineinzustopfen, bis ihr nicht mehr könnt. Ein voller Kühlschrank hätte euch Zeit geschenkt. Zeit, um mal etwas anderes zu machen als immer nur Insekten, Würmer und Früchte zu sammeln. Aber natürlich hätte euch so ein einzelner Kühlschrank, wenn er denn tatsächlich einfach so vom Himmel gefallen wäre, wenig genutzt. Denn ein Kühlschrank braucht gewisse Vorleistungen oder Bedingungen, die bereitstehen oder erfüllt sein müssen, wie beispielsweise Strom, Kraftwerke, Transformatoren, Kupferkabel, Metallverarbeitung oder Bergbau, damit er funktioniert. Alles Dinge, von denen ihr keinen blassen Schimmer hattet. Damit ein Kühlschrank also funktioniert, habt ihr irgendwann aufhören müssen, immerfort das Gleiche zu machen, denn das führt ja zu nichts. Ihr musstet anfangen, die Dinge anders zu machen, damit nicht jeder Tag wieder bei Null, wieder mit einem knurrenden Magen beginnt, sondern mit einem Fortschritt, einer Errungenschaft von gestern, auf welcher ein weiterer Fortschritt im Heute und dann noch ein weiterer Fortschritt im Morgen aufbauen konnten, bis dann nach einer Reihe von unglaublich vielen Fortschritten und Errungenschaften endlich auch so ein Kühlschrank funktioniert. Auch ein Rolls Royce Triebwerk fällt ja nicht einfach so vom Himmel, es ist eine technische Leistung, die auf der intellektuellen Arbeit von vielen Generationen gründet, und damit nur ein Ausdruck einer kulturellen Evolution, die im Verlauf der letzten 80.000 Jahre immer mehr an Geschwindigkeit aufgenommen hat. Und deshalb schaffe ich es auch nicht mehr, dass du deinen Tomatensaft ausspuckst, ich hatte diese Gewalt über dich, als du ein Affe oder noch ein Säugling warst, aber jetzt habe ich sie nicht mehr, Edward, denn in der Zwischenzeit hast du gelernt. Du weisst jetzt, dass du den Tomatensaft trinken kannst, obwohl er sauer ist. Deine Kultur hat dich gelehrt, Dinge zu geniessen, vor denen deine Natur dich bewahren will. Wenn du also heute morgens zu deinem Kühlschrank schlurfst, Edward, weil dir der Magen knurrt, wird dieses Heute niemals mehr gleich sein mit dem Gestern oder dem Morgen, ganz einfach weil jeden Tag irgendjemand irgendwo die Dinge irgendwie anders gemacht hat, was die Welt morgen für immer verändern wird… Edward?
Aber Edward Turner hat die Augen geschlossen, er hört nicht auf seinen geschwätzigen Gustofazialen Reflex, er nimmt einen weiteren kleinen Schluck Tomatensaft, den sein Gustofazialer Reflex jetzt umkommentiert den Rachen hinunter passieren lässt. Er spürt die Aromen von reifer Tomatenfrucht, Salz, Pfeffer – vielleicht ein bisschen zu viel Pfeffer? – und eine milde Säure an sein Bewusstsein pochen, wo sie sich schliesslich mit den flüchtigen Duftspuren eines widerlichen Aftershaves, dem Dröhnen von vier mächtigen Rolls Royce Triebwerken, den seltsamen und langsam anschwellenden tumultartigen Geräuschen aus Richtung der First Class vor ihm, den durch ein typisches englisches Frühstück verursachten Blähungen in ihm und langsam aufsteigenden Tomatensaft-Erinnerungen zu einer unablässigen Kette von Jetzts verdichten, die sein Bewusstsein fast gleichzeitig durch ein Räderwerk von Gedanken schickt und somit gehorsam und strukturgebend Jetzt für Jetzt abstempelt. Jaaaah, der Tomatensaft. Wie hiess er noch gleich? Mmmmh… Jack… Oder? Nee, Jason? John? Wyatt! Er hiess Wyatt! Wahrscheinlich heissen die im Wilden Westen alle Wyatt. Wegen Wyatt Earp, Doc Holiday und der Schiesserei beim OK Coral. Herrjeh, war das eine Kante von einem Mann. Bestimmt zwei Meter gross, wenns reicht. Wenn er kleiner gewesen wär, hätter seinen riesigen Cowboyhut nicht die ganze Zeit auf lassen können. So aber ragte die Krempe von dem Ding bequem über die Sitzlehne. Und Hände so gross wie Mülleimerdeckel. Und dann dieses winzige Glas Tomatensaft in seiner linken Pranke, während er mit nem kleinen Rührstab zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Pranke Salz und Pfeffer einrührte, fast so, als sei das Ding ne Stecknadel. Und dann? Was hatter gesagt? Hey, Englishman, weissu, warum alle Welt Tomatensaft im Flieger trinkt, äh? Hab ihn erst gar nicht verstanden mit seinem texanischen Kauderwelsch. Tomatensaft im Flieger? Nein, weissichnich, ich trinke selbst nie Tomatensaft, aber ich nehme an, sie werdens mir bestimmt gleich sagen. Na, habs neulich innem Magazin gelesen, da wolln son paar Eierköppe von irgendner Universität herausgefunden ham, dass es wegen dem geringeren Luftdruck hier im Flugzeug is, verstehste? Angeblich isses dann so, dass hier oben die fruchtige Süsse vom Tomatensaft besser geschmeckt werden kann als unten auffem Boden, da schmeckt der Tomatensaft eher muffig, sagen sie, weissu? Alles ne Frage des Luftdrucks, verstehste? Interessant… Interessant? Das is nicht interessant, das is Bullshit! Ooh, meinen sie? Ja, mein ich. Bullshit! Denn woher solln die fliegenden Tomatensaftanhänger denn gewusst haben, dass der muffige Tomatensaft hier oben ganz dufte schmeckt, bevor die Eierköppe von der Universität das untersucht und in die Welt hinausposaunt haben? Ich mein, wenn die Leute den Geschmack vom Tomatensaft auffem Boden unten kannten, und da schmeckte er muffig, warum hamse ihn dann hier oben getrunken, äh? Ich mein, woher wussten die das, dass der hier oben so wahnsinnig fruchtig und lecker sein soll? Gabs vielleicht so ne Art Geheimwissen der fliegenden Tomatensaft-Bruderschaft, das neuen Mitgliedern nur sehr widerwillig offenbart wurde? Also so nach dem Motto: OK, Bud, du bist jetzt endlich auch Mitglied unserer supergeheimen Tomatensaft-Bruderschaft und jetzt können wirs dir ja sagen, du musst im Flieger unbedingt Tomatensaft trinken, weil der is hier oben so wunderbar fruchtig lecker, verstehste? Und Bud trinkt dann Tomatensaft im Flieger und is ganz hin und weg von der fruchtigen Süsse vom Tomatensaft und trifft n paar Tage später sein Kumpel Jack und der erzählt ihm, dasser demnächst mit seiner Alten und den Blagen nach Hawaii innen Urlaub fliegt, und da sagt Bud zu ihm, pass auf, Jack, dann musste im Flieger unbedingt Tomatensaft trinken, weil der is da oben so fruchtig lecker, aber sags bloss niemanden weiter? Was Jack aber trotzdem macht und dann alle machen, bis alle Welt im Flieger Tomatensaft trinkt, weil sie alle wissen, dass der hier oben so unglaublich fruchtig lecker sein soll? Im Ernst? Und warum überhaupt dieser Tomatensaft? Warum nich Orangensaft, Traubensaft, Wein oder irgendein anderer Drink? Warum also ausgerechnet dieser gottverdammte Tomatensaft, äh? Ich mein, andere Drinks haben doch vielleicht noch viel mehr fruchtige leckere Süsse, die hier oben sehr viel besser schmeckt als unten auffem Boden? Oder nicht? Das ist zu vermuten. Das ist zu vermuten? Ich werde Dir sagen, warum alle Welt im Flieger Tomatensaft trinkt. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Kannste auch sein, Englishman, alle Welt trinkt im Flieger Tomatensaft, weil kaum einer unten auffem Boden Tomatensaft trinkt. Das verstehe ich jetzt nicht. Jessas, das versteht er jetzt nich, der Englishman! Trinkst du unten auffem Boden Tomatensaft? Nein, ich trinke eigentlich nie Tomatensaft. Kennst Du jemanden, der unten auffem Boden Tomatensaft trinkt? Also, wenn ich es mir recht überlege, eigentlich nicht. Siehste! Und ich wette, wenn du jemanden kennen würdest, der unten auffem Boden tatsächlich Tomatensaft trinkt, dann wärs dir sofort eingefallen, weils nämlich ziemlich selten is, dass unten auffem Boden jemand so behämmert is und ein Glas gottverdammten Tomatensaft bestellt. Ja und..? Ich merk schon, du raffst es nicht, Englishman. Aber gut. Bissu verheiratet? Ja. Okay, dann stell dir ma vor, deine Frau hat ihren Bruder zu euch eingeladen, deinen lieben Schwager, den du überhaupt nicht leiden kannst, kriegst schon Pickel, wennde nur an den denkst, okay? Und natürlich will Schatzi, dass du alle, also Schatzi, ihren Arschlochbruder und seine minderbemittelte Frau, abends ausführst. Also nimmst du sie alle mit in dein’ Countryclub. Und da sitzt ihr schön gemütlich am Tisch und dann kommt die Kellnerin und will schon ma wissen, was ihr so trinken wollt und da bestellst du einen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer. Einen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer? Ja, gell, ist doch merkwürdig: Einen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer, wo du doch sonst nie Tomatensaft mit Salz und Pfeffer bestellst und auch sonst fast niemand Tomatensaft mit Salz und Pfeffer bestellt. Und genau das denkt sich auch dein Arschlochschwager, der dich vielleicht noch viel weniger leiden kann als du ihn. Er denkt sich also: Warum bestellt sich mein Arschlochschwager einen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer? Is doch merkwürdig! Was soll denn der Schreiss? Und genau das würd’ er sich nicht denken, wenn du n Glas Orangensaft oder n Weisswein oder irgendeinen anderen gewöhnlichen Drink bestellt hättest. Denn das wär ja normal, verstehste? Beim Tomatensaft denkt er sich das aber, weil der is eben nich normal, weissu? Also hatter jetzt zwei Möglichkeiten, entweder er wird dumm sterben oder er fragt dich eben, warum du n Glas Tomatensaft mit Salz und Pfeffer bestellt hast, wo er dich doch noch nie seit er dich kennt ein Glas Tomatensaft hat trinken sehen, verstehste? Somit is die Wahrscheinlichkeit ziemlich gross, dass er zu dir sagen wird: Sag mal, Englisma… äh… wie heissen du eigentlich? Turner, Edward Turner. Nett, dich kennenzulernen. Wyatt! Also, dasser zu dir sagen wird: Sag mal, Eddy, warum… Edward! …warum hast du’n Glas Tomatensaft mit Salz und Pfeffer bestellt? Wusste gar nicht, dass du das magst. Oder so ähnlich. Tja, und wenn er das gesagt hat, dann haste ihn, verstehste? Dann kannste dich nämlich zurücklehnen auf deim Stuhl in deim gemütlichen Countryclub, deinen Arschlochschwager leicht erstaunt anschauen und sagen: Ooooch, stimmt schon, ich hab mir eigentlich nie was aus Tomatensaft gemacht, aber neulich auf meim letzten Interkontinentalflug nach Paris hab ich gehört, wie sich jemand n Tomatensaft bestellt hat, und da dachte ich mir, Mööönsch, warum bestellste dir nich auch einen. Und ich muss sagen, der schmeckte gar nich ma soo schlecht. Mehr musste gar nicht sagen, das reicht schon, weil nämlich du weisst und auch dein Arschlochschwager weiss, dasser sich niemals einen Interkontinentalflug nach Paris wird leisten können, weil er schon froh sein darf, wenners überhaupt auf den Campingplatz am Lake Tahoe schafft, verstehste? Es is der Tomatensaft, der zum Symbol geworden is für diese neue Welt der Jets und Interkontinentalflüge, Eddy. Und der die Welt jetzt teilt in fliegende Tomatensafttrinker und nichtfliegende Nicht-Tomatensafttrinker. Und zwar mit Salz und Pfeffer. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ausgerechnet dieser behämmerte Tomatensaft zu soner Art Unterscheidungsmerkmal geworden ist, weil den kippt man nicht einfach so weg wie n Bourbon oder ne Coke. Nee, n Tomatensaft muss man erst vorbereiten, mit dem Salz und dem Pfeffer und dem Rührstab, der den ganzen Drink dann erst trinkfertig zusammenrührt. Immer das Gleiche: Salz und Pfeffer einstreuen und dann mit diesem Stab alles gleichmässig verrühren. Das immer gleiche Ritual, Eddy, fast so ne Art Beschwörung, die anfangs nur von einigen, aber dann von immer mehr Menschen als ne Möglichkeit verstanden worden is, sich besonders zu machen, verstehste? Ich mein, irgendjemand hat ja mal mit diesem Scheiss angefangen und sich auf einem Flug n Tomatensaft bestellt. Andere habens dann gesehen und einfach nachgemacht, weil Menschen numa anfällig sind für Rituale. Das Tomatensaft-Vaterunser der modernen Passagierluftfahrt, mit welchem sich die fliegenden Tomatensafttrinker stillschweigend und trotzdem gegenseitig einvernehmlich der Zugehörigkeit zu einer ziemlich elitären Kaste versichern. Und zwar die der Interkontinentalflieger. Möge ihnen der Lake Tahoe für immer erspart bleiben! Möge ihnen der Lake Tahoe für immer erspart bleiben… Selten so einen Quatsch gehört… Dachte ich jedenfalls damals. Das Tomatensaft-Vaterunser der fliegenden Tomatensafttrinker. Hallelujah! Sind aber tatsächlich im Laufe der letzten Jahre immer mehr geworden. Immer mehr. Und ich bin jetzt einer davon. Einer davon…
Was ist das?
Edward Turner öffnet die Augen.
Herrgott, was ist da vorne los? Ein Notfall? Herzinfarkt? Ein hysterisches Schreien? Aber nein…
Ein Lachen?
Ein Lachen!
Aber…
Lacht so ein Mensch?

Während Edward Turner seinen Tomatensafterinnerungen nachhing, hatte sich in der First Class zwischenzeitlich so eine Art – wie nennt man das eigentlich? – Tumult entwickelt. Und dieser Tumult fand natürlich seinen Ursprung in der etwas angespannten Geistesverfassung eines gewissen Clifford Richard, der, angesprochen von „C“-Lady Carol Webb, zunächst in deren wasserblaue Augen geschaut hatte, um sodann seinen Blick so ungefähr 5 Grad tiefer zu senken, woraufhin dann – genau! – , was dann wiederum fast augenblicklich eine unsägliche und unerbittliche Geistesmechanik in Mr. Richard in Gang setzte, für die der arme Tropf echt nix konnte, da sie ausschliesslich krankheitsbedingt war, wenn auch durch Flugangst und den Genuss alkoholischer Getränke etwas verstärkt und letztlich durch den visuellen Reiz eines apricotfarbenen Büstenhalters ausgelöst, der gewissermassen den Abzug betätigte, sodass es im in Auflösung begriffenen Hirn des ehrenwerten Geschäftsführers eines britischen Landmaschinenherstellers „KLICK“ machte, der zerebrale Verschluss entspannt wurde, wodurch er nach vorne flitzte, eine erste dämliche und schlüpfrige Witzpatrone aus dem gut gefüllten Patronengurt in das Patronenlager schob, wo sie –
BÄNG!
durch den rasenden Schlagbolzen gezündet und verbal abgefeuert wurde. Nun mag so eine abgefeuerte dämliche und schlüpfrige Witzpatrone in proletarisch oder bäuerlich geprägten Milieus wie dem der Landmaschinenhersteller, Landmaschinenbenutzer und Landmaschinenkäufer durchaus für eine gewisse Erheiterung sorgen, im durch die britische Upperclass geprägten Milieu der First Class an Bord einer Boeing 707 der BOAC im Jahre 1960 war so eine abgefeuerte dämliche und schlüpfrige Witzpatrone jedoch ungefähr so fehl am Platze wie eine Stripteasetänzerin bei einem Kloster-Konvent, was aber den guten Clifford Richard überhaupt nicht juckte, denn während seine Sitznachbarn noch stumm damit beschäftigt waren, zu begreifen, was sie soeben vernommen hatten, und „C“-Lady Carol Webb gerade noch ein entgeistertes „Sir..?“ stammeln konnte, hatte Mr. Richards beinahe endloser Patronengurt für dämliche schlüpfrige Witze bereits die zweite Patrone am Start, die ein sausender Schlagbolzen –
BÄNG!
zündete und verbal in ein stummes Erstaunen abfeuerte, woraufhin Richards dritte Patrone – die mit den vier Nonnen, dem Pfarrer und dem Weihwasser – Sie wissen schon! – sofort im Anschluss in das Patronenlager einrückte und –
BÄNG!
sogleich vom Schlagbolzen erwischt ihren Weg ins Freie fand, wo das stumme Erstaunen zunehmend einem grummelnden Empören wich, demgegenüber sich bei Mr. Clifford Richard, dem Geschäftsführer einer britischen Landmaschinenfabrik, so etwas wie eine ungemein befreiende, wenn nicht sogar seligmachende Entspannung ankündigte, da nun Morbus Pick mehr und mehr von ihm Besitz ergriff und so beflügelt durch eine ordentliche Menge besten schottischen Whiskeys die Flugangst, welche schon seit Tagen auf ihm gelastet hatte und die in den letzten Stunden und Minuten vor dem Betreten der Boeing 707 der BOAC zunehmend unerträglich geworden war, in einer beinahe nihilistischen Heiterkeit auflöste, da alle nervliche Marter, alle bedrückende Last, alle erstickende Pein endlich endlich und befreiend von ihm abfielen. Mr. Clifford Richard fing an zu lachen, anfänglich kichernd, dann prustend, erklomm seine Heiterkeit nach jeder weiteren dämlichen schlüpfrigen Witzpatrone –
BÄNG!
ziemlich
BÄNG!
schnell
BÄNG!
beinahe
BÄNG!
schon
BÄNG!
ekstatische
BÄNG!
Höhen.
Mr. Clifford Richard, dem ehrenwerten Geschäftsführer eines britischen Landmaschinenherstellers, eröffnete sich gewissermassen eine neue Bewusstseinsstufe oder auch – naja – eine neue Dimension des mentalen Seins, die ihm bis dahin gänzlich unbekannt gewesen war. Tja – und das hatte natürlich etwas mit seiner zerebralen Erkrankung und der für ihm ziemlich ungewohnten Menge schottischen Whiskeys, aber in erster Linie mit der durch einen apricotfarbenen Büstenhalter vertriebenen Flugangst zu tun, die diesem anschwellenden Rausch der Glückseligkeit wich, welche nun mit jeder abgefeuerten schlüpfrigen Witzpatrone verstärkt wurde, da jede weitere
BÄNG!
eine weitere Dosis körpereigenes Endorphin freisetzte, bis des Geschäftsführers durch Krankheit in Zersetzung befindliches Hirn in einem äusserst anregenden Cocktail aus Alkohol und Endorphinen förmlich hin- und her schwappte. Kein Zweifel, Mr. Clifford Richard hatte an Bord einer Boeing 707 der BOAC, die im Jahre 1960 auf ihrem Flug von London nach Tokio schon bald den Nordpol überfliegen sollte, einen wahrhaft
BÄNG!
himmlischen Spass. Aber wie das nunmal so ist, können eben nicht nur die Geschmäcker, sondern auch die Vorstellungen über Humor grundverschieden sein oder anders ausgedrückt: Nicht alle finden Alles gleich witzig oder wieder anders ausgedrückt: Fand eigentlich nur Mr. Clifford Richard seine in unablässiger Folge abgefeuerten schlüpfrigen und dämlichen Witzpatronen witzig. Alle anderen Passagiere der First fanden sie nicht so witzig, wobei „nicht so witzig“ die mittlerweile entstandene Situation in der First an Bord einer Boeing 707 der BOAC auf dem Flug nach Tokio im Jahre 1960 nur sehr unzureichend beschreibt, denn eigentlich herrschte in den Gemütern von Mr. Richards Mitpassagieren, welche dieser unaufhörlich mit dämlichen schlüpfrigen Witzen bedachte, bereits blankes Entsetzen vor. So wie bei Lady Emma Wallace beispielsweise, einer sehr mittelalten Dame der Londoner Society, die zusammen mit ihrem Ehemann, Sir Richard Wallace, auf dem Weg zu einem Empfang der Britischen Botschaft in Tokio war, wobei dieser Empfang eigentlich nur der vordergründige Anlass der Reise war, der hintergründige hatte etwas mit der Funktion oder der Aufgabe ihres Ehemannes zu tun. Sir Richard Wallace, der ehemalige Second Lieutenant der 9th Gorkha Rifles, einem Regiment der 11th Indian Infantry Division der britischen Kolonialarmee, der seinerzeit, Anfang 1942, nach dem Fall von Singapur mit 80.000 Kameraden in japanische Kriegsgefangenschaft geraten war und diese grösstenteils im berüchtigten Kriegsgefangenenlager Changi auf Singapur verbringen musste, hatte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den Militärdienst im Rang eines Majors quittiert und einen anderen Weg eingeschlagen, Ihrer Majestät zu dienen. Inzwischen hatte er es auf diesem Weg zum Minister of State im Secretary of State for War gebracht, war also so etwas wie ein Staatssekretär im Kriegsministerium Ihrer Majestät, und aufgrund seiner einschlägigen Kriegserfahrungen im Ministerium mit den Entwicklungen im südostasiatischen und ostasiatischen Raum befasst. Und weil diese Entwicklungen in den letzten Jahren stark an Dynamik gewonnen hatten, 1953 endete der Koreakrieg mit der Teilung der Halbinsel in Nord- und Südkorea, 1954 endete der Indochinakrieg mit der Niederlage Frankreichs und der Aufteilung Indochinas in verschiedene Staaten, was dann einen Bürgerkrieg in Südvietnam zur Folge hatte, der sich Anfang 1960 erstmals gefährlich zuspitzte, und in dem sich das kommunistische Nordvietnam auf Seiten der südvietnamesischen Rebellen mehr und mehr engagieren sollte. Damit noch nicht genug, sog ausgerechnet Mao Tsetongs China Honig aus diesen kriegerischen Konflikten, indem es als Unterstützer der revolutionären Bewegungen und kommunistischen Regierungen im südost- und ostasiatischem Raum seinen Einfluss im kommunistischen Block auszuweiten wusste und schnell so viel an Bedeutung gewann, dass es den alleinigen kommunistischen Führungsanspruch der Sowjetunion in Frage stellen konnte, was man in selbstredend Moskau argwöhnisch beobachtete. Die Lage war also nicht nur dynamisch, sondern auch zunehmend prekärer, weshalb es ein gewisser John Profumo, der neue Kriegsminister Ihrer Majestät, der erst Mitte 1960 im Zuge einer Kabinettsumbildung von Premierminister Harold Macmillan ins Amt gekommen war, für ratsam hielt, seinen Minister of State Sir Richard Wallace nach Japan zu entsenden, um sich nicht nur mit dem britischen Militärattaché Colonel J G Figgess, der für gewöhnlich in der Region bestens vernetzt war, zu besprechen, sondern auch der japanischen Regierung auf den Zahn zu fühlen, die auf Druck der Amerikaner seit 1954 wieder eine Armee, die sogenannten Selbstverteidigungskräfte, unterhielten, ob denn die 1954 von der US-Administration unter Präsident Dwight D. Eisenhower ersonnene Domino-Theorie, wonach ein kommunistisch gesonnenes Land nach und nach auch alle anderen Länder in der Nachbarschaft anstecken und ebenfalls kommunistisch werden lassen würde, ganz so wie ein faulender Apfel, der hineingeworfen in einen Korb voller gesunder Äpfel, auch diese nach und nach verderben müsse, Gefahr lief, in Südost- und Ostasien und ursprünglich ausgehend von China Realität zu werden. Denn, so hatte John Profumo in London messerscharf gefolgert, müssten doch gerade die Japaner ein tiefergehendes Verständnis für die verschiedenen südost- und ostasiatischen Völker, deren Mentalitäten und Beziehungen untereinander haben, schliesslich hatten sie die ganze Region doch noch vor wenigen Jahren militärisch besetzt und unterjocht oder sonstwie unter ihren Einfluss gebracht. Was das damalige Verständnis der Japaner für fremde und von ihnen eroberte Kulturen anging, war Sir Richard Wallace nicht zuletzt aus eigenen Erfahrungen zwar gänzlich anderer Ansicht als sein Minister, denn schliesslich und endlich hatten die Japaner seiner Meinung nach den Zweiten Weltkrieg auch deshalb verloren, weil sie eben Null Verständnis für fremde und von ihnen eroberte Kulturen gezeigt und sie deshalb immer nur ihrem brutalen und immer gleichen Regime unterworfen hatten. Sir Richard Wallace versprach sich demnach wenig Erhellendes von den Gesprächen mit den Vertretern der japanischen Regierung, dennoch war der Minister of State Ihrer Majestät dankbar für diese Gelegenheit einer Dienstreise nach Tokio und das aus zweierlei Gründen. Zum einen bot sie ihm so etwas wie eine späte Genugtuung, da Sir Richard Wallace nach der schmachvollen Niederlage der britischen Armee auf Singapur den Rest des Krieges in japanischer Gefangenschaft verbringen musste, aus der er und seine Mitgefangenen erst im September 1945 befreit werden konnten. Dreieinhalb Jahre, in denen seine militärische Karriere erzwungenermassen ruhte, zumal in Kriegszeiten, die fähigen Offizieren schnellere Aufstiegschancen als im Frieden versprachen, was Sir Richard Wallace nach seiner Befreiung schmerzlich feststellen musste, da fast alle ehemaligen und überlebenden Kadetten seines Jahrgangs an der Royal Military Academy ihn auf der militärischen Karriereleiter deutlich überholt hatten und ihm nun vorgesetzt waren, was der vielleicht ausschlaggebende Grund dafür war, dass Sir Wallace den aktiven militärischen Dienst quittierte und in das Kriegsministerium wechselte, welches ihn nun im Rang eines Minister of State nach Japan entsandt hatte, um der Regierung jenes Landes, das ihn dreieinhalb Jahre gefangen gehalten hatte, dann aber ohne sein Zutun militärisch geschlagen worden war, in Sachen „Domino-Theorie“ als ranghoher Vertreter einer Nation, die den Krieg gewonnen hatte, auf den Zahn zu fühlen. Und zum anderen bot der gesellschaftliche Aspekt seiner Reise, der Botschaftsempfang, die Gelegenheit, dass seine Frau Emma ihn auf dieser seiner Dienstreise begleiten durfte, die für gewöhnlich sehr dankbar dafür war, sich auf offiziellen Anlässen wie Botschaftsempfängen, Festbällen oder Banketts präsentieren zu können, wenn auch ihre einst beinahe sprichwörtliche Schönheit sich bereits im Verblühen befand. Und jetzt, nachdem wir also Sir Richard Wallace und Lady Emma Wallace hier in diese Geschichte hinein erfunden haben, denn in echt gab’s die ja nie, wenn es auch selbstredend einen Edward Turner in echt gegeben hat, der auch ganz wirklich im Jahre 1960 vielleicht mit der BOAC in vielleicht einer Boeing 707 von sehr wahrscheinlich London Heathrow und bestimmt nicht über den Nordpol nach Japan geflogen ist, könnten wir jetzt auch bezüglich Lady Emma n bisschen was erfinden, von wegen Quote und so, denn bei ihrem Mann haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, haben ihn zum Kriegshelden gemacht, zum Major, zum Kriegsgefangenen und schliesslich auch noch zum Minister of State ihrer Majestät befördert, der sich auf Weisung des Kriegsministers John Profumo höchstpersönlich auf einer wichtigen Mission befindet, um sich sowohl mit dem britischen Militärattaché der britischen Botschaft in Tokio Colonel J G Figgess, den es in echt gegeben hat, als auch mit der japanischen Regierung, die es auch in echt gegeben hat, über die „Domino-Theorie“ der Eisenhower-Administration auszutauschen, während seine Frau in dieser Geschichte bisher nur blöd rumsitzt und sich auf ihr Ballkleidchen freut. Wir könnten also ein bisschen netter sein zu Lady Emma, finden Sie nicht? Wir könnten sie beispielsweise in eine angesehene Familie hinein erfinden, vielleicht als Tochter von Sir Henry Randolph und Lady Edith Caroline Trafford, die zusammen mit ihren zwei jüngeren Brüdern, Thomas Theodore und Henry Randolph Junior, in einem begüterten Haushalt aufwuchs, da ihr Vater als Manager einer ceylonesischen Teeplantage ein kleines Vermögen erwirtschaftet hatte, welches er nach seiner Rückkehr nach London an der Börse noch beträchtlich zu mehren wusste, sodass er es sich leisten konnte, seine drei Kinder an gesehenen Eliteschulen unterzubringen. Die junge Emma Caroline Trafford könnte so das Mädchenpensionat Wycombe Abbey in High Wycombe, Buckinghamshire, besucht haben, schon damals eines der angesehensten Mädcheninternate des Vereinigten Königreichs, welches ganz im Geiste der Gründerin Miss Frances Dove seine Zöglinge zu wertvollen Mitgliedern der britischen Gesellschaft heranzuziehen gedenkt und gedachte, die somit nach ihrem Abschluss über einen gesunden Gemeinschaftssinn, Tugendhaftigkeit, Sinn für Disziplin, weite Interessen als auch über das, was Miss Frances Dove „Esprit de Corps“ nannte, und was man wohl als „Standesbewusstsein“ übersetzen könnte, verfügen sollten. Kurzum, hätten wir Lady Emma auf diesem Wege eine mehr als nur solide Grundausbildung für höhere Töchter der britischen Elite verpassen können, die sie in die Lage versetzen würde, die ehelichen, mütterlichen als auch gesellschaftlichen Pflichten, deren Erfüllung die damalige britische Elite von ihren weiblichen Mitglieder für gewöhnlich einforderte, nämlich einen ziemlich opulenten Haushalt zu führen, die Dienstboten zu schikanieren, dem Ehemann eine kultivierte Partnerin und Ratgeberin zu sein, die richtigen Nannys, Schulen und Universitäten für die Nachkommen auszusuchen, geistreiche Bemerkungen auf Dinnerpartys zu machen und natürlich die Pflege und wenn möglich auch die Mehrung des gesellschaftlichen Ansehens des eigenen Hauses – was man eben als anerkanntes, wertvolles und weibliches Mitglied der obersten britischen Stände nach Ansicht von Miss Frances Dove so zu tun hatte – mehr als nur zu bestehen. Und weil das alles vielleicht ein wenig zu glatt wäre, könnten wir ein bisschen Drama in Lady Emmas doch ansonsten vielleicht ziemlich fade Backfischjahre hinein erfinden. Wir könnten Harry erfinden. Oder George. Oder wie auch immer er heisst. Und Harry oder George übernimmt die Rolle der grossen Liebe von Lady Emma. Dazu ist Harry natürlich der Traum aller Frauen, wobei sich jede Frau und selbstverständlich auch jeder Mann, die/der diese Zeilen liest, sich IHREN/SEINEN Harry natürlich so vorstellen darf, wie es ihr/ihm beliebt. Harry kann also gross, klein, dick, dünn, muskulös, blond, braun, schwarz, gelb, rot undsoweiter sein, und wenns sein muss, auch eine Harriet oder Transgender. Und wo hat Lady Emma ihren Harry kennengelernt? Hm..? Im Reitstall natürlich. Wo denn sonst! Harry war der jugendliche Reitlehrer von Lady Emma als auch der Sohn des Besitzers des Reitstalls, der ausschliesslich Schülerinnen der Wycombe Abbey in der hohen Schule der Reitkunst ausbildete und zudem auch noch über ausgedehnte Ländereien und Besitzungen verfügte, was Harry gewissermassen zu einer standesgemässen Partie werden lässt. Allerdings wissen wir ja bereits, dass Lady Emma nicht Harry, sondern Richard geehelicht hat, weswegen wir Harry jetzt wieder irgendwie Verschwindenlassen müssen, was aber eingangs des Zweiten Weltkriegs nicht so wahnsinnig schwierig ist, also lassen wir Harry einfach zum Militär einziehen und mitsamt der British Expeditionary Force nach Frankreich übersetzen, wo er auch in der Schlacht von Dünkrichen heldenhaft gegen die Deutschen kämpft, bevor er mit dem letzten britischen Fischkutter, der in Dünkirchen ablegt, evakuiert werden kann, wobei der Fischkutter dann blöderweise aufgrund eines defekten Seeventils im Ärmelkanal versinkt und Harry mit in die Tiefe reisst. Lady Emma wäre selbstredend zu Tode betrübt gewesen ob diesen schweren Verlustes und meldet sich daraufhin freiwillig zum Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service (QAIMNS), dem Korps der Krankenschwestern in der britischen Armee, um dort hingebungsvoll verwundete Soldaten zu pflegen. Das hilft ihr natürlich nicht wirklich über den Verlust hinweg, auch dann nicht, als nach Ende des Krieges ein gewisser Richard Wallace auf ihrer Station aufgenommen wird, der seine in japanischer Kriegsgefangenenschaft erworbene Tuberkulose auskurieren muss, was ihm aufgrund des neu entdeckten Penicillins und Lady Emmas hingebungsvoller Pflege auch tatsächlich gelingt. Die beiden lernten sich bei dieser Gelegenheit näher kennen. Sir Richard, libidinös nach Jahren der Gefangenschaft etwas ausgehungert, glaubt schnell, es sei Liebe. Lady Emma weiss sofort, es wird nie viel mehr als Respekt, und ist ausserdem klug genug für die Erkenntnis, dass die für eine Ehe in Frage kommenden Jahrgänge der möglichen Bräutigame kriegsbedingt etwas ausgedünnt waren, weshalb frau besser nicht zu wählerisch sein sollte, vor allem dann nicht, wenn die wirklich wichtigen Faktoren wie Herkunft des Verehrers, Vermögen, Stand und Zukunftschancen stimmten. Und um das alles jetzt noch ein bisschen dramatischer, wenn nicht sogar tragisch zu machen, lassen wir Harry wieder auftreten, denn der is nämlich gar nicht tot.
Nein?!
Doch!
Der Kriegskamerad, der von einem anderen Schiff vor Dünkirchen aus gesehen haben will, wie Harry gerade noch an Bord des letzten britischen Fischkutters, der in Dünkirchen ablegte, sprang, und das dann nach der Ankunft in England seinem Kommandeur berichtete, welcher Harrys Namen daraufhin und nach dem Verlust des Fischkutters auf die Vermisstenliste setzte, hatte sich geirrt. Nicht Harry war an Bord des Kutters gesprungen, sondern ein anderer Soldat, der ihm zum Verwechseln ähnlich war. Harry selbst hatte es nicht mehr zum Hafen geschafft, da er von den Deutschen zuvor gefangengenommen worden war. Harry verbrachte demnach die Kriegsjahre ebenfalls in Gefangenschaft, wenn auch in deutscher Gefangenschaft, genauer hinter den dicken Mauern eines ehemaligen Rittergutes irgendwo im Harz und nicht in einem gewöhnlichen Kriegsgefangenenlager, ein Privileg, das britischen Offizieren und auch Offiziersanwärtern wie Harry von den Deutschen zugestanden wurde. Die Jahre in Gefangenschaft waren eine schwere Zeit für Harry, nicht nur, weil er nicht heroisch gegen die Nazis kämpfen konnte, sondern weil er krank war vor Liebe, denn er verzehrte sich nach seiner Emma, jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, jede Stunde und in einem jeden Atemzug. Harry hatte solche Sehnsucht nach seiner Emma, dass er gegen Kriegsende, zwei Wochen nur, bevor die siegreichen alliierten Truppen ihn und die anderen Gefangenen befreien sollten, einen Fluchtversuch unternahm. Hierbei seilte er sich an zusammengeknoteten Bettlaken aus dem Turmzimmer der Burg in die Freiheit hinab, was aber fürchterlich schiefging, da er abstürzte, sich schwer verletzte und ausserdem eine Amnesie erlitt. Das mit der Amnesie haben wir uns ausgedacht, weil wir Zeit brauchen, beziehungsweise weil Richard Zeit braucht, der ja nach Kriegsende wegen seiner Tuberkulose in das Lazarett zu Emma verlegt worden ist, wo er Emma den Hof macht. Sobald Emma Richard erhört und ihre Einwilligung zur Hochzeit gegeben hat, verscheuchen wir auch Harrys Amnesie wieder, er wird gewissermassen von uns wiedererweckt, dieses „Wunder“ müssen wir natürlich ein bisschen rührend verpacken, beispielsweise so: Harry liegt schweissgebadet in seinem Bett im Lazarett, er hat die Augen geschlossen, offensichtlich schläft er, wenn auch sehr unruhig, er wirft den Kopf hin und her, sehr wahrscheinlich hat er einen Alptraum. Natürlich löst eine Amnesie für gewöhnlich kein Fieber aus, es gibt also eigentlich gar keinen Grund, weshalb Harry schweissgebadet sein sollte, das ist uns aber egal, denn schweissgebadet macht sich immer gut. Das ist so schön dramatisch. Dann nestelt einer von Harrys Mitpatienten, er liegt drei Betten weiter, in seiner Hosentasche nach etwas. Hervor zieht er eine Taschenuhr. Offensichtlich möchte er wissen, wie spät es ist. Er klappt deshalb die Taschenuhr auf, und weil es sich um eine Taschenuhr mit Musikspielwerk handelt, ertönt eine zarte Musik, ein kleines einfaches Stück, das zu Herzen geht. Harry scheint diese Musik auch zu hören, er wird ruhiger, er macht die Augen auf und horcht. Er schaut eine kleine Ewigkeit lang in sich hinein. Seine Augen werden schliesslich feucht. Er weint. Er weiss. Er hat verstanden. Der Auslöser dieses Verstehens ist mittelbar die Taschenuhr, aber unmittelbar eigentlich die Musik. Warum das so ist, dürfen wir wieder erfinden. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass Emma Harry die Taschenuhr vor seiner Einschiffung nach Frankreich bei ihrem Abschied am Hafen in Dover geschenkt hat. Es ist die Taschenuhr ihres verstorbenen Grossvaters, der im Ersten Weltkrieg an der Somme gekämpft hat. Die Taschenuhr hat ihm immer Glück gebracht, deshalb hat er sie noch auf dem Totenbett seiner Lieblingsenkelin geschenkt. Harry hat die Taschenuhr am Hafen nicht gleich geöffnet, als Emma sie ihm schenkte, sondern sich in der wenigen Zeit, die ihm noch blieb, bevor er an Bord des Truppentransporters gehen musste, lieber mit einer innigen Umarmung und einem langen Kuss dafür bedankt. Erst an Bord, nachdem er sich an der Reling winkend von Emma verabschiedet hatte, öffnete er die Uhr und hörte die Musik das erste Mal. Das wäre die kompliziertere Version, es geht aber auch einfacher: Wieder Dover. Wieder der Hafen. Herzzerreissender, tränenreicher Abschied. Und die Big Band der britischen Armee spielt genau diese herzergreifende Musik, als Harry dann schliesslich doch an Bord des Truppentransportes muss. Warum eine Big Band der britischen Armee herzergreifende Musik spielen sollte, wenn sich ein Haufen britischer Soldaten auf einem Truppentransporter nach Frankreich einschifft, müssen wir nicht erklären, das ist einfach so. Ausserdem erinnert das irgendwie an Titanic und Titanic funktioniert immer. Sollten wir uns trotzdem für die kompliziertere Musikversion, die mit der Taschenuhr entscheiden, und dafür spricht einiges, können wir noch einen drauf setzen. Denn natürlich trägt Harry von dem Moment an, da seine Emma ihm den Talisman geschenkt hat, diese Taschenuhr in der Brusttasche seiner Uniform und zwar in der linken Brusttasche, damit – genau! – das Geschenk seiner Liebsten ganz nah an seinem Herzen ist. Und bevor Harry gefangengenommen wird, lassen wir ihn noch ein wenig heroisch kämpfen, wobei er von einem Schuss getroffen wird. Seine Kameraden stürzen herbei, finden einen leblosen Harry vor, der aber unvermittelt die Augen aufschlägt, sich instinktiv an die linke Brust fasst, die Uhr aus der Tasche kramt und ja – tatsächlich! – war es die Uhr, welche die Kugel abgefangen und ihm so das Leben gerettet hat. Allerdings ist die Uhr jetzt natürlich kaputt, Harry konnte die Musik seit Jahren in der Gefangenschaft nicht mehr hören, was das „Erweckungserlebnis“ noch ein wenig dramatischer werden lässt. Wie auch immer, Harry ist jetzt wieder in der Spur, er weiss, er muss zu seiner Emma, und da wir nett zu ihm sein wollen, gewähren wir ihm diesen Wunsch, jedoch nur unter Entbehrungen. Also verpassen wir Harry zwei Krücken, womit er zum nächsten Bahnhof humpelt, dort angekommen, lassen wir ihn natürlich nicht im Abteil Platz nehmen. Nein, unser Harry klettert auf einen offenen Güterwagon, weil der Zug hoffnungslos mit Flüchtlingen überfüllt ist. Und natürlich regnet es. Die ganze Zeit über, bis er an der französischen Kanalküste angekommen ist. Den Kanal überquert er an Bord eines Kohlefrachters und den letzten Teil seiner Reise verbringt er auf der Ladefläche eines Armeelastwagens. Und natürlich regnet es. Die ganze Zeit über, bis er endlich an dem Wohnort seiner geliebten Emma irgendwo in Cornwall angekommen ist, gerade noch rechtzeitig, um das Hochzeitsgeläut der viktorianischen Kirche zu vernehmen, während das frischgebackene Brautpaar durch das Kirchenportal – es scheint mittlerweile die Sonne – ins Freie tritt. Und da steht er nun, unser Harry – gestützt auf Krücken, abgerissen, frierend, hungernd, mit tiefen Ringen unter den Augen. Und bricht zusammen. Aber Harry ist gut. Harry ist ein Edelmann. Und obwohl seine grosse Liebe ihn allem Anschein nach verraten und vergessen hat, konfrontiert er sie nicht mit seiner Anwesenheit. Nein, Harry verbirgt sich vor Emma und auch wenn es sehr sehr schmerzhaft für ihn ist, beschliesst er, dem Glück seiner Emma nicht im Weg zu stehen, auch wenn dies bedeuten sollte, dass er auf sie, seine grosse Liebe, verzichten muss. Harry kehrt also zurück zu seiner Familie in den Reitstall. Und dort könnten wir ihn für den Rest seines Lebens belassen, was aber sehr unspannend wäre, weshalb wir unbedingt ein Zusammentreffen von Emma und Harry arrangieren müssen. Dazu gibt es dann wieder verschiedene Möglichkeiten, grob unterteilen könnte man diese Möglichkeiten des Zusammentreffens in „zufällige“ und „nicht so zufällige“ und „zufällige, nicht so zufällige“ Möglichkeiten. „Nicht so zufällige“ Möglichkeiten des Zusammentreffens bezeichnen Arrangements, wonach Emma irgendwie erfährt, dass Harry doch noch am Leben ist und ihn daraufhin aufsucht. Das ist die „platteste“ Variante des arrangierten Zusammentreffens, dramatischer ist dann schon die „zufällige“ Möglichkeit des Zusammentreffens, da beide sich irgendwo rein zufällig über den Weg laufen, wobei dann Emma natürlich aus allen Wolken fällt, als der totgeglaubte Harry auf einmal vor ihr steht. Am allerdramatischsten ist aber die Kombinaten dieser ersten beiden Varianten, das ist dann die „zufällige, nicht so zufällige“ Möglichkeit des Zusammentreffens. Emma trifft Harry zunächst „zufällig“, wobei Harry zum einen aber nicht merkt, dass er Emma zufällig getroffen hat, und zum anderen Emma nicht die Möglichkeit hat, Harry direkt anzusprechen. Das könnte folgendermassen vonstatten gehen: Emma sitzt mit Richard im Fond des familieneigenen Rolls Royce. Beide haben das Royal Ascot Pferderennen besucht, der Chauffeur fährt sie nach Hause, da erblickt Emma draussen in der Menschenmenge Harry. Harry erblickt aber Emma nicht. Und obwohl Emma wie unter Schock steht, weil sie den totgeglaubten Harry erblickt und deshalb emotional total aufgewühlt ist, muss sie sich beherrschen, denn Richard sitzt ja neben ihr. Sie kann also nichts unternehmen, weiss aber jetzt, dass Harry lebt, was zur Folge hat, dass sie jetzt Harry bald „nicht so zufällig“ treffen wird, indem sie ihn aufsucht. Und wo? Hm..? Im Reitstall natürlich. Wo denn sonst! Dort wird es dann also so richtig melodramatisch, beide liegen sich irgendwann schluchzend in den Armen, beide sind wie im Rausch und es kommt natürlich zum Äussersten. Der emotionale Höhenflug währt aber nur kurz, weil beide die Ausweglosigkeit ihrer gesellschaftlichen Situation erkennen müssen. Für Emma, ganz Zögling der Wycombe Abbey, kommt eine Scheidung natürlich nicht Frage, und Harry hat in der Zwischenzeit einer anderen jungen Frau das Eheversprechen gegeben. Aber natürlich – ja, klar – wird alles ganz anders kommen…
So weit also die Grundkonstruktion eines Plots, aus dem man problemlos mindestens drei Netflix-Staffel mit jeweils sechs Folgen herauspressen könnte, denn zur Sicherheit haben wir unsere kleine Schmonzette auch noch in zeitlicher als auch gesellschaftlicher Nähe dessen angesiedelt, was man die „Profumo-Affäre“ nennt. John Profumo? Sie erinnern sich? Richards Chef. Der Kriegsminister Ihrer Majestät, welcher seinerzeit in bestimmten Kreisen verkehrte, die – naja – gewisse erzählerische Anschlussmöglichkeiten eröffnen, da diese Kreise gespickt waren mit jeder Menge junger Dinger und alter Knacker, die sich zudem in prickelndem Ambiente wie beispielsweise dem Murray’s Cabaret Club herumtrieben, in dem einige der jungen Dinger wie beispielsweise Christine Keeler, die gab’s auch in echt, sich zeitweise als äääh Körperkunstdarstellerinnen verdingten, bevor sie von einem illustren Wunderheiler, der bevorzugt die Reichen und Schönen und Hochadligen der britischen Gesellschaft behandelte, an die alten Knacker verkuppelt wurden, was die jungen Dinger aber teilweise nicht davon abhielt, neben diesen ausserehelichen Beziehungen mit verheirateten Männern der britischen High Society noch weitere ausseraussereheliche Beziehungen zu Männern mit weniger gut beleumundeter Herkunft wie sowjetischen Geheimagenten, jamaikanischen Kleinkriminellen und raffgierigen Immobilientycoons zu unterhalten, was dann den guten John Profumo schlussendlich seinen Kriegsminister-Job kosten sollte, womit wir aber noch lange nicht am Ende sind, denn seine Fortsetzung fand dieser Skandal und könnte unsere mittlerweile schon ziemlich lebenspralle Netflix-Schmonzette finden in der Ehescheidung des 11. Duke of Argyll, eines so gut wie mittellosen Trinkers und Spielers, der seine vier Ehefrauen immer nach der Höhe der zu erwartenden Mitgift auszusuchen pflegte, und der keine Hemmungen hatte, dem Scheidungsrichter zum Zwecke der Trennung von seiner zweiten Ehefrau neben einer Liste ihrer vermeintlichen Liebhaber, die sage und schreibe 88 Namen umfasste, darunter auch einige sehr prominente, zusätzlich noch eine Serie von 13 Polaroidfotos vorzulegen, auf welchen seine Noch-Ehefrau zu sehen ist, wie sie sich, selbst nur mit einer dreireihigen Perlenkette bekleidet, an einem ebenfalls nackten Herren zu schaffen macht, deren Kopf auf den 4 Fotos, die nacheinander in chronologischer Reihenfolge des abgebildeten Zustands der Erregung handschriftlich mit „before“, „thinking of you“, „during – oh“ und „finished“ beschriftet waren, leider abgeschnitten ist, was dann natürlich zu allerlei Mutmassungen, Verdächtigungen und Tratschereien innerhalb der britischen High Society führen musste, wer denn der Träger dieses abgebildeten primären männlichen Geschlechtsorgans ist, und schliesslich mal wieder in dem Rücktrittsangebot eines Ministers Ihrer Majestät gipfelte, der zudem noch – und jetzt halte man sich bitte fest – der Schwiegersohn von Winston Churchill war.
NEIN?!
DOCH!
DAS ist also das mehr als nur lebenspralle Setting, das wir für Emma, Harry und Richy ausgesucht haben.

Margaret Campbell, Duchess of Argyll. Im schon etwas fortgeschrittenen Lebensalter, aber immer noch stilsicher im getigerten Kleid, mit dreireihiger Perlenkette und einem ihrer geliebten Pudel
Und so ein Kram, zum xten Mal verwurstet, schreibt sich quasi im Automatikmodus wie von selbst. Noch dazu ist er beides: Echt UND politisch korrekt. Denn wir haben alles am Start, einen echten männermordenden Vamp, eine selbstbewusste Frau der 1950er und 1960er Jahre, die sich in dieser angeblich so prüden Zeit herausnahm, was sie wollte, wir müssen ja nicht erwähnen, dass ein Bekannter ihres Vaters gesagt haben soll, ihr Vater habe ihr ein paar bezaubernde Ohrringe gescheckt, aber leider ziemlich wenig dazwischen; dann sind da noch die wechselnden jamaikanischen Liebhaber von Christine Keeler, die sich deswegen natürlich rassistischer Anfeindungen ausgesetzt sah, die wir gleich mit verwursten können, ebenso wie den Umstand, dass Misses Keelers jamaikanische Liebhaber POCs waren, was echt praktisch ist, denn dann brauchen wir die nicht zu erfinden, so wie andere Schreiberlinge sich einen abbrechen müssen, um einen Wikinger-Chef im 9. Jahrhundert skandinavischer Zeitrechnung erst zur Frau und dann auch noch zur POC umzuerfinden. Nee, nee, unser Kram ist echt UND politisch korrekt!
Aber jetzt mal im Ernst… Wen interessiert denn so ein Scheiss?
Eben.
Ausserdem haben wir uns um Clifford Richard zu kümmern, denn der ist, während wir uns diese kleine Abschweifung gegönnt haben, mittlerweile in arger Bedrängnis. Und Bedrängnis meint nicht den Eklat, den dieser Scherzkeks auf ebenso rauschhafte wie unschuldige Weise evoziert hatte, da einige Mitreisende in der First unter dem unaufhörlichen schlüpfrigen Witzbombardement ihre Contenance nach und nach verloren und so ihre erstaunte Zurückhaltung zunächst der Empörung, dann dem Entsetzen und schliesslich der Wut wich, die sie veranlasste, die ganze leidige Angelegenheit nicht mehr nur der BOAC Crew zu überlassen, die in Gestalt von C-Lady Carol Webb ohnehin heillos überfordert wirkte, sondern sich ihrer selbst anzunehmen, was bedeutete, dass sie zunächst einige Ordnungsrufe an den armen Clifford Richard adressierten, ihn zur Mässigung aufriefen, an seine Erziehung appellierten, zur Ruhe und Anstand ermahnten, und als das alles nix nutzte, weil es nichts nutzen konnte, da der arme Clifford Richards bereits jegliche Kontrolle über sich verloren hatte, ihm schliesslich irgendwelche ernsten Konsequenzen androhten. Bedrängnis meint vielmehr die inzwischen eingetretene innere Verfasstheit von Clifford Richards, der Rausch der Glückseligkeit, hervorgerufen durch ein Amalgam aus Alkohol, körpereigenen Glückshormonen und verstärkt durch krankheitsbedingt veränderte Hirnregionen, hatte den Gipfel erreicht, was dazu führte, dass sich Richards Bewusstsein komplett verinnerlichte und die Aussenwelt gleichsam abschaltete. Clifford Richard nahm jetzt nichts mehr ausser sich wahr, er feuerte keine weitere schlüpfrige Witzpatrone mehr ab, er hörte nicht die Ermahnungen und Drohungen seiner Mitpassagiere, sah nicht, dass sich Emma Wallace mit hochrotem Kopf mit beiden Händen die Ohren zuhielt, während sie angestrengt aus dem Fenster schaute und immerzu „La La La La“ in Zimmerlautstärke vor sich hin brabbelte, und spürte auch nicht mehr die Hand einer zunehmend aufgelösten Carol Webb auf seiner Schulter, die ihn beruhigen wollte. Clifford Richard lachte. Er warf den Oberkörper nach vorne und lachte. Er richtete sich wieder im Sitz auf und lachte. Er lachte mit rotem Kopf und geschlossen Augen. Er lachte laut, nur unterbrochen von kurzen pfeifenden Atemzügen. Er lachte mit Inbrunst aus seinem offenen Mund, während sich der Schweiss mit seinen Tränen auf seinen Wangen mischten. Und eigentlich lachte nicht er, sondern das Lachen lachte mit ihm, hatte seinen Körper und seinen Geist ergriffen und schien ihn nicht mehr loslassen zu wollen, es schüttelte den kleinen dicken schwitzenden Mann durch, warf seinen Körper auf dem Sitz hin und her und liess seine Gliedmassen merklich zittern. Clifford Richards Puls raste, die Adern an seinen Schläfen schwollen bedrohlich an, er schwitzte stark, dann aber nach einer Weile erschöpfte er sich zusehends, seine Atemzüge wurden flacher und das Lachen wandelte sich allmählich in ein Stakkato aus Schluchzern. Ein irres, klägliches Schluchzen eines weidwunden Tieres, das beinahe nichts Menschliches mehr an sich hatte. Die Mitreisenden, die ihn eben noch bedrängt hatten, waren inzwischen verstummt, Emma Wallaces „La La La La“ erstarb, C-Lady Carol Webb trat erschrocken einen Schritt zurück, schaute fragend zu Chief Steward James May, der alarmiert durch den Tumult die First aufgesucht hatte, sich nun ein Bild von der Lage zu machen versuchte, wobei die Lage ein kleiner, schluchzender, schwitzender, rotgesichtiger Mann war, der nach mehrmaliger Ansprache durch den Chief Steward James May nicht reagierte. Offensichtlich waren bei Clifford Richards ein paar Synapsen durchgebrannt oder hatte sich alkoholbedingt eine schlüpfrige dämliche Witztpatrone im Verschluss verkantet, sodass Mister Richards sich in einer Art Heiterkeits-Endlosschleife befand, was Chief Steward James May dann schliesslich bewog, die vorgefundene Lage gemäss den Notfallstandards der BOAC als Notfall zu klassifizieren, was bedeutete, dass er gemäss der Handlungsanweisungen der BOAC bezüglich eingetretener Notfälle unverzüglich den Captain in Command Peter Fuller im Cockpit aufzusuchen hatte, um ihn über dessen Eintritt zu informieren. Captain in Command Peter Fuller war der Tumult in der First aufgrund seiner Lautstärke natürlich nicht verborgen geblieben, er hatte sich aber zunächst wie immer bei Zwischenfällen in der Kabine auf seinen erfahrenen Chief Steward verlassen, der ihn nun bitten musste, gemäss der Handlungsanweisung für eingetretene Notfälle der BOAC den eingetretenen Notfall in Augenschein zu nehmen. Captain in Command Peter Fall nahm also den kleinen, schluchzenden, schwitzenden, rotgesichtigen Clifford Richards in Augenschein, sprach ihn mehrmals ohne Reaktion an und entschied dann, dass es wahrscheinlich das Beste wäre, dem schluchzenden Notfall den Stecker zu ziehen und ihn Schlafen zu legen. Um Notfällen den Stecker zu ziehen und sie Schlafen zu legen, bedient man sich an Bord von Passagierflugzeugen bestimmter Beruhigungsmittel, die neben anderen Medikamenten im First Aid Kit mitgeführt werden, heutzutage meistens Lorazepam und/oder Diazepam in Tablettenform oder in Ampullen. Benzodiazepine wie diese kamen aber erst Anfang der 1960er Jahre in Gebrauch, weshalb sich im First Aid Kit der Boeing 707 der BOAC, die 1960 von London Heathrow über den Nordpol nach Tokio flog, noch zwei Ampullen des guten alten Morphins befanden. Alle Crew-Mitglieder hatten natürlich eine Art Notfalltraining absolviert, in welchem sie auch an Puppen die Verabreichung von Injektionen üben mussten. Allerdings erforderte die Verabreichung von Morphin, sollte es schnell wirken, was angesichts eines kleinen, schluchzenden, schwitzenden, rotgesichtigen Notfalls sicher ratsam war, eine intravenöse Injektion statt die einfacher zu verabreichenden intramuskuläre oder subkutane Varianten, deren Wirkung aber erst sehr viel später einsetzen würde. Und wenn auch der Captain in Command an Bord eines Flugzeuges der BOAC alleiniger Inhaber der Bordgewalt war, in dem Sinne, dass ihm das letzte Wort über alle Fragen gebührte, die nur im Mindesten die Sicherheit des Flugzeuges oder der Personen an Bord beeinträchtigen könnten, so schrieben die Handlungsanweisungen der BOAC in diesem konkreten medizinischen Notfall jedoch vor, zunächst in Erfahrung zu bringen, ob sich an Bord zufälligerweise ein Arzt unter den Passagieren befand, oder, falls dies nicht der Fall sein sollte, Funkkontakt mit einem Flughafen aufzunehmen, um für den konkret vorliegenden Fall eine ärztliche Konsultation anzufragen. Captain in Command Peter Fuller nahm also das Mikrofon der Sprechanlage in die Hand und begann seine Durchsage mit: „Hier spricht ihr Kapitän Peter Fuller. Ich bitte um ihre Aufmerksamkeit…“, was er sich eigentlich hätte sparen können, denn er hatte aufgrund des vorgefallenen Tumultes bereits die ungeteilte Aufmerksamkeit sämtlicher Passagiere an Bord, also fuhr er fort: „Wir haben einen medizinischen Notfall, deshalb muss ich sie fragen: Ist ein Arzt an Bord?“ Daraufhin schaute er in die Kabine, ob sich irgendwo ein Arzt durch Handzeichen erkennen geben würde, sah aber nur die allermeisten Passagiere, die ihre Köpfe drehten und wandten, um zu sehen, ob ein Arzt an Bord ist, woraufhin Captain in Command Peter Fuller nochmals in das Mikrofon sprach: „Ich wiederhole meine Frage: Ist ein Arzt an Bord?“. Und jetzt ging tatsächlich eine Hand hoch und ein Passagier, der eine merkwürdige Vorliebe für widerlich riechende Rasierwasser hatte, sagte laut: „Ja. Hier!“. Sichtlich erleichtert sagte Captain Peter Fuller in das Mikrofon der Bordsprechanlage: „Darf ich sie nach vorne zu mir bitten, Sir!“. Also wandte sich der Sitznachbar von Edward Turner aus seinem Sitz und betrat den Gang, um nach vorne in die First zu Captain in Command Peter Fuller und seinem kleinen schluchzenden schwitzenden Notfall zu gehen.
Edward Turner öffnet die Augen.
Herrgott, was ist da vorne los? Ein Notfall? Herzinfarkt? Ein hysterisches Schreien? Aber nein…
Ein Lachen?
Ein Lachen!
Aber…
Lacht so ein Mensch?
Walter Plowright, Edward Turners Sitznachbar, ist inzwischen bei Captain in Command Peter Fuller eingetroffen. Edward Turner beobachtet die beiden, sie sind aber zu weit von ihm entfernt, dass er hören könnte, was sie miteinander besprechen. Natürlich nimmt er an, dass es etwas mit den unheimlichen schluchzenden Lauten zu tun haben müsste, offensichtlich gibt es in der First Class einen Notfall und wahrscheinlich ist sein Sitznachbar, der mit dem widerlichen Rasierwasser, Arzt.
Und das hat Edward Turner gut erraten, was er aber nicht wissen kann, ist, dass Walter Plowright zwar Arzt ist, beileibe jedoch kein Humanmediziner. Walter Plowright ist Tierarzt. Und eben das teilt er gerade dem verdutzten Captain in Command Peter Fuller mit, auch um sich zu entschuldigen, dass er sich nicht auf die erste Aufforderung des Captains gemeldet habe, da er zunächst habe abwarten wollen, ob sich auch ein Humanmediziner an Bord befände. Captain in Command Peter Fuller hatte eigentlich gehofft, sich der ganzen leidigen Angelegenheit mit dem Auffinden eines Mediziners unter den Passagieren entledigen zu können, auch um sich einen nervigen Funkverkehr mit dem Flughafen in Anchorage zu ersparen, von dem er nicht wusste, ob sich dort ein Arzt in Bereitschaft befände oder dieser erst alarmiert werden müsste, was die leidige Angelegenheit und das damit einhergehende ohrenbetäubende Schluchzen noch unnötig in die Länge ziehen würde, bevor er oder Chief Steward James May dann doch zur Tat schreiten müssten, um dem Notfall mittels einer Morphininjektion endlich den Stecker zu ziehen. Also überlegt Captain in Command Peter Fuller, der alleinige Inhaber der Bordgewalt, ob denn irgendwo in der Handlungsanweisung für Notfälle der BOAC steht, dass Veterinärmediziner an Bord keine ärztliche Nothilfe leisten dürften. Und das ist eine nicht ganz unerhebliche Frage, denn natürlich muss ein jeder Notfall an Bord und dessen Abwicklung genauestens protokolliert werden, vor allem dann, wenn zu dessen Abwicklung der Einsatz von Morphin, einem Betäubungsmittel, vonnöten ist. Das Protokoll wird dann zur Grund der Bewertung seiner Vorgesetzten am Boden, ob denn der alleinige Inhaber der Bordgewalt in der Luft, Captain in Command Peter Fuller, den Notfall korrekt und im Einklang mit der Handlungsanweisung für Notfälle der BOAC abgewickelt hat. Letztendlich, und dessen ist sich Peter Fuller natürlich bewusst, kommt es bei der Bewertung aber eigentlich immer nur darauf an, ob es im Nachgang der Abwicklung des Notfalles irgendwelche Scherereien geben wird, die sich für die BOAC irgendwie nachteilig auswirken könnten wie beispielsweise Schadensersatzklagen von Hinterbliebenen oder Schmerzensgeldforderungen der Betroffenen selbst. Der alleinige Inhaber der Bordgewalt ist somit in einer kniffligen Lage, denn alleinige Inhaberschaft der Bordgewalt in der Luft bedeutete eben auch immer alleinige Verantwortung später am Boden und im Zweifelsfalle dann auch alleinige Rechenschaft. Hätte sich ein Humanmediziner gemeldet, sicher, dann wäre diese, die Rechenschaft, auf jenen übergegangen, und Peter Fuller wäre fein raus. Aber bei einem Tierarzt? Peter Fuller ist sich unsicher, kann er, der ausgewiesenermassen kein medizinischer Fachmann ist, entscheiden, ob ein Veterinärarzt medizinischer Fachmann genug ist, um diesen kleinen schluchzenden schwitzenden Notfall zu behandeln? Oder sollte er doch besser versuchen, Funkkontakt zu einem Humanmediziner am Boden herzustellen? Aber wie lange dauert das? Peter Fuller schaut auf den armen schluchzenden Clifford Richard und vergegenwärtigt sich sodann der Handlungsanweisung für eingetretene Notfälle der BOAC in diesem konkreten Fall. Und soweit er sich erinnern kann, ist in dieser immer nur von „Arzt“ und „Mediziner“ die Rede, beides Attribute, die auf Sir Walter Plowright vollumfänglich und zweifelsfrei zutreffen, weshalb er dann salomonisch beschliesst, dass in dieser konkreten Situation ein Veterinärmediziner in der Luft immer noch besser ist als ein Humanmediziner am Boden.
Edward Turner schaut aus dem Fenster. Und was er dort sieht, ist umwerfend, denn er sieht eigentlich nichts. Er schaut in ein helles, gleissendes Licht, das ihn schnell zwingt, die Augen zusammenzukneifen. Erst allmählich gewöhnt sich seine Netzhaut, und das Licht im Fenster teilt sich in zwei Bänder, ein hellblaues Band oben und ein weisses Band unten, die in der Mitte am Horizont miteinander zu verschmelzen scheinen. Die Boeing 707 der BOAC donnert dem Nordpol über dem ewigen Eis der Arktis entgegen. Edward Turner sieht eine ganze Weile nichts als diese zwei Bänder, wobei das Schneeweiss am Boden ihm beinahe so makellos und unbefleckt wie das Blau des wolkenlosen Himmels erscheint. Er schaut nun konzentriert in die weisse Wüste unter ihm und langsam erkennt er auch Konturen, schälen sich sachte Schattierungen in das Weiss, schroffe Abrisse dann, aufgeworfene Eismassen, zerklüftete Schneeberge. Und schliesslich etwas, das nicht recht zu passen scheint in eine weisse Wüste mit abweisenden Kanten, Ecken und Rissen, und das ihm seltsam bekannt vorkommt. Rund und weich, ja, Schneebälle, könnte man meinen oder wie er damals dachte, als er noch ein Kind gewesen ist, acht Jahre alt vielleicht, Tennisbälle, damals allerdings nicht auf dem Weiss der Arktis, sondern auf dem satten Grün des Heidelands der South Downs unweit von Brighton, wo sein Vater für kurze eine Stelle angenommen hatte. Edward Turners Vater William hatte zunächst den Beruf des Schmids erlernt, bildete sich aber berufsbegleitend in einer Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen immer weiter fort, bis er schliesslich seine Anerkennung als Master Mechanical Engineering für die Metallverarbeitung erhielt. In dieser Zeit, Edwards Kindheitsjahre, zog die Familie, neben Williams Frau Frances gab es noch zwei Brüder und drei Schwestern, wobei Edward das jüngste Kind war, oft um. Selten blieben die Turners in diesen Jahren länger als neun Monate an einem Ort, wenn auch meist in oder in der Umgebung von London, nur ein einziges Mal entfloh die Familie den Kohlerauchschwaden und dem Erbsensuppennebel Londons und zog in die Umgebung von Brighton. Das englische Landleben war für den kleinen Edward, der eine für diese Zeit ungewöhnlich freie Erziehung genossen hatte, dergestalt, dass eine Eltern ihm ziemlich wenig Interesse entgegenbrachten, weshalb er hauptsächlich von seinen älteren Schwestern aufgezogen worden war, die kein Problem damit hatten, dass der kleine Edward bereits im Alter von sechs, sieben Jahren unbeaufsichtigt durch London stromerte, um das städtische Leben zu erkunden, ein kleiner Kulturschock gewesen. Erinnert er sich an diese Zeit auf dem Land zurück, dann zumeist an seine erste Begegnung mit den Southdown Schafen, die in der Umgebung seiner neuen Heimat frei grasten und von weitem wie eine Ansammlung dahin geworfener Tennisbällen aussahen. Ruhig und friedlich grasende kleine Schafe, die auf den quirligen kleinen Edward, der es bis dahin gewohnt war im Oberdeck der Londoner Doppeldeckerbusse ziellos durch das hektische London zu fahren, eine faszinierende wie auch eine gewisse beruhigende Wirkung entfalteten, was auch seiner Schwester Florrie nicht verborgen geblieben war, sodass sie ihn von fortan, wann immer er nicht einschlafen konnte, weil er vielleicht zu aufgeregt war oder zuvor schlecht geträumt hatte, an die Schafe in den South Downs erinnerte und ihn aufforderte, diese in seinen Erinnerungen zu zählen, bis er eingeschlafen war.
Aber natürlich, denkt Edward, sind das da unten nicht die South Downs und folglich können die Tennisbälle in dieser arktischen Eiswüste auch keine Schafe sein.
Aber was sind sie dann?
Herbert Plowright kehrt an seinen Platz zurück. Edward Turner wendet sich ihm zu, lächelt und nickt anerkennend, denn das Schluchzen vorne in der First hatte aufgehört und war einem leisen Schnarchen gewichen. Die Passagiere entspannen sich, einige schauen aus den Fenstern, andere unterhalten sich leise. Edward Turner richtet sich in seinem Sitz auf und schaut auf die Rücklehne des Sitzes vor ihm. Der Flug wird noch einige Stunden dauern. Hoffentlich hatte Miss Plant dem japanischen Importeur von Triumph und BSA Motorrädern auch seine korrekte Ankunftszeit genannt, damit er ihn am Tokioter Flughafen abholen konnte. Ohne seinen japanischen Geschäftspartner, der für ihn auch die Treffen mit Vertretern der japanischen Motorradindustrie arrangiert hatte, wäre er in Japan wohl ziemlich aufgeschmissen. Begonnen hatte Edwards Erkundungsreise mit einer Nachricht von Bill Johnson, die ihn ziemlich genau vor einem Jahr im Herbst des Jahres 1959 erreichte. Bis dahin hatten sich Edward Turners Unternehmungen in den USA sehr erfreulich entwickelt. Bereits 1949 hatte Bill Johnson oder die Johnson Motor Inc. oder JoMo eine neue Repräsentanz am West Coloroda Boulevard in Pasadena bezogen. Allein schon das Gebäude war in gewisser Hinsicht eine Ansage gewesen. Bis dahin wurden Motorräder vor allem in schummrigen und ölverdreckten Hinterhofwerkstätten verkauft und repariert. JoMos neues Hauptquartier und damit auch Triumphs Repräsentanz an der amerikanischen Westküste hingegen war ursprünglich als Autohaus konzipiert gewesen. Das Gebäude war dementsprechend grosszügig, sauber, modern und aufgrund der grossen Schaufenster auch einladend hell.

Johnson Motors Repräsentanz am West Colorado Boulevard in Pasadena. Die Aufnahme stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1949

Das Gebäude besteht heute noch und – Treppenwitz der Motorradgeschichte – diente es bis vor kurzem als Audi-Repräsentanz, womit sich ein Kreis schliesst, da BSA/Triumph einst NSU als weltgrössten Motorradhersteller ablöste
Ende 1949 verfügte Bill Johnson bereits über ein Netz von ungefähr 100 Händlern, die Triumph und Ariel Motorräder in den USA vertrieben. Allein erwies es sich zunehmend als schwierig, den landesweiten Vertrieb von Motorrädern und Ersatzteilen in einem so grossen Land wie den USA allein von Pasadena aus zu unterhalten, zumal man dieses Netz noch weiter ausbauen wollte, weshalb Edward Turner eine Ostküstenrepräsentanz in Baltimore, die Triumph Corporation oder die TriCor, gründete, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Triumphwerke in Meriden, welche anfangs einen Teil von JoMos Händlernetz übernahm, um dieses in den Osten der USA zu erweitern. Edward Turner verfügte somit 1959 über eine Vetriebsstruktur in den USA, die man mit etwas gutem Willen als ein landesweites Händlernetz bezeichnen könnte, das den Absatz des ganz überwiegenden Teils der jährlichen Produktion der Triumph Engineering Inc. in den USA gewährleisten konnte und sollte. Und so hätte es natürlich bis in alle Ewigkeit weitergehen können, wenn sich 1959 nicht etwas eingestellt hätte, das man mit etwas weniger gutem Willen die „japanische Irritation“ nennen könnte, die wiederum 1954 ihren expansiven Anfang nahm, als ein gewisser Soichiro Honda, gelernter KFZ-Mechaniker und Präsident der Honda Corporation, die nur sechs Jahre zuvor, 1948, begonnen hatte, Motorräder zu fertigen, höchstpersönlich die Tourist Trophy auf der Isle of Man besuchte.

Der nette Herr in der Bildmitte ist Soichiro Honda, der links daneben ein gewisser Michio Suzuki
Unerkannt und unverdächtig schlenderte Soichiro Honda durch die Rennställe der versammelten Motorrad-Weltelite, studierte deren avancierte Technologien und musste erkennen, dass für die Umsetzung seines sehr avancierten Planes, durch eigene Rennsporterfolge die globale Expansion seines Unternehmens einzuleiten, noch viel Arbeit vonnöten war, da die Honda-Technologie, die sich, was die Konkurrenzfähigkeit auf dem Track anging, 1954 noch im embryonalen Zustand befand, hoffnungslos unterlegen gewesen wäre. Aber Soichiro Honda liess sich durch den technologischen Vorsprung vor allem der Europäer nicht entmutigen, sammelte fleissig Pläne, Skizzen, Konzeptionen und auch spezielle Tuningteile ein, die er in zwei Koffern nach Tokio schaffte, wofür er seine Kleidung in Europa zurückliess, da die Gepäckbestimmungen der Airlines ein drittes Gepäckstück nicht erlaubten. Zuhause in der eigens neu gebauten Entwicklungsabteilung der Honda Corporation tüftelte Soichiro Honda an dem ersten Werksrenner, den er mit einem 125 ccm Antriebsaggregat ausstattete und dessen Details er bei dem Referenzmodell in dieser Motorenklasse, der NSU Rennmax, abkupferte. Fünf Jahre später ging Honda mit den neu entwickelten Werksrennern bei der Tourist Trophy in der 125 ccm Klasse an den Start. Und wenn auch der erste Japaner mit 7 Minuten Rückstand auf den Sieger durchs Ziel ging, liess das Gesamtergebnis dennoch aufhorchen, denn die Hondas erwiesen sich als sehr zuverlässig und beendeten das Rennen auf den Plätzen sechs, sieben, acht und elf, was Honda immerhin den Konstrukteurs-Cup in dieser Klasse einbrachte.

Hondas Racing Team 1959 bei der Isle of Man TT
Ein Erfolg, der für die versammelten und rennsportambitionierten Motorradhersteller der Welt wie aus dem Nichts kam und vor allem die englischen Hersteller aufmerksam werden liess. Eine Aufmerksamkeit, die sich bei Edward Turner nur noch steigerte, als er von Bill Johnson die Nachricht erhielt, dass die Honda Corporation im September 1959 eine Niederlassung in den USA, gar nicht weit von Johnsons eigenem Laden, in Los Angeles eröffnet hatte, woraufhin ein alarmierter Turner Bill Johnson bat, alle verfügbaren Informationen über Hondas Markteintritt in die USA in einem Dossier zusammenzutragen und ihm zu übersenden.

Hondas äusserst bescheidene erste Firmenrepräsentanz in den USA 1959
Was Edward Turner dann einige Zeit später lesen konnte, hatte es durchaus in sich, zwar gingen die Japaner im Herbst 1959 mit nur drei Modellen an den Start, die zudem wenig furchteinflössend waren, der Super Cup, einem Roller, und zwei Motorrädern, den Modellen Benly und Dream, beides kleinmotorige Twins mit 125 beziehungsweise 250 ccm. Bill Johnson erachtete das Design der Motorräder als hässlich, und in der Tat wirkten die ersten Hondas gedrungen und nicht besonders sportlich.

1962 Honda CA72 Dream 250 ccm
Dennoch gelang es Honda gleich zu Beginn ihrer Expansion in den USA ausgerechnet Ed Kretz abzuwerben, der ein landesweit bekannter Rennfahrer war und viele Erfolge zunächst auf Indian und später auf Triumph Motorrädern eingefahren hatte, bevor er nach seiner Karriere Triumph-Repräsentant und jetzt einer der ersten Hondahändler wurde. Mehrere andere Triumphhändler taten es ihm gleich und wechselten ebenfalls die Seiten, sodass Bill Johnson nervös wurde, die Initiative ergriff und den Vertriebsleiter von American Honda Hirobumi Nakamura zu einem Gespräch einlud. Da JoMo im dem Ruf stand, eine progressive Firma mit innovativer PR-Arbeit zu sein, war seinerseits auch Hirobumi Nakamura auf Johnson Motors neugierig und so kam es denn zu einem Treffen zwischen Bill Johnson und Hirobumi Nakamura und einigen Mitarbeiter im Vertrieb beider Firmen in Johnson Büro, in dessen Verlauf Johnson den Repräsentanten von America Honda unter anderem fragte, wie viele Maschinen er denn glaube, in den USA verkaufen zu können. Nakamura überlegte kurz und sagte dann, ungefähr 5.000 Einheiten. Johnson war überrascht, denn er hielt dies für ein sehr ehrgeiziges Ziel, dennoch, so sagte er, könne dieses am Ende des Jahres mit grossen Anstrengungen und dem entsprechenden Einsatz von Werbung vielleicht erreicht werden. Woraufhin der Japaner antwortete, er meine, 5.000 im Monat. Diese Ansage Nakamuras war ein Schock für Bill Johnson und er erwiderte ungläubig, es sei völlig unmöglich so viele Maschinen im Monat zu verkaufen. Dazu muss man sagen, dass damals zwischen 50.000 bis 60.000 Motorräder im Jahr in den USA verkauft worden sind. Angesichts eines riesigen Landes mit seinerzeit 180,7 Millionen Einwohnern eigentlich eine lächerlich geringe Anzahl. Wollte Honda seine Absatzziele erreichen, hätten die Japaner also den mickrigen Markt entweder vollständig schlucken oder den Absatz generell deutlich erhöhen müssen. Um das damalige Nischenprodukt Motorrad in solche Absatzhöhen zu drücken, war es also dringend notwendig, neue Käufergruppen anzusprechen, die bisher mit dem Motorrad eher nichts bis wenig anfangen konnten, wobei man auch hier ergänzen muss, dass Nakamura im Gespräch mit Johnson „flunkerte“, die Japaner von Honda hatten sich anfangs ihres Engagements in den USA inoffiziell „bescheidenere“ Ziele gesetzt. Man peilte zunächst den Verkauf von 1.000 Einheiten im Monat an, eine Marke, die freilich schon im Mai 1961 erreicht werden sollte. Im Jahr des Markeintritts verkaufte Honda – von September bis Dezember 1959 – immerhin ganze 170 Einheiten. Die Japaner tasteten sich langsam aber entschlossen hinein in einen für sie neuen Markt, wobei Bill Johnson schnell erkennen konnte, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht hatten. So adressierten sie tatsächlich mittels einer gewaltigen Werbekampagne neue Käuferschichten wie beispielsweise Frauen, denen sie insbesondere den Roller Super Cup schmackhaft machen wollten, kopierten Elemente des Marketings von JoMo, indem sie die Honda-Verkaufsräume ebenfalls hell, sauber und freundlich gestalteten, womit es ihnen ausserdem gelang, eine neue Sorte von Vertragshändlern anzuziehen, die über weitaus mehr eigenes Kapital verfügten als die bisherigen Motorradhändler. Kein Zweifel, Honda war gekommen, um zu bleiben und deshalb auch bereit – so liessen die Japaner Bill Johnson ausserdem wissen – eine Reihe von Modellen speziell für den amerikanischen Markt zu entwickeln. Als Edward Turner den Bericht Johnsons über Honda gelesen hatte, entschloss er sich sofort in die USA zu reisen, um die Motorräder des neuen Konkurrenten persönlich in Augenschein zu nehmen, weshalb er Bill Johnson vorab bat, bis zu seiner Ankunft eine repräsentative Auswahl japanischer Motorräder zusammenzustellen. Endlich angekommen bei JoMo in Pasadena, unterzog er jede Maschine einer ausführlichen Testfahrt sowie einer ausgiebigen Inspektion, um dann zusammenfassend festzustellen, die japanischen Motorräder seien „too good to be true“. Bis dahin hatte Turner angenommen, dass es sich bei den Produkten der aufkommenden japanischen Konkurrenz lediglich um „Billigprodukte“ handeln würde, die aufgrund der vergleichsweisen niedrigen Lohnkosten in Japan auch günstig angeboten werden konnten, und dass, sollten die Japaner versuchen, nicht mehr ausschliesslich über den Preis, sondern auch bezüglich der Qualität mit den britischen Motorrädern zu konkurrieren, sie aufwändiger produzieren müssten, was sie dann den Preisvorteil kosten würde. Diese Hondas aber, die hier in Pasadena vor ihm standen, das musste sich Turner eingestehen, waren jedoch bereits beides: Qualitativ hochwertig und vergleichsweise günstig. Turner besprach sich mit Bill Johnson und äusserte die Ansicht, dass die Hondas dennoch keine Konkurrenz für die Motorräder Triumphs darstellten würden, vielmehr könnte man vielleicht sogar von den Japanern profitieren, die Zweiräder mit kleineren Motoren herstellten, Einsteigermodelle mithin, sollte Honda also wirklich neue Käuferkreise erschliessen, könnten diese Kunden später, wenn sie der beschränkten Leistung der kleinen Hondas überdrüssig wären, auf stärker motorisierten Modelle von Triumph umsteigen, da Honda ihnen in der Klasse über 300 ccm Klasse kein adäquates Angebot machen konnte. Aufgrund ihrer Qualität schienen die Hondas einen guten Wiederverkaufswert zu haben, eine Inzahlungnahme wäre somit durchaus vorteilhaft, und mit der Bonneville hatte Triumph das „schnellste Motorrad der Welt“ ab 1959 ganz frisch in der Vermarktung, das anfänglich von Turner etwas bieder gestaltet, dann aber doch in den 1960er Jahren zu einer Ikone aufsteigen sollte, welche schon 1959 ganz vorne mit dabei war, was die Motorleistung anging. Turner zerstreute so Johnsons Sorgen, der sich aufgrund der erhofften Synergieeffekte auch nicht mehr dagegen sträubte, dass Triumph und Honda Motorräder von ein und demselben Händler verkauft werden durften. Aber auch wenn Edward Turner offiziell Entwarnung gab, so hatte er sich doch noch am Tag der Inaugenscheinnahme der Konkurrenzprodukte entschlossen, nach Japan zu reisen.
Edward Turner schaut wieder aus dem Fenster und kneift neuerlich die Augen leicht zusammen, bis sie sich an das helle Licht gewöhnen. Und sehr langsam schälen sich die Konturen aus dem unendlichen Weiss. Die japanischen Motorräder, welche Bill Johnson zusammengestellt hatte, waren mehr als nur bemerkenswert gewesen. Sie schienen auf den ersten Blick in der Tradition des britischen Motorradbaus zu stehen, allerdings offenbarten die Hondas dann doch ein paar Details, die sie von Turners Speed Twin unterschieden. So war der Motor der Honda Dream auch ein Parallel-Twin, zudem ein Gleichläufer, bei welchem die zwei Kolben gleichzeitig und parallel die Zylinderbahnen hoch und runter flitzten, allerdings war das Kurbelwellengehäuse der Honda horizontal gesplittet und nicht vertikal wie bei seinen Triumph. Edward Turner weiss nur zu gut, warum die Japaner diese Lösung gewählt hatten. Als Turner 1937 seinen epochemachenden Speed Twin Motor entwickelte, schätzte er die Kapazitätsgrenze seines Motorkonzepts auf ungefähr 600 ccm, dann würden die Vibrationen des Gleichläufers aufgrund des fehlenden Massenausgleichs vielleicht überhand nehmen. Damals hatte der Speed Twin aber eine niedrigere Verdichtung als 1959. Und nicht nur die Verdichtung hatte sich inzwischen erhöht, auch der Hubraum seiner Spitzenmodelle war deutlich angewachsen. Edward Turners Speed Twin war gewissermassen Opfer seines eigenen Erfolgs in den USA geworden, vermarktet als Freizeitspass und Sportmaschine weckten Turners Speed Twin Motorräder den Hunger nach immer mehr Motorleistung bei der amerikanischen Kundschaft. Baute Triumph bis dahin nur Motoren mit maximal 500 ccm, gab Turner 1950 dem Drängen Bill Johnsons und seiner Kunden nach und präsentierte mit der Thunderbird die erste Triumph mit einem 650 ccm grossen Motor. Jedoch handelte es sich bei diesem Modell strenggenommen um einen Tourer mit vergleichsweise zahmer Motorkonfiguration, was die Amerikaner aber nicht hinderte, den Motor zu tunen und in seiner Leistung immer weiter zu steigern, was Turner wiederum zwang, 1954 mit einer angespitzten 650 ccm Sportmaschine, der Tiger T110, werkseitig nachzulegen, die ein sehr grosser Erfolg werden sollte, den man 1959 mit dem Markteintritt der 650 ccm Bonneville, die noch leistungsstärker war, toppte. Drückte der Speed Twin 1938 so ungefähr 26 PS, verfügte die Bonneville 1959 über deren 46, was ein Leistungszuwachs von über 76% bedeutet, beachtlich für eine bereits mehr als 22 Jahre alte Motorkonzeption, die abgesehen von ein paar Details nie grundsätzlich überarbeitet worden war. Und wenn auch eine Triumph, „das schnellste Motorrad der Welt“, den Geschwindigkeitsrekord von 1955 bis 1970 halten sollte, so brachte doch diese immense Leistungssteigerung einige Unannehmlichkeiten im Alltagsgebrauch mit sich, denn ein Gleichläufer bleibt nunmal ein Gleichläufer, sollte der konzeptionell bedingt fehlende Massenausgleich nicht anderweitig ausgeglichen oder eingedämmt werden, übertragen sich mit immer mehr Leistung auch immer mehr Vibrationen auf Maschine und Fahrer und zerren auch immer stärkere Kräfte an der Kurbelwelle, deren dann stärkere Schwingungen im Verein mit den Vibrationen auch immer wieder Leckagen an einem vertikal gesplitteten Kurbelwellengehäuse provoziert, zumal, wenn die Kurbelwelle wie bei Turners Speed Twin nur zweifach gelagert ist. Diesen Problemen hatten die Japaner von Honda mit einem horizontal gesplitteten Kurbelwellengehäuse vorgebeugt und nicht nur das, hatten sie auch noch die Kurbelwelle durch eine vierfache Lagerung gebändigt. Und das, obwohl dieser konstruktive Aufwand bei einer 250 ccm Maschine mit sehr überschaubarer Motorleistung eigentlich gar nicht notwendig war. Er machte nur Sinn, wenn das Kurbelwellengehäuse (Bottom-End) so konzipiert worden ist, dass es auch mehr Leistung und somit auch mehr Hubraum verkraften konnte, um so einen grossen Teil gleicher Teile in verschiedenen Hubraumklassen verbauen zu können, was die Produktion der einzelnen Motorräder günstiger machen sollte. Honda hatte somit den Bau grösserer Motorräder nicht nur bereits angedacht, sondern auch schon konstruktiv vorbereitet. Und das weiss auch Edward Turner, der im ewigen Weiss der Arktis nach Tennisbällen Ausschau hält. Aber was ihn neben den offenbar gewordenen strategischen Planungen der Japaner von Honda fast noch mehr beunruhigt hatte, war ein Motorrad unter der von Bill Johnson zusammengestellten Auswahl, das ihm gleichermassen fremd und dennoch sehr vertraut war. Er, der seit 1956 Chief Executive der Automotive Division der BSA Group war, wusste zwar, dass BSA bereits 1953 einem japanischen Motorradbauer die Lizenz verkauft hatte, eine BSA A7 nachzubauen, er hatte aber noch nie eine dieser Maschinen gesehen. Jetzt aber stand ein Exemplar vor ihm, ein „original“ britischer Twin mit 500 ccm „Made in Japan“. Es handelte sich um ein Produkt der Meguro Manufacturing Co motorcycle works, dem nach Honda grössten japanischen Motorradhersteller, der, gegründet 1937, zudem der älteste Motorradhersteller in Japan war. Meguro verfolgte zunächst das Geschäftsmodell, ausländische Motorradmodelle qualitativ hochwertig nachzubauen, entwickelte später auch eigene Modelle, kam dann aber Ende der 1950er Jahre in wirtschaftliche Schieflage, da die Produktionskosten schlichtweg zu hoch waren, um konkurrenzfähig zu sein, und ging schliesslich ab 1962 im Kawasakikonzern auf, wo Meguro so etwas wie die Keimzelle von Kawasaki Motorrad bildete.

Ein Motorrad nebst Mitarbeitern der Meguro Manufacturing Co. Unklares Datum
Es muss sehr seltsam gewesen sein für den Chief Executive der Automotive Division der BSA Group, Edward Turner, vor einem Motorrad zu stehen, das die fast bis ins Detail genaue Kopie eines Motorrades war, das seine Firma einst entworfen und derzeit immer noch fertigte. Und umso erschreckender muss es gewesen sein, festzustellen, dass die japanische Kopie wesentlich besser gefertigt war als das britische Original, auch wenn Mr. Triumph, Edward Turner, beileibe kein BSA-Fan war.

BSA A7, allerdings aus dem 1948

Es gibt nicht so wahnsinnig viele Bilder von Meguro Motorrädern. Und oft ist unklar, welchen Typ genau sie abbilden, dennoch wird bei diesem Motorrad die Ähnlichkeit zu der weiter oben abgebildeten BSA A7 deutlich, auch wenn bei der Meguro die komplette Auspuffanlage fehlt
Und so fliegt der Chief Executive der Automotive Division der BSA Group, Edward Turner, in einer Boeing 707 der BOAC nach Tokio und hat zwei Vermutungen im Gepäck, die eigentlich schon fast Gewissheiten sind: Dass in nicht allzu ferner Zukunft ein japanisches Unternehmen, dessen Geschäftsmodell darin besteht, qualitativ hochwertige Motorräder mit den Kostenvorteilen der Massenproduktion auf den Markt zu werfen, einen Angriff auf das Geschäftsmodell der Automotive Division der BSA Group unternehmen wird, das darin besteht, klassische britische Motorräder mit sportlichen Genen und grossen Hubräumen unter teilweise antiquiert wirkenden Bedingungen zu fertigen. Und dass es selbst dem zweitgrössten japanischen Motorradhersteller, der wahrscheinlich straffer organisiert ist als die allermeisten verschnarchten britischen Motorradhersteller und der noch dazu mit vergleichsweise geringen Lohnkosten operieren kann, nicht gelungen ist, ein hochwertiges klassisches „britisches“ Motorrad zu konkurrenzfähigen Preisen auf den Markt zu bringen.
Edward Turner schaut sehr lange in das ewige Weiss der Arktis. Fast so, als suche er etwas. Dann fängt er leise an zu zählen:
Ein Eisbär.
Zwei Eisbär.
Drei Eisbär.
Vier Eisbär.
Fünf Eisbär.
Sechs Eisbär.
„Sir?
Sieben Eisbär.
„Entschuldigen Sie, Sir!“
Acht…
Edward Turner wendet sich nach links und erblickt „B-Lady“ Gwendolyn Griffin, die in der linken Hand eine Serviergabel und in der rechten ein langes Schinkenmesser hält. „B-Lady“ Gwendolyn Griffin lächelt: „Ihr Roastbeef, Sir. Wie viele Scheiben darf ich ihnen abschneiden?“ Edward Turner braucht eine kleine Weile, um zu verstehen, was „B-Lady“ Gwendolyn Griffin von ihm will, dann sagt er schliesslich: „Zwei, bitte.“ „B-Lady“ Gwendolyn Griffin, die einen blütenweissen BH trägt, der absolut nicht in seinen Konturen durch ihre weisse Bluse hindurch schimmert, dreht sich zum grossen prächtigen Stück Roastbeef, das dampfend auf dem Servierwagen vor ihr liegt und schneidet mit dem langen Schinkenmesser zwei Scheiben ab, die durchgängig die gleiche Breite haben, wobei kein Stück schmäler oder breiter ist als das andere. 1960 wird an Bord von BOAC-Airlinern noch kein fertig konfektioniertes Essen in Plastik-Portionstellern serviert, 1960 wird das Essen noch für jeden Passagier persönlich von der Crew angerichtet, zumal auf den prestigeträchtigen Interkontinentalflügen. Das bedingt natürlich, dass jedes Mitglied der Kabinen-Crew während seiner Ausbildung auch im Kellnern unterwiesen worden und somit auch befähigt ist, einen Fisch fachgerecht zu filetieren, Geflügel zu zerlegen, Hummer auszulösen oder exakt gleichmässig breite Scheiben von einem Braten abzuschneiden. Um es sich ein wenig einfacher zu machen, hatte die BOAC Crew von Edward Turners Flug nach Tokio sich die Aufgaben je nach Talent geteilt. „B-Lady“ Gwendolyn Griffin hatte ein Talent für das exakte Abschneiden von Bratenscheiben, dafür war sie weniger gut im Filetieren von Fischen, wahrscheinlich weil sie ein Problem mit Gräten hatte. Jetzt richtet sie die zwei Scheiben Roastbeef appetitlich auf einem Teller an, platziert dann die Röstkartoffeln, das Gemüseallerlei und schliesslich den Yorkshire Pudding auf dem Teller. Nachdem sie die Cambridge Sauce gekonnt angegossen hat, reicht sie Edward Turner, der noch schnell seinen Tisch aufklappt, Besteck, Serviette und anschliessend den fertig angerichteten Teller. Und als Getränk, wie von Edward Turner gewünscht, ein kühles Glas 1954er Beaune Clos des Mouches Blanc. Edward Turner betrachtet lächelnd sein Mahl, bedankt sich bei „B-Lady“ Gwendolyn Griffin, breitet die Serviette über seinem Schoss aus und…
So. Das wäre geschafft, ziemliche viele Wörter, um ein paare dürre Fakten an den Leser zu bringen, die für den weiteren Fortgang von „The Wild Bunch“ wichtig sind, ohne ihn durch die dürren Fakten über Gebühr zu langweilen. Wir können also Edward Turner, Chief Executive der Automotive Division der BSA Group, getrost seinem Roastbeef überlassen, denn viel mehr gibt es an dieser Stelle, an Bord einer Boeing 707, die im Jahre 1960 über den Nordpol nach Tokio fliegt, um dort die aufkeimende japanische Motorradindustrie zu studieren, nicht mehr zu sagen und einfach hier aussteigen. Ja, auch während des Flugs! Das geht, denn wir fliegen ja nicht wirklich, da dieser Flug schon längst stattgefunden hat. Er ist nur noch präsent in unseren Köpfen und somit so etwas wie eine nacheilende Ausgeburt unserer Phantasie. Und wenn wir jetzt also aussteigen, dann können wir nicht fallen und wir werden auch nicht frieren, wir werden einfach in der Luft stehenbleiben und einer Boeing 707 nachschauen, die mit ihren vier Rolls Royce Triebwerken vier malerische Kondensstreifen in den frostklaren Himmel zeichnen.
Fare well, Eddy! Mach’s gut, alter Junge! Bald schon werden wir uns wieder sehen!
Und weil Edward Turner anstrengende Tage und vielleicht erschreckende Erkenntnisse bevorstehen, werden wir auf diesem Hinflug ein letztes Mal nett zu ihm sein und dafür sorgen, dass Eddys Hintern an Bord dieser Boeing 707 den Nordpol exakt mittig passieren wird, auch wenn er, der Nordpol, vielleicht nur stecknadelkopfgross sein sollte.

Wer erinnert sich nicht gerne an „Heintje“? Diese holländische Nervensäge mit der glockenhellen Stimme, welche mit gerade mal 13 Jahren 1968 die deutschen Charts mit gleich drei Nummer 1 Hits stürmte, die die bezeichnenden Titel „Mama“, „Du sollst nicht weinen“ und „Heidschi Bumbeidschi“ trugen. Und jetzt könnte man natürlich über die tiefenpsychologischen Aspekte räsonieren, die vielleicht mit dazu beigetragen haben könnten, dass ausgerechnet 1968, also in dem Jahr, in welchem einige politische Entwicklungslinien ihren Anfang nahmen, deren inzwischen ziemlich verheerenden Auswirkungen uns heute vielleicht mehr als jemals zuvor beschäftigen und beschäftigen werden, ein kleiner lieber Junge mit holländischem Akzent bundesrepublikanische Mutterherzen mittels ziemlich einfach gestrickten Schmachtfetzen so rühren konnte, dass sie „Mama“ zur meistverkauften Single des Jahres machten und das zugehörige Album „Heintje“ für insgesamt 9 Monate an die Spitze der deutschen Albumcharts beförderten, wozu sie das Werk über 3,6 Millionen Mal kaufen mussten, was für die damalige Zeit schon eine sehr beeindruckende Zahl gewesen ist.

Heintje ca. 1970
Aber natürlich interessiert uns dies an der Stelle (noch) nicht. Uns interessiert vielmehr Heintjes Nummer Eins Hit „Du sollst nicht weinen“, der nach „Mama“ die zweit meistverkaufte Single des Jahres 1968 war, welche sich immerhin zwei Wochen lang an der Chartspitze behaupten konnte und das gegen durchaus prominente Konkurrenz wie Tom Jones (Delilah), Peter Alexander (Delilah), die Beach Boys (Do It Again) oder die Beatles (Hey Jude). Und uns interessiert Heintjes „Du sollst nicht weinen“, da es oder vielmehr sein von Ralph Maria Siegel „komponierter“ Vorgänger „Das Lied der Taube“ wiederum ein verballhorntes Cover eines mexikanischen Volksliedes ist, das in „The Wild Bunch“ eine für viele damalige und auch spätere und auch heutige Zuschauer irritierende Rolle in einer nicht minder irritierenden Szene spielt. „La Golondrina“, wie das Lied im Original heisst, wurde in den 60er Jahren des 19 Jahrhunderts von dem mexikanischen Arzt Narciso Serradel Sevilla komponiert, der auf Seiten des mexikanischen Generals Ignacio Zaragoza im sogenannten Mexikanischen Interventionskrieg gegen die Franzosen kämpfte, die ab 1861 versuchten mit Hilfe anderer europäischer Mächte ein ihnen genehmes Marionetten-Kaiserreich in Mexiko zu errichten. Ein Unterfangen, das anfangs für die Franzosen durchaus erfolgreich verlief, auch weil die US-Amerikaner zu gleicher Zeit mit ihrem Bürgerkrieg beschäftigt waren, und sich deshalb nicht um die „dreiste“ französische Einflussnahme in ihrem mittelamerikanischen „Hinterhof“ kümmern konnten. Bereits 1862 wurde Narciso Serradel Sevilla von den Franzosen gefangengenommen und nach Frankreich deportiert, wo er, geplagt von heftigem Heimweh, „La Golondrina“ geschrieben haben soll. (Nach anderen Quellen soll er das Lied vor der Deportation verfasst haben). Wie auch immer, handelt das Lied von einer Schwalbe (Golondrina), die als eine Art Allegorie für die Heimatlosigkeit eines mexikanischen Deportierten oder Exilierten dienen soll:
Wohin wird sie fliegen,
so schnell und erschöpft?
Die Schwalbe, die von hier fortfliegt?
Oh, wenn im Wind sie sich verirrt?
Auf der Suche nach Schutz,
und ihn nicht findet?
Neben meinem Bett
will ich ihr ein Nest aufstellen,
wo sie sich ausruhen kann unterwegs.
Auch ich bin verirrt hier im Lande,
oh heiliger Himmel,
und kann noch nicht einmal fliegen.
Ich höre Dich singen,
oh zarte Schwalbe!
Ich werde an meine Heimat denken
und weinen.
Der Komponist hatte mit seiner traurigen Weise im damaligen Mexiko einen Nerv getroffen. Leider, muss man vielleicht hinzufügen, denn in dem von Krieg und wirtschaftlicher Not geplagten Land wurde „La Golondrina“ schnell sehr populär, zu gut nur wusste man die in diesem Lied ausgedrückte Melancholie nachzuempfinden, anfangs ein schwacher Trost für die Vertriebenen und Heimatlosen wurde „La Golondrina“ schnell zu einem Volkslied für den Abschied, später als ab 1910 die Mexikanische Revolution das Land bis ins Mark erschütterte, die geschätzt eine Million Menschen das Leben kosten sollte, ein Begräbnislied, das man buchstäblich zum letzten Geleit anstimmte, wenn der Sarg zu Grab getragen wurde. Der amerikanische Journalist W. K. Stratton erinnert sich in seinem Buch „The Wild Bunch“ an eine Unterhaltung mit einem Trompeter eines Mariachi-Ensembles, das sind spezielle mexikanische Musikformationen, die zu Festen und Hochzeiten aufspielen, aber auch Begräbnisse mit ihrer Volksmusik begleiten, der ihm erzählte, dass in vorchristlicher Zeit die Indios in Mexiko geglaubt hätten, die Seelen der Verstorbenen würden sich in Schwalben verwandeln, um mit ihren eigenen Flügeln in das Totenreich zu segeln. Eine Vorstellung, die auch nach der Christianisierung Mexikos nicht unterging, sondern Bestandteil des Volksglaubens wurde, was die besondere Stellung dieses Volksliedes in der mexikanischen Kultur auch erklärt. „La Golondrina“ ist also ein sehr spezielles Lied und nicht irgendein „schmaltzy“ Song, wie zumindest ein us-amerikanischer Filmkritiker anlässlich seiner Rezension 1969 mäkelte, dem sich aufgrund des fehlenden Hintergrundwissens die Bedeutung des Liedes im Kontext einer an sich schon irritierenden Filmsequenz von „The Wild Bunch“ nicht aufschlüsselte. Die Sequenz, um die es geht, spielt im Heimatdorf des jungen Mexikaners Angel, in welchem die wilde Bande, die ja nur noch aus dem Anführer Pike Bishop, seinem Partner und rechten Hand Dutch Engstrom, den Gorch Brüdern, dem alten Freddie Sykes und eben dem jungen Mexikaner Angel besteht, auf ihrer Flucht oder vielleicht sollte man eher schreiben: auf dem Weg in ihr nächstes und letztes Abenteuer Station macht. Angel hat seine Mitstreiter in sein Dorf eingeladen, bittet sie jedoch, niemanden zu erzählen, was er in der Zwischenzeit seit seinem Weggang so getrieben hat. Es ist das Mexiko der Revolutionswirren, 1913 hatte sich General Victoriano Huerta an die Macht geputscht und den bisherigen Präsidenten ermorden lassen, damit stürzte er das Land in eine weitere blutige Phase der Revolution, in welcher sich zunächst alle lokalen Revolutionsführer und sonstigen Banditen gegen Huerta wandten. In Norden von Mexiko operierte Pancho Villa erfolgreich gegen die Federales, die Bundestruppen Huertas, welche sich zunehmend in Auflösung begriffen sahen und wie das ganze Land immer tiefer in die Anarchie abglitten.

Victoriano „El Chacal“ Huerta. 39. Präsident von Mexiko. Verstarb 1916 in US Haft
Auch Angels Dorf wurde nicht verschont, so erfährt der Zuschauer gleich eingangs der „Dorfszene“, dass das Dorf von Federales heimgesucht worden war, die sämtliche Rinder, Pferde und das gesamte Getreide gestohlen hätten, wobei sieben Dorfbewohner darunter Angels Vater den Tod fanden. Und wenn der Zuschauer auch nicht erfährt, wie lange dieser Angriff zurückliegt, so steht das berichtete Ereignis mit all seinen tödlichen und schrecklichen Folgen doch in einem irritierenden Kontrast zu dem Bild, welches Peckinpah von dem mexikanischen Dorf selbst zeichnet.
Denn dieses erweckt nicht den Eindruck der Trauer, der Not oder der Zukunftsangst, ganz im Gegenteil, Peckinpahs mexikanisches Dorf präsentiert sich vielmehr als Idylle, die Stimmung unter den Einwohnern ist gelöst und heiter. Das Dorf befindet sich in freudiger Erwartung auf ein Fest, das am Abend stattfinden soll. Frauen bereiten Speisen zu, Kinder planschen nackt im Dorfteich, später wird dann noch gelacht, getanzt und musiziert. Spielt „The Wild Bunch“ fast ausschliesslich in karger, sonnenverbrannter Landschaft, erscheint Angels Heimatdorf als eine grüne Oase, ein Paradies unter schattenspendenden Bäumen, in dem die Menschen sorgenfrei und glücklich leben. Einzig und allein Angel selbst ist aufgewühlt, hasserfüllt und unglücklich, nachdem er erfahren musste, dass sein Vater unter den getöteten Dorfbewohnern war und ausserdem seine von ihm angebetete Verlobte Teresa freiwillig mit den Federales weitergezogen ist, um die Geliebte eben ihres Anführers Mapache zu werden, der zudem seinen Vater auf dem Gewissen hat. Aber auch wenn Angel auf Rache sinnt, so trübt das die Feierlaune der anderen Dorfbewohner als auch die seiner Kumpane keineswegs. Neben dieser Nonchalance oder auch Lebensfreude mit der die Dorfbewohner in schwieriger Zeit über schreckliche Ereignisse hinweggehen, irritiert noch etwas anderes in Peckinpahs mexikanischem Dorf. Und das ist die Figur des „Dorfchefs“ Don Jose, ein alter weisser Mann, der sich auf sehr spezielle Art um das Wohlergehen seines Dorfes zu kümmern scheint. Angedeutet wird die Doppelbödigkeit der Figur Don Jose lediglich in einem kurzen Dialog. Nachdem er das ausgelassene Treiben ausgerechnet der Gorch Brüder beobachtet hat, lässt Peckinpah Don Jose sagen:
„We all dream of being a child again, even the worst of us. Perhaps the worst most of all.“Pike Bishop merkt auf:
„You know what we are then?“Worauf Don Jose auf Bishop und Sykes zeigt und antwortet:
„Si, the both of you!“Ein kurzer Dialog, in welchem Sam Peckinpah zwei alte weisse Männer sich gegenseitig erkennen lässt, zwei Männer vom gleichen Schlag, wenn auch unterschiedlicher, als man zunächst vielleicht denken sollte. Bishop entgegnet lachend:
„And you!“ Peckinpah führt die Figur des Don Jose beinahe beiläufig in „The Wild Bunch“ ein, wenngleich sie später im Film noch exponiert auftreten wird. Don Jose ist eine Figur, die gewissermassen zwischen allen Stühlen sitzt. Er hasst den Diktator Huerta, was ihn aber nicht zu einem Anhänger oder Mitstreiter Pancho Villas oder eines anderen Rebellenführers macht, und er ist ein Bandit, fühlt aber dennoch Verantwortung für seine soziale Gemeinschaft, das Dorf.
Don Jose ist eine schillernde, aber in all ihrer Widersprüchlichkeit keine zerrissene Figur. Er scheint über etwas zu verfügen, was der wilden Bande, abgesehen von Angel, gänzlich abgeht, und das sind immaterielle höhere Werte, die sein Handeln leiten, wenn auch sein Handeln selbst nicht unbedingt moralisch ist. Und in der Tat gibt es für diese besondere Figur ein historisches Vorbild in der Zeit der Mexikanischen Revolution, welches Peckinpah gekannt haben dürfte, und das so der Figur des Don Jose sehr wahrscheinlich seinen Charakter verlieh. Auch schon bevor die Mexikanische Revolution Chihuahua erschüttern sollte, galt das Gesetz in der texanisch-mexikanischen Grenzregion nicht viel. Die Gegend war äusserst dünn besiedelt, die Wege waren lang und die nächsten Strafverfolgungsbehörden auf beiden Seiten der Grenze nicht nur weit weg, sondern auch nicht besonders effektiv. Das begünstigte ein grenzübergreifendes Banditenwesen, dergestalt, dass mexikanische Banditen bevorzugt nördlich des Rio Grande auf texanischem Gebiet tätig wurden, um Rinder und Pferde zu stehlen oder Handelsposten zu überfallen, während ihre texanischen „Kollegen“ gleiches fast ausschliesslich auf mexikanischem Boden verübten. Dieses internationale Banditenwesen war seinerzeit so intensiv, dass wahrscheinlich manche Rindviecher im Verlauf ihres für gewöhnlich sehr kurzen Lebens so oft den Rio Grande überquerten, bis auch eingefleischte Banditen beider Nationen gar nicht mehr wussten, ob sie ursprünglich mexikanischer oder doch texanischer Herkunft waren. Der bekannteste dieser Banditen war ein gewisser Francisco „Chico“ Cano, geboren und aufgewachsen in Mexiko in ärmlichen Verhältnissen, arbeitete er wohl zunächst als Cowboy, betrieb womöglich auch eine eigene kleine Ranch mit vielleicht damals schon gestohlenen Rindviechern, bevor er dann zur Legende wurde. Je nachdem, auf welcher Seite der Grenze man nach Chico Cano fragte, hielten die Texaner ihn für einen schwerkriminellen Viehdieb und Polizistenmörder, während die Mexikaner ihn als eine Art mexikanischen Robin Hood verehrten oder verehren, um dann relativierend hinzuzufügen, dass wenn Chico Cano vielleicht unter Umständen auf texanischer Seite hin und wieder Vieh geraubt haben könnte, er dieses natürlich nur „zurückgeraubt“ habe. Chico Cano war – so will es die Legende – ein Mann mit einem unverrückbaren Wertekanon. Su familia, su tierra, su hogar: Der Schutz von Familie, Land und Heimat sollen die Maxime seines Handelns gewesen sein, als auch seine Motivation für die Seinen zu sorgen, wobei er diese Werte nicht abstrakt verstand, sondern ganz unmittelbar. Die Familie oder seine Heimat waren nicht die Nation oder Mexiko, sondern in seinem Verständnis die Dorfgemeinschaft, und das Land, das sie zum Leben brauchten. Und um diese Familie möglichst heil durch die schweren Zeiten nicht nur der Mexikanischen Revolution zu bringen, waren ihm so ziemlich jede Mittel recht, was natürlich auch den Herausforderungen der Zeit geschuldet war. Zeitweise unterhielt Chico Cano zusammen mit seinen vier Brüdern zu diesem Zweck eine kleine Reiterarmee von 100 – 200 Mann, was ihn auch zu einem Machtfaktor in der Mexikanischen Revolution werden liess, dergestalt, dass die verschiedenen Revolutions- oder Rebellenführer, die in Nordmexiko operierten und sich dort zweitweise auch gegenseitig bekämpften, versuchten, Chico Cano und seine Männer für ihre Ziele einzuspannen. Cano dachte aber gar nicht daran, sich von den verschiedenen Protagonisten der Revolution benutzen zu lassen, sondern benutzte vielmehr sie und das sehr erfolgreich, indem er ziemlich geschmeidig zwischen den unübersichtlichen Fronten manövrierte. So ritten er und seine Truppe zeitweise für Pancho Villa und dann wieder für dessen Kontrahenten Venustiano Carranza, je nach dem, welcher im Moment für sein Dorf den grössten Nutzen versprach. Und deshalb hatte er auch überhaupt keine Probleme damit, gleichzeitig mit Pancho Villa als auch mit Venustiano Carranza zu brechen, um sich wiederum und vermeintlich auf die Seite eines Generals und Parteigängers des verhassten Huertas, Pascual Orozco, zu schlagen.
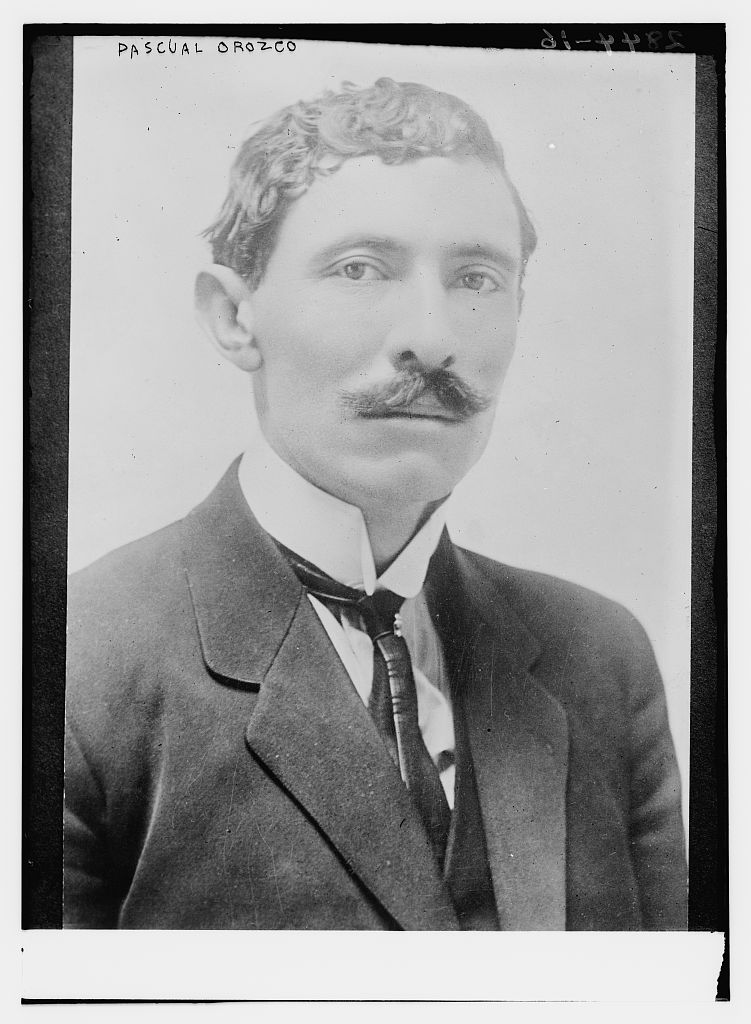
Pascual Orozco. Mexikanischer Revolutionär, der 1915 in Texas von Texas Rangern erschossen wurde, da sie ihn (vielleicht) für einen Pferdedieb hielten
Carranza und Villa drohten daraufhin, Canos Heimatdorf als auch alle Dörfer der Umgebung dem Erdboden gleichzumachen, woraufhin Chico Cano die gesamte Bevölkerung seines Dorfes und der Umgebung 160 Meilen flussaufwärts in ein besser zu verteidigendes Gelände evakuieren liess, wo er und seine Truppe tatsächlich einen Angriff der „Carrancistas“ erfolgreich abwehren konnten. Chico Cano war in dieser Zeit der revolutionären Wirren, da sich alle staatlichen Strukturen, welche den Menschen ein Auskommen in Sicherheit ermöglichen sollten, nicht nur auflösten, sondern sich auch in einem ganz existenziellen Sinn gegen sie wandten, ein Halt oder auch eine Art anarchistischer Anti-Anarchist, der im Chaos hemdsärmelig für die Sicherheit und Ordnung sorgte, die der Staat den Seinen nicht mehr garantieren konnte. Cano nahm somit in der Geschichte der Mexikanischen Revolution eine ziemlich einzigartige Stellung ein, er war zum einen Protagonist der Mexikanischen Revolution, wenn er mal wieder für den einen oder anderen Revolutionsführer Partei ergriff, und zum anderen war er so etwas wie seine eigene Ein-Mann-Revolution innerhalb der Mexikanischen Revolution, da er aus taktischem Opportunismus Partei ergriff und diesen Opportunismus wiederum in den Dienst für seine Nächsten stellte. Eine Haltung, die ihm auch den Respekt seiner Feinde einbrachte, wovon vielleicht zwei merkwürdige Fotos künden, die möglicherweise die einzigen zwei Fotos von Chico Cano sind, denn sehr oft wird sich Anfang des 20. Jahrhunderts im mexikanisch-texanischen Niemandsland nahe des Rio Grande keine Gelegenheit zum Erstellen eines Lichtbildes ergeben haben.

Chico Cano ist der Herr mit Sombrero und Zigarre. Wer denn sonst..?
Beide Fotos zeigen Chico Cano in Gesellschaft zweier us-amerikanischer Offiziere. Ausweislich der Notiz auf der Rückseite des einen Fotos soll es sich um (von links nach rechts) Major John Arthur Considine und Captain L. H. Matlack handeln, beide Angehörige der 8. US Kavallerie. Das Foto soll in Candelaria, einem Nest am texanischen Rio Grande Ufer, aufgenommen worden sein und zwar zwischen 1918 und 1919. Chico Cano selbst wird in der handschriftlichen Notiz als Hauptmann der Pancho Villa Armee und Banditenführer vorgestellt, die beiden Männer ganz rechts, offensichtlich Mexikaner, als zwei seiner Männer. Diese Angaben können stimmen, müssen es aber nicht, denn sie passen nur bedingt zu den historischen Fakten.

Tatsache ist aber, dass die Vereinigten Staaten anfänglich der Mexikanischen Revolution mit Pancho Villa sympathisierten und ihn auch unterstützen, im Oktober 1915 erkannte die US-Administration jedoch den zwischenzeitlich an die Macht gekommenen Rivalen von Villa, Venustiano Carranza, offiziell als mexikanisches Staatsoberhaupt an. Erbost darüber begann Pancho Villa, Jagd auf amerikanische Staatsbürger in Chihuahua zu machen und überfiel zudem auf us-amerikanischem Territorium zivile und militärische Einrichtungen, was mehreren Bürgern und Soldaten das Leben kostete und die US-Regierung schliesslich bewog, im März 1916 eine Strafexpedition, die sogenannte „Pancho Villa Expedition“, nach Nordmexiko zu entsenden, um Pancho Villa endlich den Garaus zu machen. Es kam im Folgenden auch zu einigen Scharmützeln zwischen den Villistas und den Amerikanern, aber ihr eigentliches Ziel, Pancho Villa gefangen zu nehmen oder unschädlich zu machen, erreichte die Expedition nicht, bevor sie im Februar 2017 wieder nach Hause beordert wurde, da der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg kurz bevor stand und es bereits zu ersten Kampfhandlungen zwischen „offiziellen“ mexikanischen Truppen und den Amerikanern gekommen war, da die „offizielle“ mexikanische Regierung unter Carranza die US-Intervention scharf missbilligte, auch wenn die Amerikaner Jagd auf den Todfeind Carranza machten.

Venustiano Carranza. 44. Präsident von Mexiko. Erschossen 1920
In den darauffolgenden zwei bis drei Jahren entspann sich die blutigste Zeit der Mexikanischen Revolution, insbesondere der Norden Mexikos glitt in einen Bürgerkrieg ab, was die USA zum Schutze der Grenzbevölkerung zu regelmässigen militärischen Interventionen zwang. Pancho Villas Truppen wurden dann 1919 bei Ciudad Juarez mit schlachtentscheidender US-Hilfe zwar vernichtend geschlagen, dafür lebte das Banditenwesen wieder auf und das mit bisher nie dagewesener Intensität. Um dem zu begegnen, verlegten die Vereinigten Staaten unter anderem die 8th US Cavalry an die mexikanische Grenze, die tatsächlich auch einen Aussenposten in Candelaria unterhielt, dem texanischen Nest am Rio Grande, in welchen die weiter oben stehenden beiden Fotos mit Chico Cano aufgenommen worden sein sollen. Mit der 8th US Cavalry nach Candelaria kamen auch die beiden amerikanischen Kavallerie-Offiziere auf dem Foto, insbesondere das Wirken von Captain L. H. „Two Guns“ Matlack ist gut belegt, da er sich durch einige herausragende Missionen auszeichnete, insbesondere zu erwähnen ist hierbei die Befreiung von zwei bruchgelandeten amerikanischen Piloten aus der Gefangenschaft mexikanischer Banditen, aber auch die erfolgreiche Verfolgung und Bekämpfung anderer Desperados, die texanisches Gebiet heimgesucht hatten. Es existieren mehrere Fotos von ihm aus dieser Zeit, auf welchen er zweifelsfrei zu erkennen ist. Insofern scheinen die Fotos, die diese beiden US-Offiziere an der Seite Chico Canos zeigen, authentisch zu sein und gerade diese vermutliche Authentizität begründet deren Merkwürdigkeit, denn Cano, der immer mal wieder für Villa ritt, nach dessen Niedergang 1919 aber zunehmend auf eigene Rechnung unterwegs war, soll versucht haben, seinen Frieden mit den US Behörden zu machen, den diese ihm aber nicht gewährten, vielmehr blieb er für die Amerikaner in der Region so etwas wie der „Public Enemy Number One“, dem man alle möglichen Untaten anlastete, deren tatsächliche Urheberschaft sich nicht klären liessen, zudem stand er im (nie wirklich bewiesenen) Verdacht, einen Texas Ranger, der ihn seinerzeit verbissen verfolgt und zugesetzt hatte, übelst zugerichtet und danach förmlich hingerichtet zu haben, weshalb seit dieser „Tat“ auch ein offizieller Haftbefehl existierte, der alle Vertreter der amerikanischen Staatsmacht, zu der auch diese beiden US-Offiziere der eigens zur Banditenjagd an die mexikanischen Grenze verlegten Kavallerie ganz unzweifelhaft gehörten, anwies, Chico Cano umgehend zu verhaften oder anderweitig unschädlich zu machen, sobald sie seiner habhaft werden konnten. Chico Cano sieht aber auf diesen beiden Fotos nicht sehr „verhaftet“ aus und ganz eigentlich sieht er überhaupt nicht verhaftet aus. Lässig da stehend mit halb geöffnetem weissen Hemd, grossem Sombrero, angelegten Cowboy-Chaps (wozu eigentlich?) und geschnürten Stiefeln sieht er eher aus wie die mexikanische Ausgabe von Clint Eastwood am Set eines Spaghetti-Westerns der 1960er Jahre. Und damit nicht genug, scheint er auf dem ersten Foto auch noch an einer Zigarre zu ziehen, viel mehr „Sergio Leone“ geht eigentlich gar nicht. Nein, Chico Cano sieht gar nicht aus wie jemand, der verhaftet worden ist, er sieht mehr aus wie jemand, der von zwei US-Offizieren dazu überredet wurde, mit ihnen gemeinsam für ein oder mehrere Fotos zu posieren. Seltsamerweise schauen sie aber alle rechts an dem Fotografen vorbei, was den Schluss nahelegen könnte, dass sie dereinst von zwei Fotografen fotografiert worden sind, einem, für den sie posierten und einem anderen links postiert von dem ersten, der sie fotografierte, während sie gleichzeitig fotografiert wurden, sozusagen ein Foto im Moment des Fotografiert-Werdens anlässlich einer mehr oder weniger entspannten Zusammenkunft. Auffällig ist auch, dass keiner der Fotografierten bewaffnet ist, was wieder gegen eine Verhaftung Canos und für eine freiwillige und vor allem friedliche Zusammenkunft der abgebildeten Herren sprechen würde. Vielleicht sind die beiden Fotos somit eine Art Indiz dafür, dass Chico Cano sich den amerikanischen Offizieren angedient hat, um mit seinen speziellen Kenntnissen über das Innenleben der Mexikanischen Revolution und über die Feinheiten des regionalen Banditenunwesens bei der Ganovenjagd behilflich zu sein, und dass das US-Militär seine Offerte ausweislich der Lichtbilder zumindest inoffiziell auch akzeptierte und annahm, was für Cano sicherlich einige Vorteile mitgebracht haben dürfte wie beispielsweise ein nachlassender Verfolgungsdruck seitens der US Kavallerie, eine sehr effiziente Reduzierung der Banditen-Konkurrenz und damit einhergehend auch ein stark verbesserter Schutz seines Dorfes.
Und diese Sorge für sein Dorf ist dann vielleicht auch der Grund, warum Don Joses Dorf in The Wild Bunch wie eine Idylle in einem Meer von Gewalt und Elend erscheint. Es ist diese taktische als auch „politische“ Beweglichkeit im Dienste einer für ihn „höheren“ Sache, die wohl auch hauptursächlich dafür war, dass Chico Cano als einer der sehr wenigen „herausgehobeneren“ Protagonisten anders als die meisten wirklich herausgehobenen Persönlichkeiten der Revolution wie Pascual Orozco, Pancho Villa, Venustiano Carranza und auch Emiliano Zapata diese blutige Zeit überlebte. Chico Cano starb am 28. August 1943 im Alter von 56 Jahren, nachdem er sich, todkrank, wie er war, selbst aus der Klinik entlassen hatte. Kurz vor seinem Tod gefragt, ob er denn fürchte, seinem Schöpfer bald gegenüber stehen zu müssen, soll er geantwortet haben: „Mein Vater war mein Schöpfer. Armut war mein Schöpfer. Misstrauen war mein Schöpfer. Ich stand ihnen mein ganzes Leben lang gegenüber.“ Ein früher, aber auch friedvoller Tod, den Sam Peckinpah nur einem Protagonisten der Wild Bunch, Sykes, vergönnt. Alle anderen wird er nach Ende der „Dorfszene“, da sie am nächsten Morgen nach der Fiesta aus dem Dorf heraus in ihr finales Abenteuer reiten, an ihrer eigenen Begräbnis-Prozession teilnehmen lassen. Denn gesäumt wird ihr Weg dann sein von den Bewohnern des Dorfes, die eine traurige Weise anstimmen werden:
Wohin wird sie fliegen,
so schnell und erschöpft?
Die Schwalbe, die von hier fortfliegt?
Oh, wenn im Wind sie sich verirrt?
Auf der Suche nach Schutz,
und ihn nicht findet?
Neben meinem Bett
will ich ihr ein Nest aufstellen,
wo sie sich ausruhen kann unterwegs.
Auch ich bin verirrt hier im Lande,
oh heiliger Himmel,
und kann noch nicht einmal fliegen.
Ich höre Dich singen,
oh zarte Schwalbe!
Ich werde an meine Heimat denken
und weinen.
„The Wild Bunch“ wird fortgesetzt. Der Einfachheit halber wird der nächste Teil hier angefügt. Um das dann schneller und besser erkennen zu können, erhält die Überschrift des Textes auf der Hauptseite den Zusatz „Teil 2, 3, etc.“ und wird der Anfang des neuen Teils im Text hier durch ein Bild markiert.